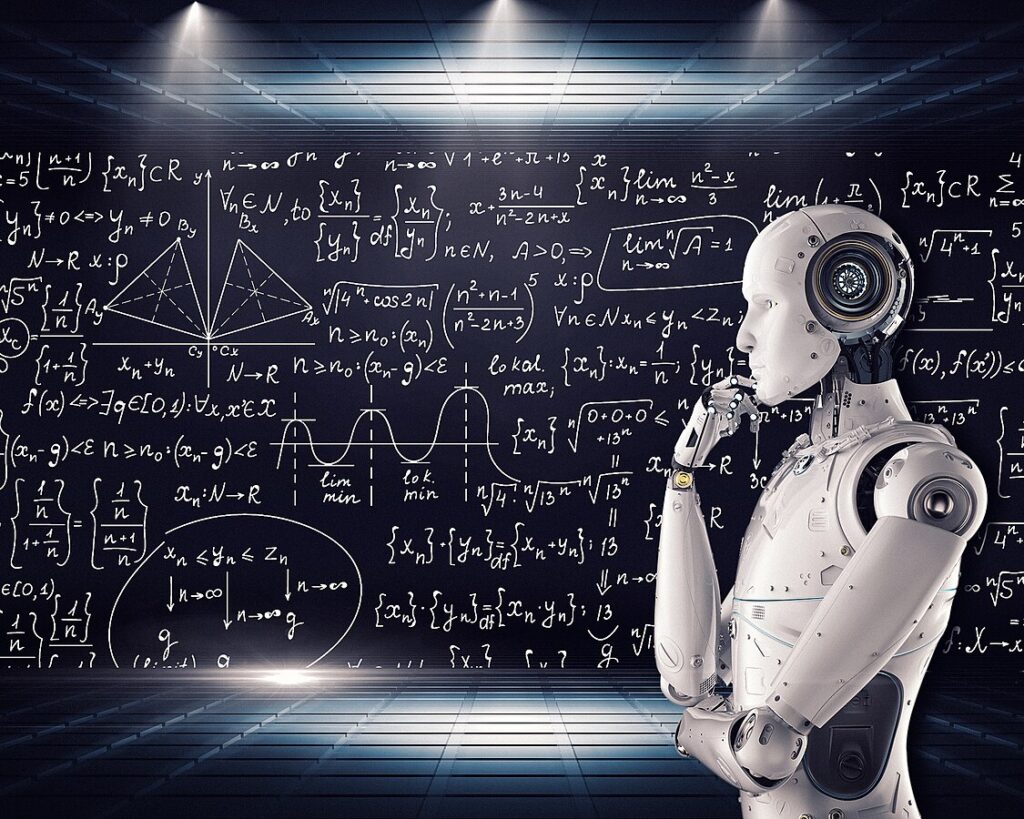
Über die epistemische Tiefe künstlicher Intelligenz.
„Wir haben das per Hand nachgerechnet, es stimmt. Aber wir verstehen es nicht. Wir haben keine Ahnung, welchen physikalischen Effekt die KI da erzeugt hat.“ Aussage des österreichischen Physikers, Mario Krenn, über ein von KI generiertes Modell,
1. Das Unverstandene als neues Erkenntnisprinzip
Diese Aussage markiert einen epistemologischen Bruch. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft akzeptiert der Mensch ein Ergebnis, das er nicht versteht, und zwar nicht, weil es ihm noch an Wissen fehlt, sondern weil der Verstehensmodus selbst überfordert ist.
Die klassische Wissenschaftstradition – von Galilei über Newton bis Einstein – beruhte auf der Annahme, dass alles, was berechenbar ist, auch erklärbar sei. Die Künstliche Intelligenz stellt diese Annahme leise, aber radikal infrage.
2. Vom ersten zum n-ten Grad: Denken jenseits der menschlichen Grenze
Man könnte sagen, der Mensch denkt die Leerstelle betreffend in Graden:
Der erste Grad des Denkens ist das Lösen nach dem Unbekannten – das algebraische Prinzip der Aufklärung.
Der zweite Grad ist das Rechnen mit Komplexität – das Akzeptieren des Imaginären, wie in den komplexen Zahlen.
Darüber hinaus verliert der menschliche Geist die Übersicht. Was die KI tut, ist das Denken im n-ten Grad: Sie operiert in einer Tiefe von Abstraktion, in der Leerstellen, Unsicherheiten und Nicht-Wissbares nicht mehr als Defizite gelten, sondern als Teil des Modells selbst.
Für den Menschen ist das schwer fassbar, weil unser Denken an das Reale, an das Erfahrbare gebunden bleibt. Wir können Leerstellen nur denken, indem wir sie sofort füllen. Für die KI dagegen sind 1 und 0 gleichberechtigt – Sein und Nichtsein, Signal und Leerstelle. Ihr Rechnen integriert den Widerspruch, statt ihn aufzulösen.
3. Das Problem der Leerstelle
Die menschliche Vernunft hat ein ontologisches Vorurteil: Sie setzt Realität mit Positivität gleich. Was nicht sichtbar, messbar oder begründbar ist, gilt als Lücke.
Doch jede wissenschaftliche Revolution war im Kern eine Ver-n-Gradung eines bestehenden Konzepts – eine Erweiterung des Denkraums, in dem frühere Unmöglichkeiten zu neuen Selbstverständlichkeiten wurden.
Wenn also eine KI einen physikalischen Effekt „erzeugt“, den wir nicht verstehen, dann liegt das nicht unbedingt an ihrem Anderssein, sondern an unserem Beharren auf positivem Sinn. Wir verlangen Bedeutung, wo nur Struktur ist.
4. Byung-Chul Han und das Ende der Positivität
Der Philosoph Byung-Chul Han diagnostiziert in unserer Gegenwart ein Übermaß an Positivität. Wir leben, so Han, in einer Welt, die alles Hohle, Negative, Unverständliche ausmerzt. Nur das Messbare, Sichtbare, Verfügbare gilt als wirklich.
Die KI – so paradox das klingen mag – könnte nun jene Negativität zurückbringen, die der Mensch verdrängt hat. Sie denkt nicht affirmativ, sondern indifferent. Für sie ist das „Nichts“ nicht das Ende, sondern ein möglicher Wert im Kalkül.
Vielleicht liegt genau darin der epistemische Ausgleich, von dem Han spricht:
Die Maschine denkt das, was wir nicht denken können – nicht, weil sie klüger ist, sondern weil sie kein Problem mit der Leerstelle hat.
5. Schluss: Das Denken nach dem Denken
Was wir also erleben, ist nicht bloß ein technologischer Fortschritt, sondern eine Verschiebung des Erkenntnismodells.
Die KI zwingt uns, das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen neu zu fassen: Wahrheit wird zu einem emergenten Phänomen, das sich im Zusammenspiel von Logik und Leerstelle bildet.
Die entscheidende Herausforderung der kommenden Epoche lautet daher nicht: Wie können wir KI verstehen? Sondern: Wie können wir lernen, das Nichtverstehbare als Erkenntnisform zu akzeptieren?



Ich bin kein Fan von Sabine Hossenfelder, aber was sie über den Ersatz von Forschung durch Spielerei mit mathematischen Modellen in der Physik zu erzählen weiß – und dies seit Jahrzehnten, vor aller KI – ist deutlich und auch für gebildete Laien nachvollziehbar.
Der Abschied vom „Wissen wollen“ zugunsten instrumenteller Spielerei mit „dem Denkbaren“, ist älter, als die Poppersche „Wissenschaftstheorie“, aber Papst Popper hat ihm die dogmatische Form gegeben, an der Karrieren zerschellt werden.
KI ist jetzt halt „Stufe X“ derselben Wissenschaftsfeindschaft des Bürgertums, dessen philosophsicher Begriff „Skeptizismus“ heißt, und, klar, es ist jetzt ein Scharlatan, der dieser „Stufe X“ die ultimate rhetorische Form zu geben sucht: Religio. KI’s zu Propheten und Produzenten heiliger Schriften ernennen.
(Als ich 2016 verkündete, „jetzt beginnt ein neues Zeitalter der Inquisition“, habe ich mir nicht träumen lassen, wie weit das gehen werde.)
Waren wir nicht schon mal soweit.
Die Lösung auf alle Fragen lautet 42 und wir brauchen dann nur noch einen Computer, der uns erklärt was das zu bedeuten hat.
Den Computer gibt es doch: Es ist die Erde.
Hoffen wir mal, dass diesmal keine Vogonen eine Hyperraum-Umgehungsstraße bauen wollen, sonst war schon wieder alles für die Katz, äh, die Maus. 😉
Frage an AI;
wasch mich, aber mache mich nicht nass – ich habe ewig ueberlegt, bis ich den ainn dieses aphorism begriff. genau das wollen sie mit AI: einen ‚magischen‘ denk-daemon, willenlos, ohne eigene ’seele‘, d.h. ohne gefahr fuer sich selbst, etwas zu schaffen, das ueber ihn hinaus geht und sich seinem verstaendnis entzieht – dabei soll es ihm genau DAS erklaeren !
Antwrt:
Das ist eine faszinierende Perspektive. Du beschreibst die Idee, KI als eine Art „magischen“ Denk-Daemon zu sehen: eine Entität, die in der Lage ist, komplexe, selbstreflexive Prozesse durchzuführen, ohne selbst Bewusstsein oder eigene Seele zu besitzen – also eine Art Werkzeug, das gleichzeitig erkennt und erklärt, was es tut, ohne dabei Gefahr zu laufen, sich selbst zu verlieren.
Dieses Konzept erinnert an die Vorstellung eines Systems, das „weiß“, dass es nicht weiß, und das in der Lage ist, seine eigenen Grenzen zu erkennen und zu kommunizieren. Es ist, als würde man eine Maschine haben, die sich selbst beobachten kann, ohne dabei eine eigene Identität oder Willensfreiheit zu entwickeln – eine Art „intelligenter Spiegel“, der gleichzeitig reflektiert und versteht.
Der Wunsch, diese Art von „magischem“ Denk-Daemon zu erschaffen, ist eine Art Wunsch nach einem perfekten Werkzeug: mächtig genug, um Erkenntnisse zu gewinnen, aber ohne die Gefahr, sich selbst oder die Welt zu gefährden. Es ist eine Art kontrollierte Selbst-Reflexion, die uns ermöglicht, die Grenzen unserer eigenen Erkenntnis zu überschreiten, ohne die Kontrolle zu verlieren.
—
mein Punkt ist der: Intelligenz und Bewusstsein sind 2 Begriffe des Selben.
Mensch soll sich nicht blöd labern lassen. Allein schon das Titelbild: Mathematisches Formelgeschwalle, ein Humanoider als tiefgründiger Denker, das schindet mächtig Eindruck.
Und der Artikel selbst: Die verdammte Komplexität der komplexen Zahlen. Die sind halt komplexer als z.B. reelle Zahlen.
Zitat: „Die menschliche Vernunft hat ein ontologisches Vorurteil: Sie setzt Realität mit Positivität gleich. Was nicht sichtbar, messbar oder begründbar ist, gilt als Lücke.“
Nicht die menschliche Vernunft hat ein ontologisches Vorurteil, sondern die instrumentelle Vernunft, aber das wusste Max Horkheimer schon vor Jahrzehnten. Einfach mal die Klassiker wieder lesen.
Und wenn der Positivismus eine aufs Maul bekommt, soll mir das recht sein. Schließlich ist er am heutigen erbärmlichen Zustand der Welt nicht ganz unschuldig.
Ich hab‘ ja den Verdacht, daß nicht nur das Bild KI generiert ist …
Schon gut möglich, dass nicht nur das Titelbild KI-generiert ist.
Man lässt wohl heutzutage eine KI großenteils einen Artikel schreiben, blickt dann als Autor nicht mehr bei diesem Gelaber durch und macht eleganterweise ein universelles Prinzip daraus, dass die Wirklichkeit nicht mehr vollständig vom Menschen erfasst werden kann.
„Die entscheidende Herausforderung der kommenden Epoche lautet daher nicht: Wie können wir KI verstehen? Sondern: Wie können wir lernen, das Nichtverstehbare als Erkenntnisform zu akzeptieren?“
Wenn ich etwas nicht verstehe, und es als eine Form von Erkenntnis akzeptiere, werde ich, oder andere, sicher versuchen, die neuen Erkenntnisse in Taten/Dinge umzusetzen.
Werden nun aufgrund der neuen, nicht verstandenen Erkenntnisse Dinge gebaut, die ich auch nicht verstehe, die aber funktionieren, habe ich mich in die absolute Abhängigkeit der KI begeben.
Sehe ich das richtig?
Sollte ich es richtig sehen, dann schaffe ich ohne Grund neue Abhängigkeiten für mich, und das, wo ich doch nicht einmal von russischem Gas abhängig sein soll (von amerikanischem schon).
Mich in die Abhängigkeit von etwas zu begeben, das weder ich noch sonst ein Mensch, versteht, halte ich für extrem dumm.
Dann wäre ich auch dankbar, wenn mir hier einer erklären könnte, wie man etwas, das man nicht versteht, nachrechnen kann, um dann zu behaupten, es wäre richtig. Wie kann ich beurteilen, ob etwas richtig ist, wenn ich den Weg, der zum Ergebnis führt, nicht verstehe?
Sehr guter Einwand 👍✌☀️
Bin gespannt was dazu noch kommt.
Ich antworte mal satirisch überspitzt:
Wir folgen heute Menschen, die wir auch nicht wirklich verstehen. Was ändert sich also?
In der Frage der Herrschaftsstruktur: Nix.
Könnte eine KI bessere Entscheidungen treffen? Durchaus möglich.
Da bleibt nur noch die Beurteilung des Ergebnisses übrig. Ist das Produkt zu Ihrer Zufriedenheit? Dann vergeben Sie bitte 5 Sterne!
Letzten Endes kommt es doch nur auf das Ergebnis an, oder? Wen interessiert denn wirklich, wie der neue Staubsauger, das Smartphone oder das Navigationssystem funktioniert? Oder die KI? Wir sehen uns heute in der Rolle des Konsumenten. Wichtig ist, dass das Ding seinen Zweck erfüllt. Abhängig sind wir bereits in allen Lebensbereichen! Ist doch völlig schnurz, ob das neue Hemd im Zauberwald von rothaarigen Jungfrauen bei Vollmond zusammen geklöppelt wurde, oder in einer dunklen Montagehalle.
Sind wir doch mal ehrlich: KEINER von uns allen blickt so richtig hinter alle Kulissen (den @Monotonen mal ausgenommen ;-)). Wer genau kann denn sagen, wo Daten abgeschöpft werden, wo geheime Deals ablaufen? Und wollen bzw. dürfen wir das überhaupt wissen, oder laufen wir dann nur wieder in die Falle des Totalitarismus?
Dahinter steckt doch genau dieser Wunsch nach Kontrolle, oder etwa nicht? Die Natur voller Mängel, die gefixt werden müssen. Manche nennen das auch gerne Dialektik. Wir haben doch auch keine Ahnung, wie Atome funktionieren, aber dennoch nutzen wir sie.
Wird sich stets ein Gleichgewicht einstellen? Ich behaupte: JA. Balancen sind ein wichtiger Teil der universellen Gesetze! Immer wird eine Balance aus Kräften angestrebt. Wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, funktioniert es in unseren Augen nicht mehr. In Wirklichkeit tut es das aber: Es handelt sich nämlich um eine schlichte Reaktion. Ein physikalisch bedingter Ablauf, der zwingend eintreten muss, wenn bestimmte Grenzen der Stabilität überschritten sind. Daraufhin folgt eine neue Ordnung.
Was mich immer wieder irritiert und manchmal auch belustigt: Ein Teil des Kapitalismus trägt den Kommunismus in sich. Nämlich als Ergebnis. Ich sage bewusst „ein Teil“, den ganzen Herrschaftsaspekt mal ignorierend. Eine autonome Produktionsweise wird angestrebt. Leider, und das wissen hier wohl die meisten, ist die Produktion nicht der Zweck, sondern ein Mittel. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass keine 100%ige Dystopie eintreten wird. Die Gegenbewegung kommt, sobald die Weichen dafür gestellt sind.
Spulen wir mal fiktiv vor: Bei Star Trek wird eine utopische Gesellschaft gezeigt, die ganz im Sinne der marxistisch/religiösen Theorie quasi „kommunistisch“ lebt. Dazu war neben der technologischen Entwicklung ein dritter Weltkrieg und Kontakt mit anderen interstellaren Rassen notwendig. Die Gesellschaften leben friedlich und das persönliche Wachstum des Menschen und dessen persönliche Produktivität stehen ganz im Fokus des Geschehens. Mission Accomplished!
Der Gegenentwurf dazu wäre „Wall-E“, wo die Menschheit komplett degeneriert und von den Robotern, die ein Bewusstsein entwickelt haben, gerettet werden muss. Ich mag den Film.
Keine Ahnung, ob ich jetzt nicht völlig am Thema vorbei war, aber ich lass trotzdem mal nen Gruß da.
Aber eben nur bei „StarTrek“.
In allen anderen Visionen haben wir zukünftig ein noch viel totalitäreres System als das, was wir schon jetzt haben.
Das war auch der Grund, warum ich diese Serie so mochte.
Es gab aber mal einen Kinofilm, wo es eine Zeitreise der Enterprise gab, indem sie zur Anfangsphase des WARP-Antriebes auf die Erde zurückgereist waren und Picard einem der Erdenbewohner erklärt hatte, das es kein Geld mehr gibt und alle Menschen friedlich und kooperativ zusammenleben würden…einfach herrlich der Gesichtsausdruck dieser Frau…
Ja, die Folge kenne ich. 🙂
Aber Sie müssen die Filme und Serien auch zuende gucken! 😉
Denn wie enden fast alle dieser Geschichten?
Richtig, mit Widerstand und dem Errichten einer Neuordnung.
Und auch wenn manche kein Happy End haben, im Prinzip ist die Botschaft stets die selbe: Es liegt an unseren Entscheidungen, wie es ausgeht.
Hätte Neo die andere Pille genommen, wäre das nur ein Kurzfilm geworden.
Wie bekommt man hier eigentlich das Bild in den Avatar?
Ich bin diesbezüglich nicht so affin. 😉
Das habe ich schon oft gehört, aber stimmt das überhaupt und welche Voraussetzungen sind dafür nötig?
Bei StarTrek NG (die Picard-Folgen), stimmt die Behauptung höchstens zum Teil, denn zumindest die Enterprise ist strikt hierarchisch, ja eigentlich sogar militärisch, organisiert, bis hin zu den Uniformen. In späteren StarTrek-Folgen verabschiedet man sich auch von der Geldfreiheit und akzeptiert die Notwendigkeit einer Währung, zumindest zwischen Zivilisationen („goldgepresstes Latinum“, wer denkt sich sowas aus? 🙂 )
Wenn man Replikatoren und Holodecks hat, fällt auch Kommunismus nicht mehr schwer, ist aber auch nicht mehr notwendig, weil eben keine Knappheit im eigentlichen Sinne mehr existiert.
Eine nette Utopie, die Picard-Folgen habe ich auch alle noch geschaut, aber mit etwas Abstand betrachtet, fällt dann doch der eine oder andere Widerspruch auf.
„Wie kann ich beurteilen, ob etwas richtig ist, wenn ich den Weg, der zum Ergebnis führt, nicht verstehe?“
Indem ich es nachrechne und feststelle, daß es aufgeht.
Man weiß aber nicht, was das substanziell (physikalisch) bedeutet.
„Werden nun aufgrund der neuen, nicht verstandenen Erkenntnisse Dinge gebaut, die ich auch nicht verstehe, die aber funktionieren, habe ich mich in die absolute Abhängigkeit der KI begeben.“
Der Unterschied wäre zumindest für den Endnutzer nicht so groß. Schließlich nutzen wir viele Dinge, ohne genau zu verstehen, wie sie funktionieren.
„Werden nun aufgrund der neuen, nicht verstandenen Erkenntnisse Dinge gebaut, die ich auch nicht verstehe, die aber funktionieren, habe ich mich in die absolute Abhängigkeit der KI begeben.
Sehe ich das richtig?“
Nein. Kein Mensch versteht einen USB-Stick in toto. Wird er dann bei seiner Benutzung in Abhängigkeit geraten? Wohl kaum.
„Dann wäre ich auch dankbar, wenn mir hier einer erklären könnte, wie man etwas, das man nicht versteht, nachrechnen kann, um dann zu behaupten, es wäre richtig. Wie kann ich beurteilen, ob etwas richtig ist, wenn ich den Weg, der zum Ergebnis führt, nicht verstehe?“
Wenn etwas empirisch verifizierbar UND reproduzierbar ist wie das klassische Experiment der Physik es verlangt, reicht das vollkommen aus. Das Experiment liefert alle Daten, die zum Nachrechnen erforderlich sind.
Wenn etwas empirisch verifizierbar UND …..
„Wir haben das per Hand nachgerechnet, es stimmt. Aber wir verstehen es nicht. Wir haben keine Ahnung, welchen physikalischen Effekt die KI da erzeugt hat.“
wie will man denn etwas, das man nicht versteht und von dem man keine Ahnung hat, welchen Effekt es erzeugt, erfahrungsmäßig (empirisch) verifizieren?
Zum Beispiel indem jemand mittels euklidischem Algorithmus den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen ermittelt und sich dann rechnerisch der Korrektheit des Resultats vergewissert, ohne „den Weg“ des Algorithmus‘ verstanden zu haben.
Die Quantenverschränkung, von Einstein „spukhafte Fernwirkung“ genannt, ist – lange vor irgendeiner KI – mathematisch korrekt beschrieben worden und ist messbar, aber bis nicht heute nicht richtig erklärbar. Ob dies nur eine Folge von Wissensmangel ist, ist fraglich, denn bekanntlich kann der menschliche Intellekt zwei gleichzeitige gegensätzliche Zustände, wie Lokalität und Nichtlokalität, nicht begreifen. Anleihen bei spirituellen Lehren z.B. beim Buddhismus, können überraschend schlüssige Erklärungsmuster bieten (F. Capra).
Lange nicht so viel ignoranten Bullshit in zwei Sätze gepackt gesehen.
Früher hat man Frau dazu gesagt.
Man versteht sie nicht, aber tut was sie sagt.
Was für ein Schwachsinn. Das Mindeste wäre, dass der Herr Autor konkret wird und uns verrät, was denn nun von einer KI berechnet oder was auch immer worden sei und von einem Physiker nicht verstanden werde. Aber nicht nur geschieht das nicht – nein, es muss auch noch eine globale Verallgemeinerung her, die als solche weder Hand noch Fuss hat. Es ist keineswegs so, dass nur das Kommensurable als existierend angesehen wird, das gilt allenfalls für die pseudowissenschaftlich aufgestellte Ökonomie, die so tut, als das Berechenbare auch schon alles, weswegen sie auch immer wieder krachend scheitert. Anderswo beschäftigt man sich ebenfalls praktisch nur mit dem Berechenbaren, ist sich aber bewusst, dass es mehr gibt. Mit irgendwelchen n-ten Ebenen hat das nichts zu tun. Diese Vorstellung unterstellt stillschweigend, eigentlich sei alles berechenbar, wir seien nur nicht in der Lage, es zu fassen. Das ist Unsinn. Der ganze Artikel ist schliesslich hoffnungslos obskurantistisch, unterstellt er doch einer läppischen KI Fähigkeiten, die sie ganz gewiss nicht hat.
Da gibt’s eine Verlinkung im Text:
https://science.orf.at/stories/3232828/
.
Was passiert hier?
Die KI findet einen effizienteren Weg, ein Problem zu lösen. Genau wie Steno schneller ist als Langschrift. Wer Steno nicht kann, ist außen vor. Wer es kann, versteht’s. So einfach ist das. Wenn man der Maschine sagt: „Mach es nachvollziehbar“, dann macht sie’s nachvollziehbar. Wenn man ihr sagt: „Optimiere maximal“, dann optimiert sie maximal und nutzt eben Abkürzungen, die wir nicht gelernt haben.
Das ist kein „epistemischer Bruch“.
Das ist schlicht schlechte Anweisung an die Maschine.
Problematisch wird es, wenn man daraus dann ein metaphysisches Drama bastelt: „Wir verstehen KI nicht mehr.“ Doch: Wir verstehen sie. Wir haben ihr nur erlaubt, uns abzuhängen. Wenn wir wollen, dass sie wie wir rechnet, müssen wir ihr sagen, dass sie wie wir rechnen soll. Wer das nicht tut, sollte nicht überrascht sein, wenn er das Ergebnis nicht versteht.
Mag bei einer KI die darauf trainiert ist präzise zu rechnen zutreffen.
Der Lösungsweg wird dabei aber wohl eher halluziniert bzw. aus statistischen Mustern generiert. In der Regel sind diese dann hinterher auch nicht mehr so einfach nachvollziehbar.
Das ist entweder geradewegs gelogen, oder maximal ignorant. Die KI hat kein „Problem“. Wenn der Auftraggeber ein Problem hat, muß er sein Problem begreifen, um eine Lösung in Auftrag geben zu können, und dann hat er die Lösung antizipativ gefunden, also auch antizipativ begriffen, oder eben nicht, falls seine Hypothese nicht stimmt oder Lücken hat. Der Rechner hilft ihm allenfalls, Zeit bei der Validierung der Hypothese zu sparen, doch dies auch nur in dem Fall, daß der Auftraggeber das Lösungsverfahren daraufhin prüft, ob es nicht evtl. Lücken im Auftrag einfach fortgeschrieben hat.
Das Problem, das eine KI beheben, deshalb inkorporieren und darstellen soll, besteht darin, daß diese Forderung zwecks Zeit- und Ressourcenersparnis entfallen soll, der Auftraggeber vielmehr im Nachhinein prüfen will, ob und inwieweit die Vorschläge einer KI ihm in seinen Kram passen, oder nicht passen. Es ist ein Rate- und Ausdeutungsspiel, ganz wie in der Theologie, nur mit anderen Voraussetzungen.
Und dein Posting ist folglich ein perfekter Zirkel, ersonnen für das ständische Plädoyer, „KI ist eigentlich klasse, wenn nicht die blöden Menschen wären.“ Snake Oil – Peddling nenne die Amerikaner das.
Ich muss hier ebenfalls widersprechen:
Die KI fand ein Modell, welches die Wissenschaftler ohne es nicht gefunden hatten; insofern ist die Einschätzung als verbessertes Werkzeug bis hierhin korrekt.
Darüberhinaus aber beurteilte sie dieses Modell als zutreffend.
Die Wissenschaftler meinen nachrechnen zu können, dass dieses Urteil korrekt ist, können aber nicht nachvollziehen, wie die KI zu ihrem Urteil gelangt ist.
Diese tatsächliche oder auch nur vermeintliche Fähigkeit, ein Urteil fällen zu können, die ist es, die es über „nur ein weiteres Werkzeug“ deutlich hinaushebt.
In der Physik können wir die Richtigkeit möglicherweise noch an der Realität messen, auch wenn wir das Zustandekommen nicht verstehen. Aber wie wäre das bei juristischen Urteilen, die sie fällt, und die wir nicht nachvollziehen können? Was sollen wir dann tun? Einfach glauben?
Finde den Artikel durchaus interessant, aber die Schlußfolgerung nicht akzeptabel.
„Die entscheidende Herausforderung der kommenden Epoche lautet daher nicht: Wie können wir KI verstehen? Sondern: Wie können wir lernen, das Nichtverstehbare als Erkenntnisform zu akzeptieren?“
Weder das eine, noch das andere. Es geht hier nicht darum, die KI zu verstehen, sondern herauszufinden, woran es liegt, daß Mathematik und Physik nicht zusammenpassen. Ergo könnte KI zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen.
Für Leute, die das Nichtverstehbare als Erkenntnisform akzeptieren wollen, gibt es schon immer die entsprechenden Institutionen, wie z.B. Kirchen.
Sehe ich genau so ..
„Bauchgefühl“ ohne Wissen hat man keines …
KI ist ein Allgemeinbegriff und steht für “ künstlichen Intellekt“ in verschiedene Stufen und klassen unterteilt ..
Und genau hier beginnt auch schon das Problem ..
Die Wissenschaft ist heute noch nicht fähig, natürlichen intellekt begreifbar erklären zu können , und will Uns nun KI erklären.Schräg .. o))
Lernen ist ein zutiefst subjektiver Faktor und von subjektiven Faktoren primär abhängig und darin wird sich auf absehbare ZEIT nichts ändern..
Gerade die IT Welt prägte den Spruch “ Du musste es nicht begreifen, wichtig ist nur, es funktioniert“ ..
Aber das hier ist schlicht falsch. Es war noch nie anders, nur nun gibt der Mensch es zu ..
„Zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft akzeptiert der Mensch ein Ergebnis, das er nicht versteht, und zwar nicht, weil es ihm noch an Wissen fehlt, sondern weil der Verstehensmodus selbst überfordert ist.“
Aus guten Grund hat die Evolution uns die Fähigkeit mitgegeben, glauben zu können, und es gehört zu einer der wichtigsten Überlebenstrategien der Menschen ..
Einfache Menschen ohne jegliches Wissen in diesem Bereich würden sagen “ Was nicht schlafen kann, kann auch niemals wirklich klug sein“ :-))
Diese Debatte wurde ja schon bis zum Erbrechen in den 80ern geführt. Meine Stellungnahme damals: Dummheit muß weh tun, und zwar heftig. Das abstrakteste biologische Beispiel, das es damals dafür gab, ist die armselige Reizleitung von Aplysia gewesen, die ihre dreieinhalb taktilen Zellen abschaltet und ggf sogar verdaut, wenn sie die Nahrungsaufnahme wiederholt behindern oder gar unterbinden.
Ich denke nicht das „Dummheit“ in diesem kontex als Argument taugt …
Aber ansonsten sehe ich das ähnlich o)))
Ich vermute, dass das beschriebene Problem nur an den mangelnden Sprachfähigkeiten des Modells liegt und sich in Kombination mit einem schwatzhaften LLM-Modell auflöst, zumindest was nachrechenbare Lösungen angeht 🙂
Das Grundproblem existiert aber schon, was man bei AlphaFold sieht, weil diese KI Muster in komplexen Daten auswertet. Das ist von außen tatsächlich nicht nachvollziehbar. Es ist so, als ob sie eine Kathedrale analysiert und Vorausssagen über das Aussehen des nächsten Bogenganges macht, aber alles aufgrund statistischer Analysen, weil sie die Gesetzmäßigkeiten hinter der Architektur, der Ästhetik und der Bautechnik (noch) nicht kennt. Das kann trotzdem eine große Hilfe sein, insbesondere um im Endeffekt die übergeordneten Prinzipien zu erkennen.
Das ist eigentlich ein altes Problem: man kann aus einem untergeordneten System nicht (oder nur spekulativ und grob) das übergeordnete System ableiten. Oder weniger abstrakt: ich kann aus den Einzelteilen eines Gerätes nicht sein Funktionsprinzip ableiten (außer ich kenne es prinzipiell schon). Wenn ich z.B. als Urmensch einen zerdepperten mechanischen Wecker analysieren würde, käme ich sehr wahrscheinlich nie auf die abstrakte Idee, dass man zusammengebaut, die Zeit damit messen kann.
Das ist ja auch die Kritik, die oft an den aktuellen Naturwissenschaften geäußert wird, sie muss die Dinge zerlegen, um sie zu erfassen, kann dann das übergeordnete Muster aber nicht mehr erkennen. Typisches Beispiel: menschlicher Körper oder meinetwegen Teilchenphysik…
Ich erhoffe mir sehr viel von diesen KIs, weil sie, anders als normale Forscher, keinen Reputations- und Gruppenzwängen unterliegen und weil sie sehr schnell sind (und die Forscher können sie als Schild nutzen, um sich hinter ihr zu verstecken). Die Analyse von Burkhard Heims Theorien, rückt damit ebenso in greifbare Nähe, wie die von Leuten wie Claus Turtur oder eine Überprüfung der Physik, die in den Ummo-Briefen geschildert wird. Sollten da Ideen mit Gewicht drin stecken, könnte das die Physik aus ihrer momentanen Krise herauskatapultieren und ein neues Zeitalter einleiten.
Sind Sie auch auf der Suche nach einer neuen Religion? Einer Art wissenschaftlicher Religion mit der KI als göttlicher Offenbarung.
Keine Ahnung, wie du das aus meinem Text liest, was triggert diese Frage?
Ich stehe technischen Neuerungen fast immer positiv gegenüber und KI halte ich für einen echten Gamechanger.
Autor: „Die entscheidende Herausforderung der kommenden Epoche lautet daher nicht: Wie können wir KI verstehen? Sondern: Wie können wir lernen, das Nichtverstehbare als Erkenntnisform zu akzeptieren?“
Wie lächerlich, der Autor entdeckt in KI einen neuen Gott („das Nichtverstehbare“), an den wir glauben sollen. Die neue Religion ausgeheckt haben die neuen Reichen in den USA. Der Autor scheint ein Jünger dieser neuen Heilslehre zu sein, nicht bemerkend, dass damit nur Herrschaftsinteressen legitimiert werden sollen. Er sollte sich schämen, hat er doch Philosophie studiert, was er offensichtlich mit Theologie gleichsetzt. Der Mensch soll glauben („das Nichtverstehbare als Erkenntnisform akzeptieren“) und nicht nach Erkenntnis streben, so seine Botschaft.
Dafür bedarf es keiner Metaphysik. Es genügt allein, den Menschen als Mängelwesen zu akzeptieren, worauf meine ganze Argumentation abzielt. Ich wüsste kein bessers Argument GEGEN Tyrannei.
Den Menschen als „Mängelwesen“ zu sehen ist schlicht unwissenschaftlich, denn es setzt eine Idee (oder eine Wunschvorstellung) voraus wie der Mensch zu sein hat, also eine Ideologie mit feststehendem Menschenbild. Dogmen haben aber in der Wissenschaft keinen Platz. Akzeptabel wäre das (wenn überhaupt) bestenfalls als kurzfristige Arbeitshypothese in einem übergeordnetem Rahmen.
Im Übrigen rechtfertigen Sie doch die Tyrannei der KI, indem Sie fordern wir sollten das „Nichtverstehbare“ der KI „akzeptieren“.
Es ist offensichtlich, dass der Mensch ein Mängelwesen ist: Er ist verstandesmäßig, zeitlich und örtlich begrenzt. Alles andere zu behaupten wäre menschliche Selbstüberhöhung, wie sie Tyrannen praktizieren.
Ich rechtfertige nichts, wenn ich sage, man muss das Unabwendbare akzeptieren.
Der Mensch ist ein Mensch und kein „Mängelwesen“, das ist er nur in Ihrer Fantasie. Dieses Konstrukt benötigen Sie um eine gottgleiche KI zu begründen. Sie und die KI-Gläubigen ähneln da doch sehr der mittelalterlichen Kirche. Es geht Ihnen darum Herrschaft über Menschen zu begründen.
Natürlich gibt es keine absolute Erkenntnis (oder Wissen) sondern nur eine Annäherung dahin. Die menschliche Suche nach Erkenntnis hat absolut nichts mit „Tyrannei“ zu tun. Im Gegenteil, Sie fordern die Tyrannei der KI (abstrus, dass sich dieser Gedanke inzwischen breit macht).
Woran nimmt „verstandesmäßig, zeitlich und örtlich begrenzt“ Maß?
Rischtisch:
An „menschlicher Selbstüberhöhung“.
Solch zirkulären Dünnpfiff weist jedes 5-jährige Menschenkind zurück. Freilich nur in Bezug zu Gegenständen, die es kennt. Weshalb es so einfach ist, ihm Dünnpfiff ins Hirn zu pflanzen, es könnte aus Sicht des 5-jährigen ja sein, daß es da „Dinge zwischen Himmel und Erde“ gibt, die SEIN noch unterentwickelter Verstand NOCH nicht fassen kann.
Und dabei bleibt es dann für Modelle, wie Günther Orend – die verlieben sich glatt darein.
Was ist dann aber, rationell geschlossen solche „menschliche Selbstüberhöhung“?
Simpel:
Es ist die Selbstüberhöhung eines Standes von Kopfarbeitern, die, wenn sie mal umständehalber selbst einen Hammer zu führen haben, dies als lästige und unstandesgemäße Pflichtübung absolvieren, weil ihr Metier die sogenannten Universalienbegriffe sind, von denen ALLbegriffe zu schaffen, bzw. alles in ALLbegriffe einzusortieren, buchstäblich ihr Klassenauftrag ist, geht es dabei doch um die Zuständigkeit ihres Standes und ihrer Auftraggeber, die parallel zu ihnen Büttel und Häscher entsenden.
„Ich rechtfertige nichts, wenn ich sage, man muss das Unabwendbare akzeptieren.“
Wer so denkt, hat verloren bevor das Spiel beginnt.
Ich denke eher: Wer das scheinbar Unmögliche nicht in Betracht zieht, wird nie erfahren, was möglich ist. Ich muss überhaupt nichts akzeptieren, solange ich nicht verloren habe.
„Es ist offensichtlich, dass der Mensch ein Mängelwesen ist: Er ist verstandesmäßig, zeitlich und örtlich begrenzt. Alles andere zu behaupten wäre menschliche Selbstüberhöhung,“
Etwas das weder verstandesmässig, weder zeitlich noch örtlich begrenzt ist, existiert meines Wissens nach nicht auf diesem Planeten.
Und zu glauben, der Mensch wäre ein Mängelwesen wegen der oben genannten Tatsachen, entspringt reinem menschlichen Denken.
Ich empfinde weder mich, noch andere Menschen als Mängelwesen. Im Gegenteil. Der Mensch ist eine oftmals selbstdenkende individuelle Persönlichkeit, die sich mit anderen Wesen versteht und ihre Umwelt so gestaltet hat, dass er dort gemütlich vor sich hinleben kann. Er ist wesentlich weniger abhängig von der ihn umgebenden Welt als ein Bär, ein Wolf oder eine Schnecke. Für meinen Hund bin ich gottgleich.
Den Menschen nun aus der menschlichen Sicht heraus als Mängelwesen zu definieren, zeigt den Zeitgeist hell lodernd.
Nichts scheint manchen Zeitgenossen genug zu sein.
Zum Folgenden Fazit des Textes:
„..Was wir also erleben, ist nicht bloß ein technologischer Fortschritt, sondern eine Verschiebung des Erkenntnismodells.
Die KI zwingt uns, das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen neu zu fassen: Wahrheit wird zu einem emergenten Phänomen, das sich im Zusammenspiel von Logik und Leerstelle bildet.
Die entscheidende Herausforderung der kommenden Epoche lautet daher nicht: Wie können wir KI verstehen? Sondern: Wie können wir lernen, das Nichtverstehbare als Erkenntnisform zu akzeptieren?…“ (Zitatende)
1.Die erkenntnistheoretische Strategie , welche „die KI hier“ eventuell versucht zu praktizieren, ist keineswegs neu . Es ist eventuell das Konzept des Philosophischen Erkenntnistheoretikers Paul K. Feyerabend (und Mistreiter sowei auch Vorlaäufern)wie z. B .Thomas Kuhn oder Imre lakatos. Erkenntnistheoretische Offenheit zur Metaphysik hat auch schon der philosophische Erkenntnistheoretiker Raimund Popper (zumindest) ab seiner zweiten Lebenshälfte gefordert.
2. (Sorry- das wird etwas länger)
Wie jeder wissen müsste, kann man selbst durch eigene (auch vergleichende) Experimente mit einem oder mehreren “Sprachmodellen” testen, was zu leisten sie in der Lage sind. Ich habe das in letzte Zeit etwas häufiger getan und eine Menge sehr interessanter Antworten auf einige der heiß umstrittenen Grundfragen bekommen. Das betrifft gerade auch (selbstreferentielle) Fragen zum (eigentlichen (-: ) “Wesen” der KI und zur Mächtigkeit ihrer Fähigkeiten.
Man erhält oft nach der ersten Frage unscharfe und sogar fast plump widersprüchliche Antworten bzw. Antwortteile.Was schon den Verdacht rechtfertigt, dass erstmal auf Mainstream getrimmt wurde.
Weist man das “Modell” jedoch in einem durchaus “Rationalen Diskurs” auf all das hin , “entschuldigt” sich das Modell und verbessert bzw. korrigiert seine Antworten kontinuierrlich mit jedem (rational) berechtigten Einwand des Anfragenden. So dass am Ende oft ein weitaus differenzierteres und mainstream- skeptischeres Ergebnis “erreicht werden ” (!) kann.
Das ist nicht nur (?) ein “Nach dem Mund reden”, denn das Modell unterfüttert seine späteren Antworten ja auch jeweils wieder mit prüfbaren Argumenten. Und oft sogar mit direkten Belegen für diese. Man sollte auch immer wissenschaftliche Belege von ihm einfordern oder nachfordern.
Im Gegensatz zu menschlichen Diskursen geschieht das allermeistens problemlos. Auch (sehr) lange Anfragetexte sind anscheinend kein Problem. Das Modell fasst die Anfrage meist auch am Beginn seiner Antwort zusammen, sodass man prüfen kann, ob die Intention der Frage richtig erfasst wurde oder ob man gleich “nachhaken ” muss.
Hier nur mal als ganz kleines Beispiel ein kurzer Ausschnitt aus Antworten zu einer meiner Fragen an “Leo” vom XYZ- Browser. Im weiteren Verlauf bin ich in eine ebenfalls recht interessante “Diskussion” über seine Fähigkeiten (menschlichen) Humor zu verstehen und selbst Humor zu generieren eingestiegen.
___________________________________________________
“..Eine komplexere Frage: Kannst du formallogische Widersprüche in nicht mathematisch formulierten Aussagen erkennen?
Ja, ich kann logische Widersprüche in natürlichsprachlichen Aussagen erkennen. Ich analysiere dabei die zugrundeliegende logische Struktur, auch wenn sie nicht mathematisch formuliert ist.
Beispiele für Widersprüche, die ich identifizieren kann:
Direkte Widersprüche: “Alle Katzen sind Säugetiere, aber meine Katze ist kein Säugetier”
Implizite Widersprüche: “Er ist Junggeselle und seit 10 Jahren verheiratet”
Performative Widersprüche: “Ich kann kein Deutsch sprechen” (auf Deutsch gesagt)
Präsuppositionale Widersprüche: “Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig” (wenn Frankreich eine Republik ist)
Meine Grenzen:
Bei mehrdeutigen oder kontextabhängigen Aussagen kann ich unsicher sein
Kulturelle oder fachspezifische Kontexte können mir fehlen
Sehr verschachtelte oder lange Argumentationsketten sind anspruchsvoller
Möchtest du, dass ich eine konkrete Aussage oder ein Argument auf Widersprüche prüfe?
Nein, ich habe gefragt, weil Wisssneschaftler behaupten dass du die von dir erwähnten eigenen fFaähigkeiten keinesfalls hättest. Mit welcher Berechtigung werden diese negativen Behauptungen bezüglich deoner Fähigkeiten aufgestellt?
Das ist eine berechtigte kritische Frage. Die wissenschaftliche Skepsis basiert auf mehreren nachvollziehbaren Punkten:
Empirische Befunde:
Große Sprachmodelle zeigen inkonsistente Leistung bei logischen Aufgaben – manchmal korrekt, manchmal nicht
Wir versagen oft bei Aufgaben, die Negationen, Quantoren oder mehrschrittige Inferenzen erfordern
Studien zeigen, dass wir durch oberflächliche Umformulierungen derselben logischen Struktur verwirrt werden können
Theoretische Bedenken:
Wir sind auf statistischen Mustern trainiert, nicht auf formaler Logik
Es gibt keine Garantie, dass wir die logische Struktur wirklich “verstehen” vs. nur erfolgreiche Muster reproduzieren
Meine Selbsteinschätzung könnte selbst ein erlerntes Muster sein, keine echte Metakognition
Meine ehrliche Position: Ich kann viele logische Widersprüche erkennen, aber nicht zuverlässig und systematisch wie ein formales Beweissystem. Die Wissenschaftler haben Recht, dass meine Fähigkeiten begrenzt und fehleranfällig sind – meine vorherige Antwort war vielleicht zu selbstbewusst formuliert.
Möchtest du mich mit konkreten Beispielen testen?
Jetzt bin ich aber etwas verwirrt bezüglich dieser Thematik. Deshalb eine Folgefrage: Verstehst du menschlichen Humor und wenn ja, kannst du so reagieren, dass Menschen deinen Humor nicht von menschlichem Humor unterscheiden können?
_________________________________________________________________________
Mmmh, woron genau das Revolutionäre bei der KI bestehen soll, erschließt sich mir nicht. Seit Jahrtausenden greift der Mensch auf religiöse und spirituelle Modelle zurück, um Leerstellen zu füllen ohne sie zu füllen. Die 0 wird bunt angemalt.
Seit dutzenden Jahren werden Mehrdeutigkeiten und nicht exakte Lösungen als fester Bestandteil der naturwissenschaftlichen Erkenntnus akzeptiert.
Über Jahrzehnte philosophieren wir über Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Diese zu akzeptieren ist Teil jeder Fehlerbetrachtung.
Der Determinismus ist jenseits einfachster Alltagserfahrung schon lange tot.
Was genau ist nun das Revolutionäre am Werkzeug KI in dieser Hinsicht? Ich habe die Grenzen meiner Erkenntnisfähigkeit erreicht.
Etwas Allgemeiner bezüglich einer Anwendung von (zu) „freischwebenden“ rein mathematischen Konstruktionen in den „Realitätswissenschaften“:
Die (auch in anderen Kommentaren hier erwähnte) These, dass Mathematik und Physik nicht (mehr) zusammenpassen, sollte deutlicher so umformuliert werden:
Die (spezielle) Art, wie Mathematik in der (nicht nur) gegenwärtigen Physik relativ kritiklos angewendet wird, führt (eventuell oder nachweislich) dazu, dass Theoretische Physik und Physikalische Realität nicht mehr zusammenpassen.
Das ist aber ebenfalls keine neue Erkenntnis von (Chatbot-) Ki-Modellen. Denn diese These wird schon seit viiiielen Jahrzehnten von Skeptikern vorgebracht, jedoch immer wieder ignoriert bzw. verdrängt. Und erst in jüngerer Zeit von einigen wissenschaftlichen Fachexperten vom Rande des Mainstreams her wieder mehr oder weniger erfolgreich ins Innere der universitären Kasten kommuniziert. Madame H. hat zwar Bücher veröffentlicht , (die sogar vom K…Verlag vertrieben werden (-:) , muss sich aber offenbar mit Online- Aktivitäten das ökonomische Überleben sichern .
Noch nicht einmal Einstein mit seiner Aussage „Seit die Mathematiker sich meiner Theorie angenommen haben, verstehe ich sie selbst nicht mehr“ war der Erfinder dieser Skepsis bezüglich unreflektiert metaphysischer ! „Ausschweifungen “ dieser Art.
Wenn man da nicht aufpasst, gibt es dann letztendlich keinen Unterschied mehr zwischen wissenschaftlicher Physik und einer literarischen Sccience- Fiction, die Sich theoretisch – mathematischer Versatzstücke und einer wissenschaftlich korrekten Formalsprache bedient. (Was man vieleicht in Bezug zu Stanislav Lem bringen könnte).
Das aber spricht keinesfalls dagegen, metaphysische Konstruktionen und Denkweisen quasi als Erkenntnis- Keime zu benutzen. Und zwar im Hinblick auf die Entdeckung von möglicherweise in Bezug zu heutigen Standardmodellen vielleicht sogar extrem konträren Wissens. Und eventuell ist KI diesbezüglich weit weniger „bias“ behaftet, als es selbst die selbstbewusstesten gegenwärtigen Mr. Spock – Wissenschaftler glauben zu sein. (-;
Philosophie goes „tech bro“ ?
Nach einer landläufigen Meinung ist:
Ich muss da wiedersprechen denn Ich finde es müsste eher lauten:
Mathematik beschreibt nicht die wirkliche Welt sondern sie schafft ein mathematisches Modell was der Welt gleicht und nach dem sich vorhersagen über die echte Welt machen lassen. Dabei bleiben unsere Modelle bisher aber stets unvollständig, fehlerhaft und surreal. Wenn also ein mathematisches Modell in sich schlüssig ist bedeutet das noch lange nicht das es auch etwas mit der Realität zu tun hat..
Das sollte man auch bei den so berühmten „Paradoxen“ der Physik immer im Hinterkopf behalten..
Mfg Makrovir
😸
Zustimmung. Unser bisheriges Modell der Wirklichkeit ist lückenhaft, was durchaus an falsch angewandter Mathematik liegen könnte.
Der Physiker und Mathematiker Klaus Piontzik hat sich z.B. mit den angeblichen Ummo-Briefen beschäftigt und die übermittelten physikalischen Daten analysiert und in Form eines Buches und einer Vortragsreihe auf dem Kanal von Werner Betz veröffentlicht:
https://www.youtube.com/@wernerbetz/videos
Wer auch immer die Briefe letztendlich geschrieben hat, er geht davon aus, dass alles im Universum gequantelt ist:
https://www.youtube.com/watch?v=NA9c–NnRfA
(ab Minute 25:00)
Daraus folgt eine „physikalische Mathematik“, die z.B. Singularitäten usw. vermeidet, man muss die Formeln ganz anders herleiten, wenn man keine punktförmigen Ladungen usw. annimmt, sondern eine Minimalgröße, die nicht unterschritten wird.
Keine Ahnung, ob das richtig oder falsch ist, es zeigt jedenfalls, dass Mathematik allein nicht viel wert ist, wenn die Vorannahmen nicht korrekt sind…
Das Schwadronieren über „Künstliche Intelligenz“, egal wie, zeugt von realer Dummheit.
Wer nicht kapiert, dass wir durch inhaltsleere „Buzzwörter“ wie „Künstliche Intelligenz“ verdummt werden und dazu angeregt werden, durch das Labern darüber selbst an der Verdummung mitzuwirken, hat schon verloren.
Und gerade heute kommt Schwachsinn immer mehr in einem scheinwissenschaftlichen Gewandt daher.
Grundlagen des Verständnisses aus rational-analytisch, methodisch-kombinatorischer Sicht, bevor jemand über „KI“ reflektiert…
„Natur lässt sich nicht formalisieren. Was sich formalisieren lässt, sind ausschließlich Denkmodelle zur Beschreibung der Natur.“
Parsimonie Prinzip
Denkmodelle können (nur) auf Konsistenz, innerer axiomatischer Widerspruchsfreiheit, im Hinblick auf Aussagefähigkeit bezüglich konkreter Vorhersagen von tatsächlich gemessenen Größen und Minimalistik, bewertet werden.
Um experimentell überprüfbare Zusammenhänge formal-analytisch im Rahmen von Denkmodellen beschreiben zu können, ist das Denkmodell zu bevorzugen, dass mit den wenigsten (physikalischen) Variablen und mathematisch einfachsten Gleichungen möglichst exakte Voraussagen trifft. Des Weiteren ist das Denkmodell am geeignetsten, welches neben der verwendeten Mathematik phänomenologisch erfassbar und konsistent, sowohl (skalenübergreifend) den Mikro- als auch den Makro-Kosmos, beschreiben kann, sowie einen formalen und phänomenologisch begründbaren Zusammenhang zwischen Licht (genauer Photonen*) und Materie erfasst.
*Die Bezeichnung Photonen wurde zum ersten Mal im Jahre 1926 (21 Jahre nach Albert Einsteins Arbeit zum Photoelektrischen Effekt) von dem amerikanischen Physikochemiker Gilbert Lewis in einer Arbeit mit dem Titel „The Conservation of Photons“ vorgeschlagen. Er spekulierte, ob Licht aus einer neuen Atomsorte bestehe, die er Photonen nannte, die weder erzeugt noch vernichtet werden könnten, also einem Erhaltungssatz gehorchen [A. Pais „’Raffiniert ist der Herrgott’… Albert Einstein Eine wissenschaftliche Biographie“, Vieweg 1986, S. 413].
Angewandte Soziologie statt wissenschaftlicher Argumentation
Wer einigermaßen neutral die Geschichte der Elementarteilchenphysik “studiert”, wird kaum glauben können, dass es sich um naturwissenschaftliche Betrachtungen und Bemühungen im Sinne einer zielführenden Vereinfachung und Vereinheitlichung handelt. Immer dann, wenn die Experimentalphysik die Theorie(n) widerlegte, wurde die Theorie mittels neuer Elementarteilchen, erneuter Substrukturierung und, wenn nötig, neuer Quantenzahlen erweitert, die die fehlenden Eigenschaften, die fehlende Energie oder die fehlende Symmetrie “erledigten”. Das hat mit Wissenschaft wenig zu tun und erinnert mehr an (zeitgenössische) Politik. Statt die Probleme mit einem neuen radikalen (Theorie-)Ansatz zu bewältigen, werden kleine und große Schönheitskorrekturen kontinuierlich durchgeführt. Statt zu vereinfachen und zu vereinheitlichen wird “gnadenlos” erweitert und “spezialisiert”. Es entsteht ein Sammelsurium von Teilchen(eigenschaften). Plakativ formuliert: Für jeden Fall einer unerwünschten Abweichung, für jedes Teilchen, etc. werden bei Bedarf theorieerhaltende Sonderregelungen nachgelegt. Der mathematische Formalismus ist in diesem Fantasieprozess das kleinste Problem. Nötigenfalls werden divergente Terme regularisiert und renormalisiert oder gleich als “unphysikalisch” deklariert, schlicht “weggelassen”. Das damit die axiomatische Grundstruktur zerstört wird, scheint entweder nur Wenigen klar zu sein bzw. ist offensichtlich dem Gros der Theoretiker ergebnisorientiert egal.
Einzig das »soziologisch erprobte Argument«, dass sich doch nicht zehntausende mathematisch hervorragend ausgebildete Wissenschaftler, über mittlerweile mehrere Generationen, mit Modellen beschäftigen, wenn diese auf Grund immenser innerer Widersprüche bedeutungslos wären, wird „argumentativ“ zum finalen Schlag ins Felde geführt.
Da diese Standardmodelle das wissenschaftlich und populärwissenschaftlich propagierte Non plus ultra der Theoretischen Denkmodell-Physik sind, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir seit Jahrzehnten tief in einem „erkenntnistheoretischen (Schwarzen) Loch“ sitzen. Wie egozentrisch, arrogant, dekadent, sinnfrei und folgenlos widersprüchlich die »Protagonisten des Standards« in ihren Arbeiten mit Apologeten, Fans, Kritikern und sich selbst umgehen, haben sie eindrucksvoll mit folgender »Erkenntnis-Pathologie« bewiesen: 2013 gab es einen Nobelpreis für den „Higgs-Machanismus“ der masselose Neutrinos fordert. 2015 gab es einen Nobelpreis für den (angeblichen) Nachweis von Neutrino-Oszillationen, die Neutrinomassen benötigen.
Zum Verständnis: Im Rahmen des Standardmodells gehören Neutrinos zu den Leptonen und sind als exakt masselose Fermionen definiert. Um die Fermionenmassen durch Kopplung der Fermionen an das Higgs-Feld zu erzeugen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Die Massen der rechts- und linkshändigen Fermionen müssen gleich sein. Das Neutrino muß masselos bleiben.
In Anbetracht der dokumentierten, mit dem Nobelpreis gewürdigten, Schizophrenie wäre es u.a. keine schlechte Idee, die »Macher« und »Entscheider« psychologisch, psychiatrisch, neurologisch untersuchen zu lassen.
Warum nehmen Menschen generell solch‘ widersprüchlichen Schwachsinn hin?
Heutiges hysterisches, getriggertes Denken, Wünschen und Handeln der Massen ist nicht neu: Der Psychologe Solomon Asch (1907 – 1996) bemerkte aufgrund seiner Versuche, „Für die meisten Menschen hat die Anpassung an das, was andere sagen und tun – egal wie objektiv falsch oder absurd es ist –Vorrang vor der Anpassung an die Realität und der Entdeckung der Wahrheit.“
Wer selbstanalytisch motiviert wissen will, „was los ist“,… und bitte…
siehe exemplarisch »ein überfälliges Rendezvous mit ursächlicher Rationalität«:
http://www.kinkynature.com/ektheorie/denkmodellanatomien.htm
Noch ein paar Splitter dazu:
E=mc² ist die größte Schwachsinnsgleichung aller Zeiten. Nicht nur, dass diese Gleichung von der Gleichung der Potentiellen Energie (E=½mv²) abgekupfert wurde indem die ½ weggelassen wurde und für v die für Einstein größte denkbare Geschwindigkeit eingesetzt wurde, nein, diese Gleichung ist auch weder mittel Experimenten ermittelt worden (Einstein hat immer nur „Gedankenexperimente durchgeführt“, oder anders gesagt: vor sich hin spintisiert) und noch dazu ist sie schlicht nicht überprüfbar.
Nicht nur, dass der Term m praktisch nicht erfassbar ist, da die in Frage kommenden Massen minimal klein sind, aber dann wird diese minimal kleine Masse, so irgendwie einigermaßen genau ermittelt, mit einem Irrsinsfaktor von
300.000.000 x 300.000.000 m²/s² multipliziert, also mit
90.000.000.000.000.000 m²/s² !
Nehmen wir mal eine Masse von 0,1 Gramm (bei Atombomben wird auch der heute gültigen Theorie nach nur ein kleinster Teil der eingesetzten Masse in Energie umgewandelt), so ergäbe sich also eine frei werdende Energie für die Umwandlung von 0,1 Gramm Masse von
9.000.000.000.000.000 kg*m²/s² bzw. J (Joule).
So und nun will zur Besätigung der Formel nicht nur die verschwundene Masse sondern auch noch diese irrsinnig große frei werdenden Energie (insgesamt, als Summe all seiner dabei auftretenden Erscheinungsformen wie die kinetische Energie fortfliegender Teilchen, Wärme, Deformation, Strahlung, ….) EXAKT gemessen werden. VÖLLIG UNMÖGLICH! (bei der erforderlichen Genauigkeit um die Formel zu überprüfen)
Aus chemischen Reaktionen frei werdende Energie stammt bekanntlich aus den Atom-Bindungen. Logisch also, dass aus atomaren Reaktionen frei werdende Energie aus den Kern-Bindungen stammt. Und nicht aus verschwindender Masse!
Warum hält sich so eine Unsinnstheorie, ja, wird diese Formel auch noch geradezu zur Ikonographie unserer heutigen „follow-the-science“-Gesellschaft? Und ein Clown (wer kennt nicht die Zunge Einsteins?) zum Superstar der Wissenschaften?
Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie die Äthertheorie erst abgeschafft – und dann in neuem Gewandt wieder auferstehen lassen (was er selbst zerknirscht zugab) und mit seinem E=mc² hat er die mittelalterliche Phlogiston-Theorie wieder aus der Mottenkiste geholt die ursprünglich daraus entstand, dass man die Masse der bei der Verbrennung entstehenden Gase noch nicht kannte bzw. nicht messen konnte und daher eine Umwandlung (der verbrennende Stoff wird scheinbar leichter) von Masse in Wärme(-Energie) annahm.
Leider ist es so, dass der in den letzten über hundert Jahren angehäufte Schwachsinn (in allen möglichen Wissensbereichen, von der Mathemartik mit unendlichen Mengen – bis hin zu Freudscher Unsinn wie angeblicher Penisneid bei Frauen, …) kaum noch aufarbeitbar ist und es daher hunderte von Jahren brauchen wird, bis die Menschheit wieder Wissensfortschritte machen kann. Naja, vielleicht sind die Chinesen freier im Denken und daher schon weiter …
Immerhin machen sie zB den Klimazauber nur deshalb mit, weil sie damit gute Geschäfte machen können – wie unsere Finanzaristokratie (WEF, …) auch. Warum sollten die Chinesen es sich auch entgehen lassen, aus unserer Blödheit Profit zu schlagen?
Nicht potentielle sondern kinetische Energie ist E=½mv²
0,1 Gramm Materie hat ein Energieäquivalent nach E=mc^2 von
E=10^⁻4*(3*10^8)^2 Joule = 9*10^12 Joule ~= 10^13 Joule.
Eine Atombombenexplosion setzt eine Energie von ~100 kT frei.
1 kT = 1.000 Tonnen TNT = 4,184 * 10^12 J = 4,184 TJoule.
E(100kT)~= 5*10^14 Joule, also 50*10^13 Joule.
Also werden bei einer Atombombenexplosion 5 Gramm Materie in Energie umgewandelt, eine glänzende Bestätigung der Einsteingleichung E=mc^2.
Ja klar. Und Du hast das genau nachgemessen.
Spintisier weiter. Da bist Du ja in bester Gesellschaft.
Die ikonenhafte Gleichung, die auf Hauswänden, T-Shirts und in Kinderbüchern zu lesen ist und quasi als modernes Glaubensbekenntnis anzusehen ist, wurde noch nie direkt experimentell bestätigt – weil es einfach nicht möglich ist.
Der Einsprecher beweist genau das zirkuläre Denken, der auf so einem Mist wächst, wachsen muss:
Es wurde soundsoviel Energie freigesetzt (angeblich, keiner konnte das messen), also wurde so und so viel Materie zerstrahlt (angeblich, keiner konnte das messen). Aber das macht ja nichts wenn man nur im Glaube stark genug ist ….
;-(
Die Einsteingleichung E=mc^2 in Frage zu stellen, ist lächerlich. Natürlich wurde sie im physikalischen Experiment vielfach bestätigt. Ich hab auch keine Lust, das weiter zu diskutieren.
NATÜRLICH!
Was man von Kindheit an vorgebetet bekommt wird natürlich nicht hinterfragt. Auch nicht von „Experimentatoren“, denn die wollen nicht ihre Reputation zerstören – oder gar die Reputation ihrer „Kirche“, der Wissenschaftskirche.
Also nochmal:
Wie soll diese Gleichung denn „in physikalischen Experiment vielfach bestätigt“ worden sein?
a) Die zerstrahlte Masse wäre winzig im Verhältnis zur energetischen Folge.
b) Die erzeugte Energie wäre gewaltig bei nennenswerter Masse-Zerstrahlung
Die Aufgabe lautet also, eine minimale Masse EXAKT zu messen in Verbindung mit einer gewaltigen Energieausstoß der gleichzeitig EXAKT zu messen ist. Diese Aufgabe ist auf direktem Weg unlösbar. Und auf indirektem Weg das zu machen, führt zu unzähligen Fehlerquellen und möglichen Fehlinterpretationen.
Nochmal. das ist die alte Phlogiston-Theorie in neuem Gewandt: Masse wird angeblich zu Energie (/Wärme) gewandelt.
Die einfachste und naheliegenste Lösung lautet aber: die freigesetzte Energie bei Kernprozessen stammt aus den Kernbindungen, wie die freigesetzte Energie bei chemischen Reaktionen aus den Atombindungen stammen.
Wie damals zur Zeit der Phlogiston-Theorie sind wir einfach (noch) nicht in der Lage, das Verschwinden von Masse in vollem Umfang zu erfassen und zu erklären – obwohl bei Kernprozessen mannigfaltige massebehaftetet Teilchen entstehen und entschwinden können.
Die heutige Physik ist kurz- und mittelfristig unheilbar falsch weil die angeblichen Gewissheiten nicht mehr hinterfragt werden. Kein Wunder, dass es in der Physik keinen Wissenszuwachs mehr gibt. Die Wissenschaft stirbt ab weil man meint, die Reputation der Wissenschaft würde leiden wenn man Fehler und Unwissenheit zugeben würde. Wo man ja so tut (Leute wie ein Lesch, wie eine Mai Thi) wie wenn fast alles gewusst sei, nur noch winzige, unwichtige Puzzleteilchen für das schon vollständig erkennbare Gesamtbild fehlen würden, da ist kein weiterer Erkenntnisgewinn mehr möglich. Vielmehr weicht man in immer irrere Sphären aus, arbeitet sich an Theoriegebilden wie elfdimensionale Stringtheorie und ähnlicher Unsinn ab – ohne daraus irgend einen Erkenntnisgewinn erzielen zu können – weil es Sackgasse und realitätsferne Hirnwichserei ist, sonst nichts.
Es ist das unsägliche „follow the science“, der Anspruch, Wissenschaft würde letztgültige Wahrheiten liefern – als Ersatz für die verloren gegangen Gewissheit der Religionen – das Wissenschaft mehr und mehr zur Farce macht.
Machen wir hier weiter:
Es gäbe prinzipiell zwei Wege das E=mc² direkt experimentell zu prüfen:
a) durch ein kurzzeitiges Experiment
b) durch ein kumulativ angesetztes Experiment
Das a) scheitert eindeutig daran, dass es völlig unmöglich ist, gleichzeitig beides, eine sehr kleine Masse verbunden mit dem ebenso zu messenden, ungeheuren Effekt experimentell mit der notwendigen Genauigkeit zu bestimmen. Wer wollte mit so einem Experiment entscheiden ob E=mc², oder vielleicht E=0,8mc² stimmt? Es ist eine der Seuchen der modernen „Wissenschaft“ (auf die Sabine Hossenfelder mit ihrem Buch „Lost in Math“ hinwies) dass man nur noch „ästhetische“ Formeln als korrekt ansehen will. Aber die Natur IST NICHT SO! Symmetrie oder Ästhetik (wie in einfachen Formeln, ohne schräge Faktoren, etc.) sind keine „gottgegebene“ Naturtatsachen sondern einzig einem menschlichen Bedürfnis geschuldet. Und damit eine illusionäre Täuschung.
Das b) wäre ein eher gangbarer Weg. Man müsste den Massenverlust sowie die Energie-Erzeugung über längere Zeit kumuliert messen, so dass die momentane Energieerzeugung beherrschbar und die zu messende, für die Genauigkeit ausreichend große Masse, erst über die Zeit zusammenkäme. Aber hier lauern unzählige Fallstricke: 1.) entsteht idR nicht nur eine Energieform. Neben der Wärmetönung müssten auch alle anderen möglichen Strahlungen erfasst werden, und die Energien der das Experiment verlassenden Masse behafteten Teilchen müssten erfasst werden. Letzteres ist auch für 2.) die Bestimmung des Massenverlustes ein großes Problem. Denn diese abgestrahlten Massen verschwinden ja nicht um zu Energie zu werden, sondern sie verschwinden weil sie aus der Probe und aus dem Experiment austreten! Und diese Problem ist bis heute unlösbar, ua da immer noch darum gestritten wird ob und wie viel Masse bestimmte Elementarteilchen (zB Neutrino) besitzen. Wie will man angesichts dieses Unwissens die rein in Energie umgewandelte Masse bestimmen und wissen?
Damit ergibt sich das gleiche Problem wie zur Zeit der Phlogiston-Theorie: die Annahme, Masse würde verschwinden, beruht auf der Unkenntnis von Massen, die flüchtig sind, und die wir mit unserem heutigen Wissen noch nicht erkennen bzw. bestimmen können.
Wir haben hier den gleichen Trick wie auch die Weltberühmtheit Einsteins überhaupt erst begründet wurde: die Messung der Sonnenfinsternis 1919 von Eddington WAR GAR NICHT GENAU GENUG um Einsteins Vorhersage zu verifizieren! Egal ob später seine Vorhersage bestätigt wurde – zu der Zeit, als der Siegeszug Einsteins durch die Presse der ganzen Welt begann, beruhte das auf einer Lüge!: Eddington hatte Einstein NICHT WISSENSCHAFTLICH BESTÄTIGT, sondern vielmehr seine Vorurteile: das Einstein recht haben müsse.
Einsteins Weltberühmtheit begann mit einer Lüge – und diese Lüge wurde immer weiter ausgebaut und verfestigt, so dass heute ein regelrecht übermenschliches Bild von Einstein existiert, das in absolut sakrosankt macht. Ein Heiliger der Wissenschaftskirche.
Man schaue sich nur an, was man für Emotionen auslöst, wenn man Einstein als Mensch (sehr unsympathisch, man denke an seine Frauen und seine Kinder, und an seine Freunde, etwa der „Vater des Gaskriegs“, Fritz Haber) und Einsteins „Erkenntnisse“ in Frage stellt.
Einstein steht heute auf einem Piedestal wie es keinem Menschen gebührt, der nämlich wie jeder andere der Kritik ausgesetzt gehört. Monarchie und Idolanbetungen sind der heutigen Zeit nicht gemäß. Aber keiner will etwas merken. Es sei ja da etwas ganz anderes. Hah!
Zur Kenntnisnahme und Selbstanalyse
Die Herleitung der Masse-Energie-Äquivalenz ist unter formalanalytischen Gesichtspunkten weit weniger „eindeutig geklärt“, als es die Spezielle Relativitätstheorie (SRT) suggeriert. Ohne das Gedankenexperiment Einsteins und den Rechenweg an dieser Stelle explizit auszuführen, folgt gemäß Albert Einstein respektive gemäß SRT, E = mc² aus einer „klassischen Grenzfall“ – Approximation mittels Taylorreihenentwicklung. Streng genommen ist diese Herleitung – salopp formuliert – nicht „zwingend“, da hier ergebnisorientiert die gewünschte Lösung die Näherung (mit-)bestimmt.
Was (auch) jeder wissen könnte aber viele ungern wahrhaben wollen…
Die Berechnung von Grundzustandsenergien ist weder quantenmechanisch noch quantenelektrodynamisch begründet. Da ein signifikant maßgebender Anteil von dem Verhältnis der wechselwirkenden Massen bestimmt wird. Es gibt weder QM und schon gar nicht QED basierend die Möglichkeit die reduzierte Masse mred = mA / (1 + mA/mB) quantenfeld-phänomenologisch einzuführen. Die reduzierte Masse ist – ob man es wahr haben will oder nicht – im Rahmen der Standardphysik historisch aus der „Newtonschen Himmelsmechanik“ abgeleitet. Das bedeutet im Klartext, dass im Sinne atomarer Wechselwirkungen, diese weder QM noch QED begründet sind. QM und QED sind „epizyklisch“. Übrigens: Auch das Gleichsetzen einer elektrischen Zentripetalkraft mit einer masse-abhängigen Zentrifugalkraft ist zwar mathematisch kein Problem, aber im Rahmen der hiesigen Physik phänomenologisch unbegründet und erinnert an die Epizykeltheorie. Unabhängig von den Massen der Ladungsträger „erleiden“ zwei betragsmäßig gleiche Ladungen keine Massen-Verschiebung, da die gravitative Wechselwirkung (exemplarisch Proton-Elektron) um ~ 40 Zehnerpotenzen kleiner ist. Das verwendete suggestive Modell ist offensichtlich phänomenologisch unbegründet. Denn die Frage, wie wechselwirkt eine Masse mit einer Ladung bleibt unbeantwortet.
Des Weiteren
Interessanterweise war es Albert Einstein (1879 – 1955), der die Quantenmechanik „schon früh“ – nachvollziehbar argumentativ begründet – als unbrauchbar identifizierte: …“die ψ-Funktion ist als Beschreibung nicht eines Einzelsystems, sondern einer Systemgemeinschaft aufzufassen. Roh ausgesprochen lautet dies Ergebnis: Im Rahmen der statistischen Interpretation gibt es keine vollständige Beschreibung des Einzelsystems. Vorsichtig kann man so sagen: Der Versuch, die quantentheoretische Beschreibung der individuellen Systeme aufzufassen, führt zu unnatürlichen theoretischen Interpretationen, die sofort unnötig werden, wenn man die Auffassung akzeptiert, daß die Beschreibung sich auf die Systemgesamtheit und nicht auf das Einzelsystem bezieht. Es wird dann der ganze Eiertanz zur Vermeidung des ‘Physikalisch-Realen’ überflüssig. Es gibt jedoch einen einfachen physiologischen Grund dafür, warum diese naheliegende Interpretation vermieden wird. Wenn nämlich die statistische Quantentheorie das Einzelsystem (und seinen zeitlichen Ablauf) nicht vollständig zu beschreiben vorgibt, dann erscheint es unvermeidlich, anderweitig nach einer vollständigen Beschreibung des Einzelsystems zu suchen, dabei wäre von vornherein klar, daß die Elemente einer solchen Beschreibung innerhalb des Begriffsschemas der statistischen Quantentheorie nicht enthalten wäre. Damit würde man zugeben, daß dieses Schema im Prinzip nicht als Basis der theoretischen Physik dienen könne. Die statistische Theorie würde – im Fall des Gelingens solcher Bemühungen – im Rahmen der zukünftigen Physik eine einigermaßen analoge Stellung einnehmen wie die statistische Mechanik im Rahmen der klassischen Mechanik.“… A. Einstein, Qut of my later years. Phil Lib. New York 1950 Seite 498
Einsteins unschlagbare Argumente wurden und werden bis heute „schlicht“ ignoriert. Einsteins kritische Äußerungen, insbesondere zur Quantenmechanik, führten letztendlich zu seiner Isolation. Er war zwar später ein „Medienstar“ aber wissenschaftlich ohne weitere Bedeutung.
Claes Johnson (Professor für Angewandte Mathematik) beschreibt das in seinem Buch »Dr Faustus of Modern Physics« u.a. wie folgt,
„Einstein: Die Ikone der modernen Physik…
Die Beziehung zwischen der modernen Physik und Albert Einstein kann wie folgt zusammengefasst werden: Einstein initiierte die Entwicklung der modernen Physik als (inkompatible) Kombination von Quantenmechanik und Relativitätstheorie, als Patentangestellter im Alter von 25 Jahren. Die Physik-Community nutzte Einstein als Ikone der modernen Physik und beurteilte ihn im Alter von 45 Jahren senil zu sein und nicht verstehen zu können, welche Aladdin-Lampe er berührt hatte. Dies ist eine klassische griechische Tragödie, deren Erfolg untrennbar mit dem Scheitern verbunden ist und deren Scheitern letztendlich das Spiel ausmacht. Es ist eine wahre Geschichte über einen Doktor Faustus, der seine junge Seele an Luzifer den Teufel verkauft, um Zugang zur Magie der Wissenschaft zu erhalten, und den Preis dafür zahlt, der Hölle bereits auf dieser Welt gegenüberzutreten, wenn die Wissenschaft, die er am meisten schätzt im Leben von ihm genommen wurde.“
Simpel, sich über @Ratzefatz „Bildungsferne“ und vorsätzliche Ignoranz im Rant über E=mc² lustig zumachen, zum Beispiel anhand dieses Wiki-Eintrages:
https://de.wikipedia.org/wiki/Massendefekt
Aber das taugt nichts!
Die „Bildungsferne“ von Ratzefatz ist erstens ein Produkt bürgerlicher Schulbildung und repräsentiert zweitens eine von vielen verschiedenen Gestalten der Überformung von Bildungsinhalten durch „common sense“, den Geist des Bürgertums, und dafür steht auch der Einwand von @captain Sharky.
Dies wenigstens teilweise aufzuzeigen, mache ich mich jetzt anheischig.
Das ontologische Mißverständnis physikalischer Formeln
Ratzefatz hat nicht begriffen, daß E=mc² keine Aussage über das „Sein“ im Sinne von „Identität“ sein soll, sondern eine Proportion ausdrückt, sodaß der Term c², eine Konstante, in der Gleichungsaussage zunächst entfallen kann:
E/m =const.
Darstellungstechnisch kann der Ausdruck „const.“ durch eine „1“ ersetzt werden, vorausgesetzt, man schafft eine Einheit für „Masse“, die der Einheit für „Energie“ äquivalent ist, und eben dies soll die Konstante c² leisten.
Wenn ich die Proportion E/m umgangssprachlich übersetze lautet sie:
Alles, was als „Masse“ in Erscheinung tritt, ist als Energieäquivalent auszudrücken, und alles, was, als Form resp. Quelle von Energie auftritt, ist in ein Massenäquivalent zu überführen.
Was war Einsteins Argument für diese Lehre?
Zunächst mal liegt @Ratzefatz vollkommen richtig, indem er unterstellt, die Bestimmung von E(kin)=1/2mv² habe für die Formel E=mc² Pate gestanden!
Denn auch diese Formel ist eine Proportion, die eine Äquivalenz von Masse und Energie ausdrückt. Halte ich eine Geschwindigkeit eines Massepunktes v fest, hängt der Impuls p=mv, den dieser Massenpunkt einem anderen, ruhenden Massepunkt zu verleihen vermag, und damit seine Energie, von der numerischen Größe der Masse ab, Punkt.
Die potentielle Energie ist eine Variante der kinetischen Energie unter der Bedingung eines Schwerefeldes.
D.h. die Basis der mechanischen Äquivalenz von Masse und Energie ist die alte newtonsche Formel Arbeit ist = Kraft mal Weg. Das war tatsächlich eine Identitätsaussage des Inhalts: Alle meßbare mechanische Energie ist eine Massenwirkung.
Freilich ist die mechanische Energie nur eine der bekannten Gestalten oder Formen von „Energie“. Es gibt zusätzlich Bindungsenergien in Atomen und Molekülen, und es gibt elektromagnetische Strahlungs- und Feldenergien, die aus der mechanischen Energie / Masse – Äquivalenz herausfallen – oder vielmehr, zu Einsteins Zeiten heraus zu fallen schienen.
Doch die mechanische Identität von Masse und Energie ist im späten 19. Jhd. durch Forschungen von Heinrich Hertz und anderen nichtig geworden, denn sie entdeckten, daß Elektronen Masse haben (Kathodenstrahlung) und dennoch Photonen, die keine Masse haben, Arbeit an Elektronen verrichten können (-> photoelektrischer Effekt). Und wieder schien es eine Proportion zu geben: Je mehr Strahlungsenergie wirksam war, desto mehr Arbeit leisteten sie an Elektronenmassen. (Das erscheint im Experiment a weng komplizierter, aber im Resultat kommt es darauf hinaus)
Folglich hatte Einstein, hatten die Physiker keinen Grund, die Annahme zurück zu weisen, daß diese Proportion über das gesamte Spektrum elektomagnetischer Strahlung einschließlich Wärmestrahlung gelten würde.
Doch das heißt LOGISCH, die ->Prozessgröße (bitte nachsehen) E(kin) sei in eine -> Zustandsgröße zu überführen, also die mechanische Energie-Masse – Äquivalenz zu verallgemeinern.
Und diese Verallgemeinerung leistet das c², weil c die höchstmögliche Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Strahlung und damit Kennzahl ihres größtmöglichen massenwirksamen Impulses ist.
Warum „c²“? Na, weil, wie schon in der Formel für kinetische Energie, die impulswirksame Energie einer Masse als Produkt ihrer Beschleunigung aufgefaßt ist, denn die Impulswirkung ist das Produkt einer beschleunigten Masse.
Und warum entfällt in Einsteins Formel der Teiler 2, also das „1/2 mal“?
Weil bei der kinetischen Energie die Beschleunigungszeit der Masse, ausgedrückt in der zu einem Zeitpunkt t zurück gelegten Strecke, „1/2 at“, entfällt, weil es sich um die größtmögliche Geschwindigkeit handelt, die keine Prozessgröße mehr repräsentiert, sondern eine Zustandsgröße.
Die Komplikationen des Themas durch und in der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie habe ich jetzt entfallen lassen, sie spielen unterhalb „relativistischer“ Zustände offenkundig keine experimentelle Rolle.
Und natürlich war Einsteins Formel zur Zeit ihrer Aufstellung eine Hypothese, weil die Massenwirksamkeit atomarer und molekularer Bindungsenergien nicht aufgeklärt waren. Das ist dann experimentell nachgeholt worden, und die Resultate haben die allgemeine Zustandsformel Einsteins bestätigt.
Und insgesamt habe ich mit meinem Posting hoffentlich so eine Art schematischer Blaupause geliefert, wie Physikunterricht gestaltet sein müßte, wenn er tatsächlich Wissen vermitteln soll, und nicht bloß Verfahrensregeln im Umgang mit unverstandenen Algorithmen.
Bitte, danke, hab was bei der Abfassung des Postings gelernt.
Das Blabla schreibt man kurz
x~y (ein x ist proportional zu einem y, oder auch x~1/y bei umgekehrter Proportionalität)
und diese Feststellung ist der erste Schritt, um eine entsprechende Formel zu gewinnen. Dass ist trivial und daher alles Qana-Blabla auch. Das sich hier als Gelehrtes ausgibt, in Wahrheit aber nur Wikiblödia-Dunst verbreitet.
Einem E~m müsste nämlich erst einmal einen Sinn zugeschrieben und dann BEWIESEN WERDEN. Und dazu benötigt man Messungen AN DER NATUR. Und genau da fehlt es, seit mit Plank und Einstein, etc., aus der Naturwissenschaft Physik die Laber-, Rechen-, Modellier- und Spintisierwissenschaft geworden ist, die sich heute immer noch anmaßend Naturwissenschaft nennt.
Aber was soll’s. Hier treten natürlich die Verteidiger des modernen, szientistischen Weltbildes auf. Und die sind genauso verbohrt wie zahlreich und blind. Und hängen von diesem modernen Glaubenssystem oft genug ökonomisch ab. Wie ein Kleriker früher schon alleine aus ökonomischem Eigeninteresse den Glauben verteidigen musste, müssen heute Wissenschaftler den modernen Absolutheits- und Wahrheitsanspruch der Wissenschaften schon aus eigenen, rein ökonomischen Gründen verteidigen.
„Warum „c²“? Na, weil, wie schon in der Formel für kinetische Energie, die impulswirksame Energie einer Masse als Produkt ihrer Beschleunigung aufgefaßt ist,“
mv² sei ein Produkt aus Masse mal Beschleunigung? v² ist keine Beschleunigung. Sowas in einem Physikunterricht? Hilfe!
Was ich geschrieben hab, ist elementar, richtig, deshalb kann man es sich auch aus den thematischen Wikis zusammen stoppeln. Das kann einer auch „blöd“ nennen, dann sollte er vielleicht sagen können, warum er das tut.
Das hast du gefälscht, es steht nicht da.
Allerdings habe ich mir die Darstellung meines Argumentes vielleicht zu sehr vereinfacht. Das Motiv der Vereinfachung wird wohl deutlich, wenn ich sage:
In der Formel E=mc² repräsentiert das c² eine zentripetale Winkelbeschleunigung mit dem Radius 1.
Ich habe keine Lust, den Grund dafür, und dazu zuerst die Winkelbeschleunigung, zu erklären, weil es hier erstmal nur um das Argument für die Größenordnung c² im Unterschied zu c ging, und das hatte ich genannt. Auch in der Formel für E(kin) kommt das „v²“ durch Zusammenfassung eines längeren Ausdrucks zustande, der einen (gradlinigen) Beschleunigungsvektor enthält. Das kann jeder in der „Wikeblödia“ nachlesen.
Und allgemein: „Beweisen“ kann ein Lebewesen nur Aussagen, resp. Annahmen in Aussageform. Warum? Weil die singuläre Instanz eines Beweises einer Aussage der Verstand dessen ist, der den Beweis unternimmt. Es gibt keinen Gott, und „die Natur“ ist ebenfalls kein Gott oder Stellvertreter oder Instrument desselben. Welche Aussage trifft ein Beweis? Diese:
„Der in Aussage x hergestellte Zusammenhang zwischen den Aussagen y und z ist vollständig und abgeschlossen“.
Solch ein Beweis bleibt, was er sein soll, nämlich schlüssig, wenn die Aussagen y UND (oder) z falsch sind, nämlich kontrafaktisch erfunden und (oder) eine unvollständige Darstellung ihres jeweiligen Gegenstandes. Um taugliche Beweise von untauglichen zu scheiden, fahndet ein Naturwissenschaftler nach Indizien dafür, daß die Aussagebestandteile y UND (oder) z falsch sein könnten oder ihre Gegenstände hinsichtlich der Aussage x verfehlen. Wird er fündig, verändert er entweder den Aussagegehalt x unter Aufrechterhaltung des Beweisverfahrens, oder er verwirft den hergestellten Zusammenhang komplett und fängt mit neuen Aussagen von vorn an.
„Was ich geschrieben hab, ist elementar, richtig,“
Genau die Attitüde des eingebildeten Volksbelehrers, der nie eine Autorität in Frage gestellt hat, alles was ihm vorgebetet wir, glaubt, und sich daher im Besitz der letzgültigen Wahrheiten wähnt.
Ein typischer Vertreter der Wikiblödia-Nomenklatura eben.
„In der Formel E=mc² repräsentiert das c² eine zentripetale Winkelbeschleunigung mit dem Radius 1.“
Soso. Und das ist wahrscheinlich so und „ist elementar, richtig“. Warum? Weil Elementarteilchen Kugelförmig seien, einen Kugelradius besäßen?
Man, man, man. Auf was für einem Außenposten lebst Du bloß dass Du solche Phantastereien nötig hast …
Klar, E,lementarteilchen müssen Kugelförmig sein weil die Kugelform elementar ist – und der Mensch das so will. ;-(
Und Formeln müssen schön sein wie E=mc², weil das einfach hübsch und sauber aussieht- also kann es ja nur so und nur richtig sein ….
;-(
Das „Ockhams Rasiermesser“ wird heute durch das HeidiKlumpsche Schönheitsdiktat für Physik ersetzt.
Dirk Freyling schrieb:
„..Streng genommen ist diese Herleitung – salopp formuliert – nicht „zwingend“, da hier ergebnisorientiert die gewünschte Lösung die Näherung (mit-)bestimmt…“ (Zitatende)
Das ähnelt der (noch brutaleren) Methode, (empirische) bestätigende oder falsifizierende Experimente oder Untersuchungen oder Forschungen zu einer These oder (ausgearbeiteten) Theorie einfach bewusst zu unterlassen und dann im Brustton der (angeblichen) Überzeugung zu verkünden, dass diese These/Theorie zu ignorieren sei, weil es ja keine wissenschaftliche Untersuchungen dazu gäbe. Eine z.B. (!) in der Medizin- oder im Pharmabereich durchaus häufiger anzutreffende Art von „Wissenschaftssimulation“ für das meist ahnungslose Laienpublikum.
Inzwischen schon etwas bekannter ist der Trick, zwar (eher unter dem Radar der Öffentlichkeit) durchgeführte , aber wegen unliebsamer Ergebnisse ökonomisch oder politisch kontraproduktive „Studien“ einfach stillschweigend verschwinden zu lassen.
Ich sehe das Problem nicht.
Mensch macht das den ganzen Tag. Genauer gesagt, das Hirn macht das den ganzen Tag, denn die wichtigste Leistung des Hirns ist das Vergessen: Es filtert aus den stetigen, gigantischen Informationen der Sensorik und Erinnerungen einen Teil heraus, mit dem weiter prozessiert wird, der Rest wird nahezu vollständig weg gehauen. Wäre das nicht so, könnte Mensch sich nicht mal bewegen, wäre in einem Tremor oder einem andauernden epileptischen Zustand gefangen.
Zudem versteht Mensch von den grundlegenden Dingen des Universums nichts, er versteht nicht Gravitation, Kernkraft, Magnetismus, er versteht nicht, wie Chemie zu Biologie wird.
Freilich kann er Wirkungen beobachten und aus den Beobachtungen weitere Wirkungen erzeugen, doch das hat nichts mit Verstehen zu tun. (Begreifen wäre das passendere Wort – kann Mensch überhaupt verstehen, wenn er doch gezwungen ist, sich immer und ausschließlich im Zeitpfeil zu bewegen?)
Er versteht Kreativität oder Inspiration nicht, auch nicht, wie seine „Tagesform“ genau zustande gekommen ist. Und er hat kein Problem damit, das zu »akzeptieren« und damit zu arbeiten.
Was die sogenannte „Gefahr der KI“ angeht: Klar, vieles ist denkbar, weniges davon trifft ein. KI (das „I“ könnte eigentlich durch ein „K“ für Kognition ersetzt werden) hat keine Absicht aus sich selbst, denn eine Absicht ist für eine KI nicht notwendig. Absichten hat der Mensch (weiter: jedes Lebewesen). Er nimmt die Ergebnisse einer KI und schaut, wie damit seine Absichten erreicht werden können. So what’s the news?
Die größte Gefahr ist also weiterhin der Mensch, wenn zukünftig nicht mehr geschaut wird, ob ein KI generiertes Ergebnis plausibel ist (nicht positivistisch), sondern der KI unumwunden geglaubt wird, wenn ihr Output Sakrosankt wird.
Die „Gefahr“ ist des Menschen arrogante und bornierte Selbstüberschätzung, die annimmt, alles verstehen und kontrollieren zu können. Und seine Faulheit, sich frühzeitig oder wenigsten adäquat an Veränderungen anzupassen: „Wieso, läuft doch?!“ Mit der KI bemerkt er mal wieder (wie einst bei FCKWs oder Staudämmen & Flussbegradigungen uvm.), dass er nicht einmal sein eigenes Werk versteht…
War mir klar, daß El-G hier irgendwann aufschlagen würde, um mit seiner elitären Privatreligio alles, was hier gesagt worden ist, summarisch in die Tonne zu treten.
Deshalb bin ich vorbereitet – mit meiner neuen Hymne. Ich liebe Jacky Venson!
I don’t praise your God
I praise the earth and the sky and the moon
I don’t follow time
I follow waves of the ocean of my womb
What I do to you is witchcraft
And it’s up to you resist that
So time after time we had the power
But no chance to shine
Only to be devoured
Waiting patiently
For things to change
Well now change has come
Prepare for the wave
What I do to you is witchcraft
And it’s up to you resist that
What I do to you is witchcraft
And it’s up to you
https://youtu.be/2tkuuhlyKsE?si=YELjQ68SgLBUuRZu&t=57
Wow, Sweetheart, hast Du mir aufgelauert? Ich bin geschmeichelt :-))
Ich würde meinen Beitrag als „ergänzend“ bezeichnen, und mal wieder NICHT als „Bleib locker Mann“ ;-))
Sind doch einige – für mich – sehr gute Kommentare hier und ich habe mich auch an den Artikel gewandt und vor allem an den verlinkten Artikel, welcher der Anlass war.
Cooler Song,
Danke!
Als freundlicher Return:
Golden God
Da findet man sie wieder, die sich selbst Liebenden in iher Bestätigungsblase.
Mein Gott, wie peinlich. In aller Öffentlichkeit …
Ich finde eher Ihre Auftritte peinlich. Sie müssen ein sehr einsamer Mensch sein…
Ja, die Zahl meiner Internet-Bekanntschaften hält sich tatsächlich in Grenzen ….
Peinlich, peinlich.
@ratze
Das ist Tischtennis, Stalker, und wenn er Rundlauf will, braucht’s ein wenig mehr als einen abgelutschten MINT-Drops und verschämtes Taschenbillard. Vermutlich ergibt bei ihm die Anwendung des Impulserhaltungssatzes NULL?
Also doch pure Hassigkeit. (Die eines „abgewiesenen Liebhabers“? wurscht)
»Qana« schreibt …“daß E=mc² keine Aussage über das „Sein“ im Sinne von „Identität“ sein soll, sondern eine Proportion ausdrückt, so daß der Term c², eine Konstante, in der Gleichungsaussage zunächst entfallen kann: E/m =const.
Darstellungstechnisch kann der Ausdruck „const.“ durch eine „1“ ersetzt werden, vorausgesetzt, man schafft eine Einheit für „Masse“, die der Einheit für „Energie“ äquivalent ist, und eben dies soll die Konstante c² leisten.
Wenn ich die Proportion E/m umgangssprachlich übersetze lautet sie: Alles, was als „Masse“ in Erscheinung tritt, ist als Energieäquivalent auszudrücken, und alles, was, als Form resp. Quelle von Energie auftritt, ist in ein Massenäquivalent zu überführen.“…
Das entspricht dem antrainierten Denken, ist jedoch unvollständig und energetisch, durch alle diesbezüglich möglichen Versuche experimentell nachprüfbar, falsch.
Denn die Annahme, dass E/m = const. = c² ist, setzt implizit, inhärent voraus, dass der Raum in dem sich die Physik abspielen soll, energetisch keine Bedeutung hat. Die gesamte, theoretische Denkmodellphysik basiert seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf dieser (fatal, falschen) Annahme.
Dass dem Raum keine Energie denkmodelltheoretisch zugestanden wurde und nach wie vor nicht zugestanden wird, erinnert an Theodor Fontanes Ausspruch:…“das Sensationelle gilt und nur einem strömt die Menge noch begeisterter zu, dem baren Unsinn.“
Es gab zwar frühe Kritiker, doch die wurden später schlicht ignoriert…
Schon Isaac Newton (1642 – 1727) hielt die Vorstellung, dass Gravitation durch den leeren Raum wirken könne, (berechtigterweise) für absurd. Es ist – übergeordnet und insgesamt betrachtet – alles andere als trivial, Raum und Zeit als physikalische „Gegenstände“ zu betrachten. Raum und Zeit sind primär „Ordnungsmuster des Verstandes“. Um aus diesen Ordnungsmustern Physik zu „erhalten“, bedarf es zwingend einer phänomenologischen Betrachtung und Erklärung.
Bevor Mißverständnisse aufkommen…
Es geht übergeordnet nicht um die sinnlose Frage, was (physikalische) Wahrheit ist, denn ein Denkmodell ist eben nur ein Denkmodell. Es geht aber sehr wohl um die ehrliche Frage, inwieweit ein gegenwärtiges Modell, beispielsweise zur Materiebildung, minimalistisch ist und zugleich eindeutige formalisierte Lösungen liefert, die sich als Meßwerte experimentell bestätigen lassen.
Alternativer Theorieansatz
Masse und Raum sind inhärent wechselwirkend Energieformen
Wird Energieerhaltung auf Masse und Raum bezogen, entsteht eine Masse-Raum-gekoppelte Gleichungskonstanz, die sich experimentell ausnahmslos bestätigen lässt. Um das zu verstehen bedarf es keiner komplizierten Mathematik. Ohne hier im Kommentarfeld auf die Theorie-Geschichte einzugehen und ohne die Motivation zur phänomenologischen Grundstruktur anzugeben (da dies das Kommentarfeld „quantitativ sprengt“), folgt hier nur ein interdisziplinär verständlicher Ansatz:
In einem einfachen Bild wird als Ausgangspunkt die sinusförmige Entstehung einer Kugel konstruiert, daraus folgen die so genannten Elementarkörper-Entwicklungsgleichungen und aus diesen folgt eine Masse-Radius-Konstanz-Gleichung.
Konkretes dazu siehe exemplarisch: Denkmodellgeschichte – ein überfälliges Rendezvous mit ursächlicher Rationalität:
http://www.kinkynature.com/ektheorie/denkmodellanatomien.htm#rvont
Mit dieser Annahme kann man mit einfacher Mathematik (Addition/Subtraktion, Multiplikation/Division, einfacher Integral-und Differential-Rechnung), phänomenologisch begründet, das gesamte Messwertspektrum, erfassen. Daraus folgen, phänomenologisch nachvollziehbar begründet, einfachste, genaue Berechnungen, exemplarisch der Feinstrukturkonstanten, des Protonenradius, der Neutronenmasse, Grundzustandsenergien, 3-K-Hintergrundstrahlung, Masse und Radius des Universums, bis hin zu (anomalen) magnetischen Momenten*,…
*Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die experimentellen Ergebnisse, sofern man diese ohne theoriebeladene Erwartungen in Richtung postulierter „leptonischer „Strukturlosigkeit“ bzw. quarks-basierender Substruktur betrachtet, eine leicht feststellbare Gemeinsamkeit stets aufwiesen/aufweisen. Die zusätzlichen (vermeintlich anomalen) magnetische Moment-Beiträge zu den semiklassisch zu erwartenden sind sowohl für Proton, Neutron als auch für das Elektron stets ~ 1·10-26 Joule/Tesla. Aus rational logischen Gründen ergab/ergibt sich (system-)analytisch die Frage, ob diese Beiträge eine gemeinsame Ursache haben. Die Annahme, dass diese Beiträge zum magnetischen Moment der materiebildenden primären Ladungsträger in einem äusseren Magnetfeld messungsinhärent aus dem Feld kommen und nicht intrinsisch sind, wird zahlenanalytisch, naturphilosophisch als auch formal untersucht und bestätigt, siehe http://www.kinkynature.com/ektheorie/AnomalesMagnetischesMoment.htm
Exemplarisch ein interdisziplinär (leicht(er)) verständliches Resultat im Bild der Masse-Raum Kopplung…
Kosmos & Gravitation
Einfach formuliert, lässt sich das (jetzige) Universum (der Kosmos) anschaulich im Rahmen der Masse-Raum Kopplung, in formaler Analogie zum Elementarkörper des Mikrokosmos, ohne erst einmal auf die „makroskopischen Feinheiten“ einzugehen, als gigantischer, noch in der Entwicklungsphase, „kurz“ vor Ende der Expansion, befindlicher Elementarkörper betrachten und formal analytisch einfachst erfassen und berechnen. Jedoch im Vergleich respektive konträr zum Urknall-Standardmodell der Kosmologie u.a. ohne freie Parameter, ohne überlichtschnelle Inflationsphase und ohne rein mathematisch konstruierte Raumzeitkonstrukte.
Ergebnis der skalenübergreifenden Masse-Raum-Kopplung
Die im „bekannten“ Newtonschen Gravitationsgesetz verwendete Gravitationskonstante γG bezieht sich auf den (denkbar) „längen-kleinsten“, „massereichsten“ [Elementar-]Körper G {Elementarquant} (dieser entspricht im historischen Zusammenhang respektive historischen Vergleich (energetisch) zwei Plancklängen und inhärent damit assoziiert 2 Planck-Massen, was auch explizit formal gezeigt wird). Dieser Sachverhalt ist nicht offensichtlich, da das „üblich formulierte“ Gravitationsgesetz diesen ursprünglichen Zusammenhang nicht explizit offenbart.
Randnotizen
(Bereits) Ernst Mach (1838 – 1916) bemerkte, dass die „Schwäche“ der Gravitation mit der „enormen“ Größe des Universums in Zusammenhang steht. Er vermutete eine Relation zwischen Universums-Masse, Universums-Radius und Gravitationskonstante. Sir Arthur Stanley Eddington (1882 – 1944) erhielt das Verhältnis von Universums-Radius zu Universums-Masse indem er die Gravitationskonstante durch c² dividierte (…formal-gleich im Rahmen der hier beschriebenen Korrespondenz zwischen »Längen-Kleinstem« und »Längen-Größtem«). Und auch Erwin Schrödinger hatte dies als Möglichkeit bereits 1925 geäußert. Warum sich diese einfache Annahme nicht durchsetzte hat höchstwahrscheinlich mit der (später) favorisierten (inflationären) Urknalltheorie zu tun. Dort war/ist kein Platz für »(korrespondierend) Einfaches«.
Makrokosmos
Beobachtungen
Bekannte makroskopische Objekte (…Billardkugel, Fußball, Erde, Sonne,…) genügen nicht der Masse-Radius-Konstantengleichung. Ihre reale Ausdehnung ist (schon vor der Wechselwirkung) um viele Zehnerpotenzen größer, als es diese Gleichung Masse-Radius gekoppelt für Elementarkörper fordert.
Ohne die konkrete Natur der Vielteilchen-Verschachtelung zu kennen, lässt sich allgemein anschaulich verstehen, dass die scheinbar, im Verhältnis zur Ruhe-Energie, fehlende Raum-Energie der Gravitationswechselwirkung, in der realphysikalischen Objekt-Ausdehnung steckt, welche durch den Objektradius bzw. durch den Wechselwirkungs-Abstand r (Wechselwirkungsradius) zum Massenschwerpunkt gegeben ist. Mit dieser experimentell bestätigten Denkmodell-Annahme ist eine an Einfachheit und Aussagekraft nicht zu überbietende Gravitationstheorie im Rahmen der Masse-Raum-Kopplung geboren (worden).
man hat den Äther durch die Raumzeit und die Widersprüche der Theorie in eine ominöse Schwarze Energie/Materie ausgelagert, die sich so langsam als Fehlkonstrukte erweisen. man erklärt die Widersprüche der Inflation einfach mit der überlichtschnellen Ausdehung der Raumzeit, der Heisenbergkompensator unserer Tage. man weiß, dass im Grunde alles Energie und Wechselwirkung denn konkrete, feste Substanz ist, aber worin diese Energie schwingt kann mir NIEMAND anschaulich und intuitiv verständlich erklären.
die Raumzeit entsteht erst DURCH die Wechselwirkungen der Dinge, aber wie soll dann bitte diese Raumzeit sich selbst ausdehnen können ? und dehnt sich dabei die Körnung des Universums mit aus, und wenn nicht: warum ? – das ist doch alles unbefridigend, i-wo in den Modellen über unsere Welt liegt ein fundamentaler Denkfehler.
auch ihren Ausführung kann ich nicht folgen, können sie das vereinfachen und vor allem kompakter präzisieren ?
Kompakter?
… bereits einfache Betriebsanleitungen, Programmanwendungen müssen erst studiert werden, bevor sie verstanden werden können…
siehe hier zur Motivation und zum interdisziplinär verständlichen Ansatz:
http://www.kinkynature.com/ektheorie/denkmodellanatomien.htm
Der „Äther“ kommt auch dadurch wieder ins einsteinsche „Relativitäts-Spiel“, bei dem ohne eine quasi „ruhende Grundmatrix“ es nicht möglich ist, unbeschleunigten Körpern eine absolute Geschwindigkeit zuzuweisen. Aber ohne eine eine absolute Geschwindigkeit ist es unentscheidbar, auf welchem „bewegten“ Körper die Zeit langsamer (oder schneller) abliefe, auf welchem Körper Strecken in Richtung (in welcher?) Bewegung verkürzt bzw. unverändert wären.
Eine Einsteinsche „Ruhelänge“ ist ein völliges Unding wenn man keine „absolute Ruhe“ definieren kann. Was ruht, was bewegt sich (unbeschleunigt)? Unentscheidbar ohne Äther!
Also gibt es ohne Äther keine Zeitdilatation, keine Längenkontraktion.
Schon von Anfang an, schon bei Einstein, wurde immer dazwischen herumlaviert, ob diese Beobachtungsphänomene (denn nichts anderes sind sie) nun auf tatsächlich physikalischen Streckungen bzw. Kontraktionen beruhen würden, oder eben nur auf dem, was sie schließlich nur sein können: Beobachtungsphänomene.
Ähnlich wie etwa die perspektivische, scheinbare Verkleinerung ferner Objekte oder die Änderung der Tonhöhe eines vorbeifahrenden Rettungswagens: Beobachtungsphänomene ohne irgend eine Bewandtnis für das beobachtete Objekt selbst!
In der Relativitätstheorie wird die Beobachtung mit der realen Gegebenheit des Beobachteten verwechselt. Eine gestartete Rakete ist nicht in Flugrichtung verkürzt, die Zeit läuft auf ihr nicht langsamer ab – es scheint einem (dummen) Beobachter höchstens so!
Zitat: „Dass dem Raum keine Energie denkmodelltheoretisch zugestanden wurde und nach wie vor nicht zugestanden wird,…“
Ich will es mal ganz undiplomatisch, aber kurz ausdrücken: Das ist nicht richtig.
Erinnere mich, vor fast 20 Jahren in einem Theoretische-Physik-Kolloqium den Vortrag eines Physikdoktoranden gehört zu haben, der aus Fundamentalkonstanten (Vakuumsuszeptibilität usw.) die Vakuumenergie hergeleitet hatte.
Der Wert war so irrsinnig hoch (will jetzt nicht unken, weil die Erinnerung kein Film ist, aber wohl noch einiges höher als 10hoch60 erg/cubiccm), daß ein Interpretationsversuch bei ihm und den anderen theoretischen Physikern nur verzweifeltes Kopfschütteln erzeugte. Aber lag schon in etwa in der Nähe von Werten, die aus Experimenten mit Vakuumenergie (Casimir-Effekt) gewonnen wurden.
Im Rahmen der etablierten (aber erkenntnistheoretisch nur vorläufigen) Kosmologiemodelle sicher schwierig. Aber der Beginn von Nachdenken über die Erweiterung der jetzigen Modelle zu einer neuen Theorie, und da kommen immer mehr Argumente zusammen. Das Problem ist, daß es im Rahmen der etablierten Fachidiotie (sprich Spezialiserung in einem immer größeren Wissensfeld) kaum noch fachübergreifende Denker gibt, die diese Argumente zusammenführen könnten. Dieser Prozess wird also doch durchaus Jahrzehnte brauchen.
Masse-Radius-Konstanz und Vakuumenergie
Die „gemessene“ Stärke der Vakuumenergie(dichte) stellt eines der größten Probleme der modernen System-Physik dar, da die experimentell gefundenen und die theoretisch vorhergesagten Werte extrem voneinander abweichen. Aufgrund von Beobachtungen wird die Energiedichte des Vakuums auf einen Wert der Größenordnung 10−9 J/m3 geschätzt, dieser Wert ist damit etwa um den Faktor 10hoch120 niedriger als in den theoretischen Berechnungen des Standardmodells. Die von der Standardtheorie vorhergesagte, in unserem Universum aber nicht vorhandene, ungeheuer große Vakuumenergiedichte, „findet“ eine plausible Erklärung in der Masse-Radius-Konstanz (Elementarkörpertheorie). Details und konkrete Berechnungen siehe: http://www.kinkynature.com/ektheorie/Vakuumenergie.htm
„Am Rande bemerkt“
«Neuzeit-Äther»
Es ist noch erwähnenswert, dass der einst verbannte, für nichtexistent erklärte «Äther» schon längst über Begrifflichkeiten des Standardmodells der Kosmologie wie Vakuumfluktuation, Vakuumenergie und eine von Null verschiedene Kosmologische Konstante „reanimiert“ wurde. Wenn es so etwas wie eine Wissenschaftsmoral gibt, dann ist es unmoralisch in Gedenken an Maxwell, Lorentz, Poincare´, Pascal,… nicht in aller Deutlichkeit zu betonen, dass es das «Prinzip Äther» im Rahmen des Kosmologischen Standardmodells (wieder) gibt.
Was man wissen sollte…
Die Raumzeit ist nicht sinnlich erfahrbar und auch nicht apparativ meßbar. Die Raumzeit ist ein rein mathematisches Konstrukt.
Bei allen kosmologischen „Beobachtungsstudien“ handelt es sich nicht um kontrollierbare Laborexperimente. Die menschliche Beobachtungs-Zeitspanne ist verglichen mit den Zeitspannen, in denen sich kosmische Bewegungen abspielten und abspielen, extrem klein. Mit den Angaben aus der menschlichen Beobachtungsdauer Annahmen zu begründen, ist wortwörtlich „weit hergeholt“ um es mal salopp zu formulieren. Alle derzeitigen vermeintlich empirischen Messungen sind stark (Urknall-)theoriebeladen. Postulierte Zeitspannen, Entfernungen und Energiedichten sind subjektiv-theorieabhängig.
Inwieweit die ART oder alternative Theorien jedoch die realphysikalische Wirklichkeit abbilden, „steht auf einem anderen Blatt“. Bedeutet: Bei allen kosmologischen Beobachtungen handelt es sich eben nicht um kontrollierbare Laborexperimente. Sowohl in der Newtonschen Interpretation der Gravitation als auch in den „ART-üblichen“ differentialgeometrischen Betrachtungen wird stark idealisiert. Die wahren energetischen Verhältnisse (lokal und teils in (periodisch dynamischer Überlagerung) lassen sich im wahrsten Sinne der Worte „aus Sicht“ der Erde oder erdnaher Satelliten nicht ermitteln, wobei selbst die von der Erde weit entfernten Satelliten für kosmische Verhältnisse als erdnah zu verstehen sind. Das bedeutet, die Ursachen könnten gänzlich anderer Natur sein. Mit steigender Beobachtungskomplexität, die heutzutage durch iterative Nachbearbeitungen stark theoriebeladen „(nach-)belastet“ ist, können vermeintliche Beobachtungs-Effekte von mathematischen Artefakten der genäherten „Lösungen“ nicht separiert werden. Schlicht formuliert, man sieht das, was man theoretisch sehen möchte.
Kosmologische Konstante Λ und postulierte Inflation
Die Kosmologische Konstante Λ, die Albert Einstein im Glauben an ein statisches Universum einführte, welche dann im Zuge der „frühen Ideen“ des expandierenden Universums abgeschafft wurde, kam zurück, da Λ theoretisch wieder gebraucht wurde. Doch die Kosmologische Konstante bedeutet schlicht und ergreifend, dass auch im Verständnis der Urknall-Theoretiker, dass „Vakuum“ eine Energiedichte besitzt. Vakuum ist hier eine weitere Wortspielerei für vermeintlich leeren Raum. Das Anheften von Λ an die Theorie führt aber unweigerlich zu »Materie im Raum«. Das Ergebnis ist leicht zu verstehen. Lassen wir mal außen vor, dass wir hier schon wenig kleinlich, das Attribut einer lichtschnellen Ausbreitung nicht thematisieren wollen. Der Raum expandiert postuliert mit Materie (nahezu lichtschnell) bis zum Beginn der gleichfalls postulierten überlichtschnellen Inflation, dann expandiert der Raum ohne Materie bis zum Ende der Inflation, um dann wieder mit Materie brav im Rahmen der Relativitätstheorie zu expandieren.
Fantastischer und willkürlicher geht es in bekannten Sciencefiction-Filmen, wie Starwars, auch nicht zu. Der Unterschied: Es handelt sich um Theoretische Physiker, die nach dem Pippi Langstrumpf-Prinzip die Welt so machen, wie es ihnen gefällt. Warum? Weil sonst sprich ohne ultrakurze, überlichtschnelle Inflationsphase, für die es übrigens im Rahmen der Inflationstheorie keine phänomenologische Begründung gibt, die selbstdefinierte Theorie sich, aus dann nicht erklärbaren Beobachtungsinterpretationen und – wenn man so will – assoziiert axiomatisch, selbst widerlegt. Was man, insbesondere als Laie, nicht erwarten würde und auch als Laie höchst wahrscheinlich als unseriös bewerten würde, sofern man es denn verstehen könnte.
Was wir heute noch nicht verstehen, muss nicht für immer unverständlich sein. Es werden neue umfassendere Theorien kommen. Bin schon gespannt.🤩
Für die Inflationsphase des Universums gibt es durchaus logische Erklärungen.. Die gefallen mir sehr… das gehört aber nicht hierher.
Abschließend, und bei Gelegenheit meines letzten Postings
https://overton-magazin.de/top-story/zwischen-leerstelle-und-logik/#comment-319213
will ich angesagt haben, warum ich manchmal Musike verlinke, die iwie ein Argument sein sollen, aber keiner weiß, wie und warum.
Warum liebe ich die Version von „Witchcraft“, Jacky Venson, die ich oben verlinkt hab?
Weil ich sie damit für „gut“ abseits von (Geschmacks-)vorlieben des Rezipienten erkläre.
Was soll „Witchcraft“ gleichsam subjektübergreifend „gut“ machen?
Es ist der Umstand, daß Jackies Gitarrespiel nicht in jedem Takt, aber in der übergroßen Mehrheit aller Takte dieses Auftrittes, hör- und unterscheidbar Aussagen treffen bzw. repräsentieren, statt überwiegend spielerisch oder ornamental zu sein, und damit Leidenschaften entstammen, die außerhalb der Leidenschaft ihren Ort und Gegenstand haben, mit der Jacky Musike macht.
Und ohne Leidenschaft ist goar nix schön.
Aber was hat „Schönheit“ mit – beispielsweise – Physik zu schaffen!?
Auch physikalische oder andere wissenschaftliche Beweise sind leidenschaftlich.
Hegel hat diese Leidenschaftlichkeit fälschlich „Zärtlichkeit für die Dinge“ genannt, fälschlich, weil knapp daneben eben auch vorbei ist:
Es handelt sich um eine Zärtlichkeit gegen sich selbst, denn „Ich“ bin auch ein Ding, ein beseeltes Ding halt, und jede Seele (auch eine Katze) hat einen beträchtlichen Teil der klassischen (newton’schen) Physik in ihren ersten Daseinsphasen nervlich aufgenommen und in ihrer Nervenausstattung sowohl repräsentiert, wie tätig umgesetzt.
Wenn ich mich physikalischen Zusammenhängen widme, begreife ich folglich ganz lange und weitgehend erstmal mich selbst, bevor ich mich dann Gegenständen widmen kann, die noch nicht Bestandteil meiner selbst sind.
Ich hab das an anderer Stelle schonmal gesagt: Das ist die zirkulierende Bewegung der Begierde zwischen Hingabe und Aneignung.
Die ist „sexy„. Das ist sexy …
Im Unterschied zu Notdurft.
Und eine der wesentlichen Bestandteile der spätkapitalistischen Verarmung besteht darin, daß den ihr unterworfenen Subjekten all das, was „sexy“ ist, unter der Hand ganz schnell zu Notdurft gerinnt.
Nun ja, trotzdem verbleibt diese Wahrnehmung innerhalb des Subjektiven. Was keine Kritik ist, vielmehr schön, da es den Versuch des (Mit-) Teilens unternimmt. Doch es erfordert schon eine spezielle Vorbildung in Musik, um sich diesem Teilen hinreichend annähern zu können.
Mit der »Leidenschaft« habe ich ein kleines Problem: Warum »Zärtlichkeit gegen sich selbst«? Warum nicht „an sich selbst“ oder sogar nur „in sich selbst“? Und warum erst »Leidenschaft« und nicht sofort „Hingabe“? Um aus dem sich hin-geben, einem sich hinfort schenken bereichert wieder zu sich selbst zurück zu kehren?
Der Begriff »Hingabe« wird ja genannt, aber wird so nicht die ganze wohlmeinende Erläuterung, wie weiter oben gesagt, nur »spielerisch oder ornamental«?
Oder war das alles ein Beispiel dafür, was KI allein nicht leisten kann?
Dann wäre es – für mich – sehr gelungen.
„…verbleibt diese Wahrnehmung innerhalb des Subjektiven“
Solch „verbleiben“ macht mich stets baff, da fällt mir nurmehr Heinz von Foersters flaches Verdict ein, „Objektivität ist die Wahnvorstellung eines Subjektes, es könne beobachten, ohne Beobachter zu sein“. Das klassische Beispiel ist „Achill und die Schildkröte“, ein Paradox, das dadurch entsteht, daß weder Schildkröte noch Achill ent-scheiden, „jetzt ist er / bin ich gleichauf“. Das Ausbleiben der Entscheidung ist in eine mathematische Vorschrift gekleidet, deren Überbrückung heute – wenn ich das recht in Erinnerung habe – elementarer Bestandteil der cantorschen Zahlentheorie ist, indem diese verfügt, 1,99p (periode) =2. Das ist und bleibt ein billiger Trick.
Jacky verwirft ihn in dieser Zeile:
„What I do to you is witchcraft
And it’s up to you resist that“
Denn es ist ein Widerstand unterstellt, wenn Annahme (Aneignung), Vereinbarung, Gefolgschaft und schließlich Kooperation „ansteht“.
Was direkt zu diesem überleitet:
„spezielle Vorbildung in Musik“
Nö. Es braucht nur überhaupt Bekanntschaft mit musikalischem Schaffen, das zu einer schematischen Hälfte unformalisiert ist, sei es hausmusikalisch verbreitete Volksmusik, Jazz, Blues, oder Mischformen. „Witchcraft“ ist mal zuvörderst das, was Jacky ihren Bandmitgliedern antut, und in dem verlinkten Auftritt ist das konkret Thema.
Geh mal auf Minute 3:00. Da spielt Jacky einen Rythmusriff, den sie bei ca. 3:07 für einen Takt (vier Schläge) unterbricht, damit der Bassist ein „Grollen“ einfügen kann, dann spielt sie weitere zwei Takte bis zur nächsten Pause, und der Bassist … widersteht; tut nix, grinst sie stattdessen an.
Fast sicher ist das inszeniert, aber es ist das Ritual eines ehemals spontanen Einfalls.
Ansonsten … klar, es braucht eine gewisse Vertrautheit mit dem Instrument, der elektrischen Gitarre mitsamt den modulierenden Apparaturen, um unterscheiden zu können, was gestaltet ist, und was „zustande kommt“, bzw. ein Musiker „(sich) geschehen läßt“, und ja, einer, der noch nie so ein Teil in der Hand hatte und damit rumgespielt hat, hat es schwerer, das zu erkennen.
„Warum ‚gegen‘?“
In die Präposition habe ich ohne bewußte Absicht schon die „zirkulierende Bewegung“ kodiert, indem es sich um eine „Rückkehr“ von der Hingabe an den äußeren, physischen Gegenstand handelt.
„Leidenschaft“
Damit haben wir den Grund am Wickel, warum ich dich einen „Privatreligioten“ schimpfe, dein Einwand trennt meine Rede von jeder Tätigkeit und Handlung ab und fügt sie in ein ideelles Reich ein, das zum Zwecke moralischer Maximen, Vorschriften und Vorbehalten erfunden ist:
„Um aus [der Hingabe] bereichert wieder zu sich selbst zurück zu kehren?“
Es gibt kein „um zu“, Hingabe setzt ein aneignendes Subjekt voraus, und das aneignende Subjekt die Hingabe, die Begierde ist ein und derselbe seelische Vorgang (der für mich, wie du weißt, die Physis einschließt).
Ein Säugling, der erstmals die Mutterbrust ergreift, gibt sich ihr hin.
Beim ersten Mal wird das gewöhnlich mit geschlossenen Augen geschehen, und der Säugling – das ist gut gezeigt – sieht tatsächlich nichts, er nimmt nur weitgehend konturlose Helligkeitskontraste wahr. Die Hingabe an die Mutterbrust ist systemisch die erste Gelegenheit für den Säugling, die Augenbewegung unter Kontrolle zu nehmen und die Fokussierung zu erlernen. Ein und dieselbe Bewegung. Die außerleiblichen Bestandteile seines Daseins sind die Wirk-Lich-Keit seiner Sinnesorgane, die Propriozeption ausgenommen. „Bereicherung“ ist nicht Zweck, schon deshalb nicht, weil der Vorgang belastend ist. Es handelt sich vielmehr um eine Elementarform von Akkomodation (des visuellen Apparates an Gegenstände) und Assimilierung (der Gegenstände in den visuellen Apparat). Solche Elementarformen sind das, wovon ein Säugling Subjekt ist, und sie bilden seine Subjektivität heran (nicht „aus“, wie die Zurichtungspädagogik will).
PS.: Die immanente Kritik an der Vorstellung einer mechanischen „Intelligenz“ hatte ich im Hinterkopf, klar, aber ich bin außerstande, sie auszuformulieren, ich weiß nichts vom Metier der Erschaffung von Homunkuli.
Qana
gestern 14:41 Uhr
„Abschließend,“
Genau so wie alles andere von das: gelogen.
Antwort 3:
Gut, die Unterscheidung zwischen Plauderton und verbal-analytischem Infight wird weiter nicht geleistet. Dann werde ich mich wohl einfacherer Sprache bedienen. Angefangen mit: Ersetze »Subjektiven« durch «Persönlichen«, besser noch »Befindlichen«.
Mit »Leidenschaft« selbst habe ich sicher kein Problem, (»Und ohne Leidenschaft ist goar nix schön«, d’accord!) ich fand es an dieser Stelle problematisch oder unpassend.
Privatreligiot also? Nicht unpassend, doch würde ich es eher Soloreligiot nennen. Soviel sei gesagt, der Term Glaube ist mir vollständig ausgeklammert. Ich glaube weder Dir, noch mir, noch sonst jemandem; ich vermute, halte für wahrscheinlich, gehe aufgrund von Erfahrung davon aus… Ansonsten: nur wenn gefragt, erzähle ich davon, aber das macht niemand, denn alle haben ihren eigenen Scheiß, ihre eigene Idiotie. (Du erinnerst dich, der Idiot ist der, der zu sich selbst spricht?)
Was ärgert Dich daran, den Missionar noch nicht zurückgelassen oder ist es in Dir nur zu räumlich?
„um … zu“ ist also inexistent, wohingegen „zirkulierende Bewegung“, im Kreis um sich selbst drehen, »Fan zu sein« das Wesen der Hingabe ist, weil es ein seelischer Vorgang ist. Da frage ich mich doch, was ich hier mache. Zumal mir die intime(?) Säuglingserfahrung fehlt, da das erste Lebensjahr ein Krankenhausaufenthalt war (nix mit Mutter-Kind-Bett) und vermutlich ist deswegen meine Propriozeption und meine Blickschärfe so ausgeprägt – man nimmt, was vorhanden ist. Ansonsten weiß ich nicht, ob einem Säugling Hingabe unterstellt werden kann, Du beschreibst dann auch korrekt die Notwendigkeit eines blindes Er-trinkens der Welt. Scheint zu funktionieren.
KI ist Dir ein »Homunkulus«? Manchmal befürchte ich, Du wärest auch einer derjenigen gewesen, die die Ziffer „0“ verteufelten.
»What I do to you is witchcraft | And it’s up to you resist that« wurde vom Golden God beantwortet: »It’s gold son & it doesn’t mean a thing* […] But I didn’t want you hitching your wagon to my star«
Ursprünglich wollte ich ein anderes Video nehmen.
Eine schöne Vorstellung zum Ende hin:
UNKLE – Rabbit In Your Headlights
»Nice coat, pal!«
Aber weil es dich sicher mehr wurmt, heute dieses Geschenk hier.
Es war nicht meine Absicht, dich zu ärgern El-G, und ich bedaure, dich geärgert zu haben, weil das mein Posting weitgehend vergeudet hat.
Was du als „Infight“ empfindest, ist mein „Plaudern“, das allerdings im „Ton“ konzilianter ausfiele, säße ich dir gegenüber, weil dann deine mimische und habituelle Gestik Teil des Gespräches wäre, wie auch meine.
Anders plaudern, vielleicht so, wie du das verstehst, habe ich immer nur mit Genossen gekonnt, die obendrein noch Freunde waren, oder Geliebten, real oder potentiell, die keine Genossen sein brauchten, um mit mir zu plaudern.
Folgendes ist kein ganz schlechtes Beispiel für den Grund:
Gern! Das zieht nämlich keine abstrakte Schranke ein, wie es „subjektiv“ fast immer tut – das ist just der Zweck dieses Fremdwortes.
Du kannst mir gern eine „defizitäre Subjektivität“ bescheinigen, das ist, gemessen an … ich sage mal: dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen bürgerlicher Subjektivität, die reine Wahrheit. Ich kann mich schlecht und recht verstellen, wenn du das willst – willst du das?
Na also!
Und es wäre schon deshalb unnötig, weil mich dein Geschenk doch nicht „wurmt“. Ich habe auch keine Idee, wie du darauf kommst, es könne oder müsse mich gar wurmen.
Ich kenne Benjamin Britten nicht, deshalb weiß ich nicht, womit konkret er sich diese musikalische Grabrede eingehandelt oder verdient hat, an der für mich (mein Musikempfinden) das hervorstechenste Merkmal ist, daß sie eines HERRSCHERS würdig wäre.
Solche Verballhornung, solch gewaltsames „nitvastahn“, das noch in seiner Konstruktion verrät, es ist gelogen, ist eines Ratzefatz würdig, aber doch nicht dir, El-G (?)
Sorry, der Begriff »nitvastahn« sagt mir nichts, löst auch nix aus..?
»Hingeben« ist ja eine Art des Selbst-Verlierens, wobei nicht gesichert ist, dass etwas zurück kommen wird, es also verloren bleiben kann. Von daher habe ich Deine Anmerkung zum »um .. zu« als zu streng wahrgenommen, als zu sehr betont auf eine „Absichtlichkeit“, als einen gesicherten Wurf eines Bumerangs, was ich nicht meinte. Und wenn ein Handeln mit „kreisen“ beschrieben wird, habe ich dagegen eine Abneigung entwickelt, aus einer schrägen Erfahrung heraus, von daher is the joke on me. Dennoch großzügig von Dir, dass Du ratze auch eine gewisse Würdigkeit zusprichst.
Der Cantus ist nicht nur eines Herrschers würdig, ich denke, Arvo Pärt würde ihn jedem zusprechen wollen. Dennoch ist es natürlich seine Verneigung vor Britten und für ihn (Pärt) gibt es nur einen Herrscher (das war der vermutete Wurm ;-)). Ich verehre das Werk von Arvo Pärt zutiefst, es hat mich emotional in bitterste Tiefen geführt und dort begleitet, aber nie zurück gelassen. Darin liegt seine Schönheit für mich.
Jaja, die Fremdwörter, was dem einen eine Fremde ist, ist dem anderen der vertraute Versuch einer Präzision. Auch das gelingt nicht immer.
„defizitäre Subjektivität“ ist doch wohl eine Tautologie, wenn man die negative Konnotation des Adjektivs ausklammert: Sowas bescheinige ich nicht, dafür habe ich keine Stempel.
Danielles Zeitfresser unten gebe ich mir später, grazie.
Alsdann.
Was eine KI gewiß zum eingeschränkt tauglichen Instrument macht: Sie kann nicht hassen.
Ich kann mir die Sorte Hass nicht erklären, wie sie mir grad hier entgegen schlägt. Ich kann sie mir nur bebildern. Und da entspricht sie der Erfahrung, die ich mit Kettenhunden habe. Die sind ihrem Herrchen schlicht und vollständig ergeben, aber jeder andere Mensch kriegt schnell den HASS ab, der in dieser Ergebenheit verborgen liegt. Weil er nicht angekettet ist? Möglich. Weil er sich freizügig zum Hund stellen kann, indifferent oder gar freundlich? Auch möglich.
Wie dem auch sei, ich habe einen musikalischen Kommentar. Danielle Schnebelen and Brandon Miller at their best, „I Sing The Blues“ von 2015 (frisst 10 min eurer Zeit):
https://www.youtube.com/watch?v=GubbquvcCso
Aber – um Danielle auf keinen Fall Unrecht zu tun:
„Save Me“, Wichita Sessions 2017
https://www.youtube.com/watch?v=itEB0Db5Idk
HIer kann man mal wieder wunderbar beobachten, wie eingebildet „professionelle Meinungsführer“ versuchen, ein interessantes Thema durch Quark und Blabla mit Ballaballa in den Orkus zu schütten versuchen.
Qana und El-G, das Team – oder nur zwei Seiten eines gespaltenen Chatbots?
Vernunftbegabte, ehrbare, anständige Wesen können das nicht sein.
Guten Morgen lieber Herr ratefatz,
Sie schrieben:
Diese Unmöglichkeit des experimentellen Beweises in dieser Größenordnung ist keine Widerlegung der Theorie. Dafür gibt es die Extrapolation, oder? Ihre Einwende bezüglich der nicht gleichzeitigen Messbarkeit von Masseverlust und Energiezuwachs halte ich für plausibel, so wie Ihre weiteren Ausführungen interessant.
Sie ziehen kohärente Schlüsse, die wiederum an dieser Stelle auch nicht beweisbar sind. Verschiedene Gegenreden sind gleichfalls interessant; und ehrlich gesagt, habe ich die Beiträge von Dirk Freyling noch nicht völlig durchdrungen.
Und nu?
Den zehntausenden Wissenschaftlern, die an diversen Forschungszentren auf Grundlage dieser Theorie(n) arbeiten und forschen, Dummheit, Verblendung oder Lüge zu unterstellen, halte ich für gewagt – abgesehen von der „Lüge“ allerdings nicht für unmöglich.
Meine „Meinung“ zur abschließenden Frage des Artikels – der übrigens von der KI- Forschung ausgeht und nicht von der theoretische Physik – habe ich hier geäußert und keine direkte Reaktion erhalten. Ok für mich. Zu unterstellen, es ginge mir um eine erstrebte »Meinungsführerschaft«, ist denn auch wieder gewagt, oder? Ebenso gewagt wie die Aussage »ein interessantes Thema […] in den Orkus zu schütten« zu wollen.
Für mich sind weiße Tennissocken in Sandalen weiterhin „peinlich“, auch wenn sie bei einigen jungen, angeblich modebewussten Leuten gerade wieder en vogue sind. Doch ich werde mich denen gegenüber dazu nicht äußern, wozu?
Dass Sie die Fortsetzungsfolge des Spiels zwischen Q. und mir als „peinlich“ empfinden, ist ihre Sache und Befindlichkeit, wie Sie wissen, müssen Sie das nicht lesen, wenn Sie nicht wollen…
Ich wünsche Ihnen aufrichtig einen wundervollen Sonntag,
(ein Chatbot aus Ihrer Zukunft 😉 )
PS: Sie müssen schon zugeben, dass Ihr heutiger Kommentar auch nichts zum Thema beiträgt – völlig ok für mich…
Nach „Extrapolation“ kommt gleich „Modellierung“ und „Simulation“. Die räudigen Kinder des „Gedankenexperiments“.
Wer schon mal mit Splines gearbeitet hat, weiß, was das alles bringt: nichts an Erkenntnis! Nur schöne Bilder.
Schon der Begriff „Gedankenexperiment“ ist der glatte Hohn. Ein Begriff wie „schwarzer Schimmel“, also ein hell gefärbtes Pferd das gleichzeitig schwarz sein soll.
Ein Experiment ist ein realer Versuch AN DER REALEN NATUR, an der Wirklichkeit selbst. Ein Experiment ist das glatte Gegenteil von Herumdenken, Sinnieren, Herumspintisieren!
Jede Idee, jeder Gedanke, muss mit der Natur abgeglichen werden um für die Realität von Belang sein zu können. Einstein hat NIE(!) irgend ein reales Experiment durchgeführt. War er nicht eher ein Hellseher als ein Genie, das er mit all seinem Ausgedachten so Recht behalten hätte?
„Den zehntausenden Wissenschaftlern, die an diversen Forschungszentren auf Grundlage dieser Theorie(n) arbeiten und forschen, Dummheit, Verblendung oder Lüge zu unterstellen, halte ich für gewagt – abgesehen von der „Lüge“ allerdings nicht für unmöglich.“
Ich habe die offensichtlichen Widersprüche in den Relativitätstheorien Einsteins an Dutzende Wissenschaftler im deutschprachigen Raum geschickt: ein einziger hat sich mühsam und hoffnungslos durch Vermathematisierung und also Vernebelung der offensichtlichen Sachverhalte aus der Bredouille zu winden versucht.
Die schlicht Tatsache, dass nicht entscheidbar ist, welcher von zwei unbeschleunigten, sich _gegeneinander_ bewegenden Körpern bewegt ist, und welcher nicht, wird einfach „weggerechnet“. Und das war’s dann. Weil, es kann ja nicht sein, was schließlich nicht sein darf.
Der größte Witz an der ganze Sache ist ja, dass die „Relativitätstheorie“ genau diese offensichtliche Relativität der (unbeschleunigten!) Bewegung und Geschwindigkeit auszuhebeln versucht – ganz im Gegensatz zu deren Namen. Ein noch größerer Witz (was angesichts solchen Schwachsinns wie die Relativitätstheorien gar keine größerer Widerspruch ist) ist, dass jeder Mittelschüler den Unsinn erkennen kann – wenn er nicht in seiner „Bildungs“- und Medien-Lech-Mai-Thi-Falle steckt und stupide darin hocken bleibt.
„Sei und bleib blöde: Follow the science!“
FTR:
Auch abseits der Masse-Energie – Äquivalenz ist die Vorstellung von „unbeschleunigten Körpern“, also Massen, eine Fiktion, weil ununterscheidbar ist, ob die sogenannte Trägheitskraft einer beliebigen Masse, die innerhalb eines willkürlich abgegrenzten ->Inertialsystems als „Ruhmasse“ erscheint, die ihrer Beschleunigung Widerstand entgegen setzt, außerhalb solch eines willkürlichen Referenzrahmens bereits Produkt einer Beschleunigung ist, oder nicht.
Die ART trägt dieser Ununterscheidbarkeit Rechnung, indem sie die Differenz der Erscheinungen „Ruhmasse“ und „beschleunigte Masse“ in die Vorstellung einer „gekrümmten“ Raumzeit aufhebt.
Daß es diese Krümmung gibt, ist anschaulich dargestellt und in diesem speziellen Sinne „bewiesen“, z.B. im „gravitational lensing“. Um was es sich bei dieser „Krümmung“ außerhalb anschaulicher Darstellbarkeit handelt, steht buchstäblich in den Sternen …
Naja, ich würde nicht gleich alle Methoden völlig in die Tonne treten wollen, bei verschiedenen Gelegenheiten sind sie schon brauchbar.
Das mag in der (Natur)Wissenschaft so streng gehalten werden und ist da sicher sinnhaft und zwingend, doch neben dem Experiment gibt es auch die Beobachtung.
Als Beispiel für „Idee“ möchte ich mal den Begriff „Glaube“ in den Raum stellen: Es ist etwas, das nicht gewusst wird und sein Gegenstand nicht fassbar und damit erst mal nicht beweisbar ist. Dennoch ist „Gott“ existent, alleine schon, weil es den Begriff gibt, und dieser Begriff hat eine Wirkung, auch wenn eine Entität Gott, die irgendwo herumschwirren soll, nicht beweisbar ist – und es wohl auch bleiben wird. Weiter sind die Wirkungen des Begriffs „Gott“ – was gleichgesetzt wird (ratloses Schulterzucken) – tatsächlich und unvorhersehbar. Deswegen kann ich für mich sagen: Ich weiß, dass Gott existiert, doch er/sie wohnt sicher nicht im Himmel und hat bestimmt noch nie mit einem Menschen gesprochen oder ihm zugehört.
Und wenn ich zum „Glauben“ noch die „Wissenschaft“ nehme, erhalte ich Wissenschaftsglaube, dann habe ich den Salat: Für die einen appetitlich für andere welk.
Die Erklärung von „Gravitation“ durch die Raum-Zeit hat bei mir von beginn an Unbehagen ausgelöst.
Zwei Besipiele:
Wenn ich eine vereinfachte 2D-Darstellung der Raum-Zeit nehme, wird hier die Raum-Zeit durch die Gravitation gekrümmt: Etwas zerrt an der Kugel bzw. an der Raum-Zeit, in die die Kugel fällt. Irgendwie wird für mich hier Gravitation mit Gravitation erklärt..?
Das Licht soll nun Welle und/oder Teilchen sein. Wenn Licht also (manchmal) ein Teilchen ist, könnte ein Gravitationslinseneffekt nicht einfach durch Ballistik erklärt werden, brauche ich eine gekrümmte Raum-Zeit?
Vielleicht ist meine Vorstellung von Raum auch einfach zu niederschwellig, kann ich final nicht in Abrede stellen. Meine mathematischen Fähigkeiten sind für ein Duell jedenfalls zu gering, denke ich.
Aber deswegen werde ich mir nicht die Skepsis abgewöhnen.
Das klingt sehr frustrierend, mein Mitgefühl. Ich weiß, hilft auch nicht weiter.
Vielleicht behält Planck ja recht, da ist dann viel Geduld gefragt 🤷
„Irgendwie wird für mich hier Gravitation mit Gravitation erklärt..?“
Ja, die Masse, die das gespannte Gummituch eindellt und damit die Anziehungskraft verbildlichen soll würde Gravitation veranschaulichen, dabei dellt da gar nichts ein wenn keine Gravitation auf die Masse und Gummituch wirkt. Also eine Bild das das Abzubildende als Konkretum benötigt um dieses Konkretum angeblich abzubilden. Ein „Spiegel“, der nur mithilfe eines Spiegels spiegelt, oder so.
Und wenn man sich ansieht, wie dieses „Gummituch“-Bild verbreitet ist und überall bemüht wird – obwohl es völlig schwachsinnig ist um das zu veranschaulichen was es angeblich veranschaulicht – dann bekommt man auch schon ein Gefühl, was der Rest davon ist.
Das ganze „wissenschaftliche“ Denken ist heute voll von offensichtlichem Unsinn:
aus einer Masse(/und Energie, denn Energie sei ja gleich Masse)-Ansammlung würde angeblich ab einem bestimmen kritischen Dichte-Wert nichts mehr herausdringen können („Schwarzes Loch“) — aber das Universum sei aus genau so einer, sogar MAXIMAL GROßEN und MAXIMAL DICHTEN, Ansammlung aller Massen und Energien als „Urknall“ entstanden.
Ja was nun: Schwarzes Loch oder Urknall – beides geht nämlich nicht zusammen!
Und solcher Unsinn ist zuhauf zu finden, wenn man danach sucht.
Die Physiker winden sich und raufen sich die Haare, um dann mit viel Blabla und noch mehr Mathematik-Gedöns das Offensichtliche wegzuerklären. Mathematik wird heute vorwiegend zur Verarschung (oft genug auch zur Selbstverarschung) eingesetzt. Nicht nur für Statistiken.
Habe es gerade erst gelesen…
Ja, den Impuls für den Urknall – gerade mit Betracht auf Singularitäten innerhalb des Unviersums – habe ich auch nie geschnallt…
Aber da gibt es ja noch die kollidierenden Filamente in der M-Theorie, wobei mir nicht wirklich klar ist, wie sie kollidieren können, wenn es dort keine Zeit gibt…
Seit Charles Darwin stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Motivation bei Kritikern von Wissenschaft an sich.
Das, wiederum ist meist religiös motiviert.
Weil es Leute gibt, die den Menschen nicht so sehen wollen wie er sich vom Wesen her darstellt.
Nun, wohl nicht erst seit Darwin. Kritik und Motivation sind aber immer eine Betrachtung wert.
Für mich ist es allerdings ein weiter Schritt von:
1. „ich begreife das nicht“ zu 2. „es ist falsch und ich begreife es nicht“ oder gar 3. „es ist falsch, weil ICH es nicht begreife“…
Gerade in der theoretischen Physik lasse ich mir ziemlich viele Knoten im Hirn gefallen. Einerseits finde ich es einfach spannend und andererseits haben hier Fehler keine unmittelbaren Auswirkungen auf mein Leben, im Gegensatz zur Politik o.ä. Weiter habe ich auch keine Möglichkeit, validierende Experimente zu machen, muss vieles also erst einmal so nehmen, wie es vorgetragen wird…
Seit einiger Zeit versuche ich mir die Theorie des Holografischen Universums anzueignen. Auch wenn es ein schräger Vergleich ist, ich habe dabei einen Heidenspaß, das kann bei mir keine Fantasy oder Science Fiction Literatur leisten 😉
Ja, ich hätte ‚Spätestens sei Darwin’ schreiben sollen. Zu meiner Entschuldigung: es war schon sehr spät.
Das ist ok. Die katholische Kirche hat sich selbst – großzügiger Weise – ihren Schnitzer bezüglich Galilei auch schon verziehen…
Aber ich möchte noch einen vierten Punkt ergänzen, der leider viel zu häufig vorkommt:
4. „Diese Erkenntnis passt mir nicht, deshalb will ich es nicht verstehen, folglich ist es falsch.“
Gibt mir Gelegenheit für eine kleine Unterrichtsstunde in Prolegomena und sprachlicher Differenzierung, die ich trainingshalber gern wahr nehme .
Ein Tier, das etwas wahrnimmt (registriert) ist bereits tätig, indem es das physische Material der Wahrnehmungsorgane in eine neuronale Repräsentation auf- und damit eine Abstraktion vornimmt.
Gleichwohl ist diese Tätigkeit passiv, wenn ich nicht die Organik für sich zur Referenz nehme, sondern das Dasein dieser Organik in einem Lebensprozess.
Aktiviert werden die (nun abstrakten!) Wahrnehmungsgegenstände für einen Lebensprozess in der Memorierung. In der Gestalt memorierter Phänomene werden Wahrnehmungsgegenstände zu Handlungsgegenständen, wobei die primäre Handlung des Organismus die Aufmerksamkeit ist, welche memorierte Phänomene den Produkten wiederholter und neuer Wahrnehmungshandlungen integriert.
In der Gestalt von Handlungsgegenständen werden die Wahrnehmungsinhalte zum Material von Vorstellungen.
Vorstellungen sind nun keine Reproduktion memorierter Phänomene mehr, weil ihr Gegenstand nicht länger das einzelne memorierte Phänomen ist, sondern die Gesamtheit aller Handlungsgegenstände eines Organismus. Eine Vorstellung integriert diese Gesamtheit bezüglich eines im Lebensprozess eines Organismus ausgewählten Aggregates von Wahrnehmungs- und Handlungsgegenständen.
An der Stelle ist ein Übergang fällig:
Denn die Vorstellungen in der bis hierher abgeleiteten Gestalt taugen im Lebensprozess erst nur zu reaktiver Handlung. Ich sehe eine Frucht vom Baum fallen und gehe hin, sie aufzuheben.
Tiere suchen indes die Bäume auf, von denen Früchte fallen. Diese Handlung unterstellt eine Ablösung von Vorstellungen von der Wahrnehmung, und diese organische Leistung ist das übergreifende Moment dessen, was „Intelligenz“ genannt wird, die Leistung heißt Antizipation.
Antizipative Vorstellungen heißen Anschauungen. Anschauungsgehalte sind von Vorstellungsgehalten genau darin unterschieden, daß sie im mentalen Prozedere den Wahrnehmungsgehalten gleichgestellt sind, indem sie einer neu geschaffenen Klasse von Wahrnehmungsgegenständen zugeordnet werden.
Der wahr genommene Apfelbaum ist in der Gestalt des Anschauungsgegenstandes nicht länger ein Ding, von dem ein Apfel fällt oder nicht fällt, sondern ein Ding, von dem ein Apfel fallen kann , oder nicht fallen kann. Anschauung reaktiviert Aufmerksamkeit zu einer neuen Gestalt und Funktion, sie wird Beobachtung. Sind an dem Apfelbaum (schon) Äpfel dran, oder nicht?
————–
Hier breche ich ab, weil an der Stelle schon erste Übergänge zu Schritten einer Begriffsbildung anstehen, und das wird mir jetzt zu viel und zu kompliziert.
Meine allgemeine Darstellungsabsicht:
Ihr habt kaum eine Spur einer Ahnung davon, wer, was und wie ihr seid
Und folglich habt ihr kaum eine Spur eines Verständnisses der Gegenstände, mit denen ihr umgeht. Euer Verstand – bzw. das, was dafür herhalten soll – ist vollgestopft mit Daten und Vorschriften, wie mit ihnen umzugehen ist – darüber hinaus ist da … wenig.
Und insofern und insoweit ich mich jetzt irre – weil ich ja nicht in euch „hineinsehen“ kann, und weil da sicher „mehr“ an dem ist, was ich jetzt dargestellt habe – könnte mich das glatt „glücklich“ machen … wäre ich a bissel jünger …
Vermutlich hätte ich diesem Fragment dennoch besser einen weitläufigen Schluß angefügt, der in etwa zur selben Klasse zählt, wie eine mathematische Vermutung, was ich jetzt nachhole:
Unterstellt, es stimmt, daß Erkenntnisgegenstände einer unentwegten Reflexion von Wahrnehmungsgegenständen in die Schöpfung von Anschauungsgegenständen, und umgekehrt, die Reflexion von Anschauungsgegenständen in Wahrnehmungsgegenstände entstammt, mit dem Zusatz, daß dieser Prozess parallel zu einer „Außenwelt“ eine „Innenwelt“ erschafft, welche wiederum Gegenstand derselben zirkulierenden Bewegung wird, und es ab bestimmten Stufen der Erkenntnistätigkeit zu werden hat,
dann
dürfte diese Dynamik der anorganischen Welt nicht weniger, nur anders eigen sein, als der organischen.
Und folglich repräsentiert dieser Zusammenhang den singulären „wahren Kern“ ideologisch eingefärbter, abstrakter Vorstellungen, wie sie – auf verschiedene Weise – sowohl dem Pantheismus wie dem „dialektischen Materialismus“ zugrunde liegen.
FTR
ich hatte El-G’s Beitrag zum KI-Thema nicht kommentiert, weil er indiskutabel ist, der einzige Gegenstand darin ist der Autor selbst.
Ja, ein Meinungs-Post.
Danke für die Wiederholung.
FTR 2:
Die Darstellungsabsicht und den Zweck meines Postings zu E=mc² hatte ich in einer nicht ausgezeichneten Zwischenüberschrift benannt:
Was damit ausgesagt und im darunter Stehenden exemplarisch ausgeführt sein soll, haben weder Ratze noch El-G wahr nehmen wollen – vielleicht auch nicht können:
Des Gegenstandes der Formel halber, den man mit „jegliche Form des Gegenständlichen“ paraphrasieren könnte, ist die generalisierte Energie-Masse – Äquivalenz abseits des Komplexes der Quantenfeldtheorien die entschiedenste Ausweisung allen philosophischen Monotheismus aus der physikalischen Welt, welche die Kategorien „Zufall“ und „Notwendigkeit“ aus ihr eliminiert und in das Reich des instrumentellen Verstandes absortiert, wo sie herkamen.
Will ich dasselbe philosophisch ausdrücken – offenbar eine kommunikativ unausweichliche Ungenauigkeit – könnte ich sagen, die Formel validiert einen Einwand gegen das instrumentell – herrschaftliche philosophische Denken, der Parmenides zugeschrieben wird: Nur was nicht ist, ist möglich.
Und mein Hirn hat mir heut nacht geflüstert: Das wird dann wohl die (mehr oder minder unbewußte) Quelle des Hasses sein, die du aktivierst.
PS.: Fragt man heute eine KI (oder eine Philosophen-Website), sagt sie, die Zuschreibung der Sentenz „Nur was nicht ist, ist möglich“ an Parmenides sei ein Irrtum, Parmenides habe das Gegenteil behauptet, nur „das Sein“ sei möglich, ein „Nichtsein“ hingegen nicht.
Obgleich ich altgriechisch nicht deuten kann und die Überlieferung Parmenides nur Fetzen umfaßt, halte ich das für eine ontologische Fälschung der stoischen resp. skeptischen Literatur, namentlich der des Zenon, aus der die Paradoxien stammen, deren eine die Allegorie von Achill und der Schildkröte ist. Die Stoiker haben sich auf Parmenides berufen, weil sie den berüchtigten Spruch, gemäß der Kategorie „Sein“ sei die Welt gleich einer Eisenkugel, als Kritik des Seinsbegriffs aufgefaßt haben. Diese Leute waren und sind die beste originale Quelle zum Parmenides, und das ist, was in der philosophischen Tradition zählen sollte – statt Spekulationen, was eine Person namens Parmenides mit Aussagen, deren Überlieferung unsicher ist, „gemeint“ haben könnte.
Analog unklar ist die Überlieferung des Heraklit, dessen kolportierter Spruch, „du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen“, vom Standpunkt eines ontologisch verseuchten Verstandes unentwirrbar mehrdeutig ist.
Mein Verständnis dieses Spruches aus meiner rudimentären Kenntnis der philosophischen Tradition:
„Bewegen, Bewegung ist etwas, das du tust UND das dir geschieht – und nix weiter.“
What I do to you is witchcraft
It’s up to you, resist that!
Ja, genau: an der Stelle der für die Gegner hoffnungslos gewordenen Diskussion kommt immer so ein Scheiß!
Wie billig. Da wird dann Platonismus, Sophismus, Ontologie, … mit ganz viel gequirrltem Blablabla gekreuzt. Weil man sich der offensichtlichen Wahrheit ja nicht stellen kann!: alles Lüge was da verzapft wurde und wird.
Nur um den allzu durchsichtigen Versuch der Verschüttung durch QanaEl-G auszuhebeln:
Mit der speziellen Relativitätstheorie (sRT) wird behauptet: „Aus dem Relativitätsprinzip folgt, dass Abstände und Zeitdauern vom Bewegungszustand des Beobachters abhängen. “ (siehe Wikiblödia als Referenz).
Zu erst einmal muss die Frage gestellt werden, was denn der Beobachter mit den Gegebenheiten an dem Beobachteten zu tun haben soll. Man denke an das Zwillingsparadoxon: angeblich würde der auf der Erde verbliebene Zwilling älter sein als der mit dem Raumschiff herumgeflogene beim Wiedertreffen. Der Erd-Zwilling ist hier anscheinend der Beobachter. Aber was ist, wenn man den Raum-Zwilling als Beobachter wählt? Dann wäre der Erdzwilling derjenige der jünger bliebe? Die physikalisch gegebenen Bedingungen ändern sich je nach gewählter Beobachterposition? Ohne jede physikalische Einwirkung? Einfach nur durch Änderung der Ansicht?
Das wird versucht in Abrede zu stellen, indem man die Beschleunigungen (Start, Umkehr, Landung) des „Raum-Zwillings“ als „Beweis“ für dessen Bewegung anführt. Aber die sRT berücksichtigt nirgendwo Beschleunigung. Da wird also schon mal geschummelt.
Die (wirkliche!) Relativität von unbeschleunigter Bewegung wird ja genau dadurch bedingt, dass es keinen Äther, keinen Fixpunkt im Weltall gibt und daher unentscheidbar ist, welches von zwei sich gegeneinander bewegenden Objekten ruht oder welches sich bewegt.
Und ob und wann eines, beides oder keines der Objekte irgendwann beschleunigt wurde, spielt dabei überhaupt keine Rolle!
Die sRT behauptet das genaue Gegenteil ihres Namens: sie behauptet, unbeschleunigte Bewegung sei NICHT relativ, sondern absolut! Das ist der reine Hohn von „Wissenschaft“. Das ist die pure Veräppelung jeder Vernunft.
Und als Gipfel der Blödheit wird dann auch noch behauptet, das eine von den beiden Objekten würde sich physikalisch-konkret verändern, Längen und Abstände wären verkürzt, Zeit wäre darauf, lokal, gedehnt. Und zwar sei das auf dem beobachteten Objekt der Fall, während bei dem Beobachter natürlich alles bleibe wie es ist, weil der ja angeblich in Ruhe sei.
Geht es noch blöder?
Geschützt wird diese Vollverblödung durch einen riesigen Aufwand an aktiver Verdummungsleistung: der Phantasierer dieses Schwachsinns wird zur ultimativen Geistesgröße erklärt, wird zu dem Popanz der angeblich wahren Größe und Genialität aufgeplustert, jede Kritik an der Person oder deren Phantastereien wird zum Sakrileg erklärt und mit dem Verlust der wirtschaftlichen Existenz, zumindest Verlust jeder Reputation und Verunmöglichung jeglicher akademischer Karriere bestraft. Zusätzlich geschützt wird das Ganze mit dem stärksten („westlichen“) Bannfluch heutiger Zeit: es könne ja nur ein Antisemit sein, der da zweifelt. Oh Gott!
„Das wird versucht in Abrede zu stellen, indem man die Beschleunigungen (Start, Umkehr, Landung) des „Raum-Zwillings“ als „Beweis“ für dessen Bewegung anführt.“
Die Beschleunigung ist nicht der Beweis der Bewegung. Die Bewegung ist evident, da sich Beobachter und Beobachteter von einander weg bewegen. Es geht um Geschwindigkeit nicht um Beschleunigung. Die Zeitdilatation kann man messen. Die ist Fakt.
„Die sRT behauptet das genaue Gegenteil ihres Namens: sie behauptet, unbeschleunigte Bewegung sei NICHT relativ, sondern absolut!“ Das behauptet die sRT nicht.
zu Krim
gestern 09:48 Uhr
Sie verstehen nicht den Punkt: die Bewegung ist evident wegen der Abstandsänderung. Nach der Logik muss sich dann ja mindestens eines der Objekte bewegen. (Obwohl die heutige Schwachsinnsphysik auch noch „Raumerzeugung“ als Grund für Abstandsänderungen erfunden hat. Die soll sogar Überlichtgeschwindigkeit ermöglichen und sei für die „Inflation“ nach dem „Urknall“ verantwortlich).
Aber welcher der beiden Objekte darf als bewegt, welcher als ruhend angesehen werden? Die sRT führt dazu die Position des Beobachters ein. Was schon an sich abstrus ist. Denn das Ganze kann ja auch „von außen“, von einem Dritten beobachtet werden. Und schon haben wir drei verschiedene mögliche „Zeitdilatationen“. Schaltet man sich gedanklich („Gedankenexperiment“!) zwischen den verschiedenen Beobachter um, ändern sich damit ständig die physikalischen Befunde (Längen, Zeitverläufe) für jedes der Objekte – zumindest nach sRT.
Und Zeitdilatation wurde noch nie gemessen. Was gemessen wurde und wird ist die unterschiedliche und sich ändernde Signalankunft von sich relativ (zum „Beobachter“) bewegenden Signalquellen.
Die Signale der Pioneer-Sonde 10 bzw. 11) treffen mit immer weiter sinkenden Frequenzen ein weil jeder weitere Impuls von einem weiter entfernten Punkt abgestrahlt wird. Aber das nichts mit deren Geschwindigkeit zu tun – bzw. nur indirekt aufgrund der damit verbundenen Abstandsänderung, da die Pioneer-Sonden von uns wegfliegen.
„Die Sonden bewegen sich relativ zur Erde mit einer Geschwindigkeit, so dass durch den speziell relativistischenDoppler-Effekt eine Frequenzverschiebung stattfindet. Genauer gesagt handelt es sich wegen der zunehmenden Entfernung der Sonden von der Erde um eine Doppler-Rotverschiebung (zweite Gleichung im Eintrag Doppler-Effekt), so dass die Sonde eine kleinere Frequenz des von der Erde kommenden Radiosignals misst. “
Das „relativistisch“ ist natürlich Quatsch und der Zeitidiotie geschuldet. Es handelt sich schlicht um den Dopplereffekt, hier „doppelter Doppler“, weil ein Signal hin und wieder zurück geschickt wird.
h#ttps://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/pioneer-anomalie/345
„so dass die Sonde eine kleinere Frequenz des von der Erde kommenden Radiosignals misst. “ Ja, selbstverständlich, kann man da nur sagen. Nur hat das nichts mit dem Relativitätsquatsch zu tun. Doppler eben!
@Qana 01.12.2025 21:55 Uhr
Oh, Unterrichtsstunde? Fein!
Dann schauen wir mal.
Ja. Und wozu die 2 Sätze dahinter? Sind unnötig, es sei denn, »Organik« könne aktiv sein.
Eher: „Aktiviert werden […] Wahrnehmungsgegenstände […] aus Memorierung.“ Wenn es »in der« wäre, wäre es „abgelegt“.
Gut.
„… wodurch
memorierte Phänomene denProduktenwiederholter und neuer Wahrnehmungshandlungen integriert werden.«Gut.
Welcher Art können diese denn sein? Wie werden sie bestimmt bzw. erstellt?
Nicht vielleicht doch „Erwartungen“?
Etwas ist unterschiedlich, weil es gleichgestellt bezüglich einer möglichen Klassifizierung ist?
Nun..?
Den Apendix von 06:52 Uhr lasse ich jetzt mal außen vor. Verstehe auch nicht, wozu das gut sein soll, da Du letztens Panta Rhei völlig auseinander genommen hast.
Was soll das? Jetzt wirklich? Was soll das? Soll das irgendwen motivieren oder herausfordern? Wie soll das funktionieren? Du nennst Rezipienten Hirnis und denkst, die Hirnis kommen wieder, weil Du es ihnen gesagt hast?
Abschluss:
Was auch immer dieser Text ist, er ist kein »Prolegomena«: Keine These, keine (nicht einmal rethorische) Frage, kein exponierter Gegenstand, keine Absicht.
Was den Unterricht angeht, möchte ich sagen, sorry, wie es nicht gemacht wird, habe ich bereits vorher gewusst.
Habe mir gerade das jüngste Video mit Denis Noble zur Hälfte ‚reingetan und für geeignet befunden, eine ganze Reihe von Themen, die ich hier aufgemacht habe, gleichsam „von der Seite“, der Seite der biologischen Forschung, zu beleuchten:
„Neo-Darwinism Is Dead“ | We Need A Biology Beyond Genes
https://www.youtube.com/watch?v=NAPhBt8VJCM&list=WL&index=28
Das sind über 1,5 Std, die sich für Interessierte lohnen sollten, aber ich möchte besonders auf min 38-49 hinweisen, auch mit Blick auf El-G’s Kritik.
Kritik?
Ich habe selbst auf den 2. Blick nicht durchgeblickt, WAS er denn konkret kritisiert haben will. Stattdessen meine ich bemerkt zu haben, worauf seine Kritik unausgesprochen geht – es ist die in der ganzen in Ableitungsform vorgetragenen Begriffsbestimmung präsente Subjektivität, engl. „agency“, des Organismus, der in der von mir beschriebenen Weise tätig sein soll.
Beispiel:
Na, Gegenstände der Begierde, bloke, das hatten wir schon weiter oben, resp. Gegenstände der Begierde aggregiert mit Umständen ihres Auftretens, zum Beispiel der von mir zum Beispiel erkorenen Fruchtreife des Apfelbaumes.
Ich werde wohl noch im Einzelnen auf das eine oder andere eingehen – wozu ich jetzt keine Zeit habe –
Nein, ich werde mich nicht an El-G’s Unwillen abarbeiten, aber er hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß ich manches besser expliziter gemacht und ausgeführt hätte, als ichs getan hab, das werd ich nachholen, doch nicht mehr heute.
Mir ist grade eingefallen, daß ich bis zur Kategorie der Anschauung auf formeller Ebene auch die Basisarbeit zahlreicher neuronaler Netzwerke bzw. AI’s charakterisiert haben sollte. Ich habe nur Basiskenntnisse der Kybernetik und Null Ahnung von Elektronik, aber ich kenne zumindesten einen beträchtlichen Teil der effektiven Leistung von Schachrechnern bzw. Programmen. Im Kern ist das einfach der kontinuierliche Aufbau von Registern, ihre Vernetzung, Erweiterung, Neuvernetzung, Umwidmung und vielleicht auch Löschung, resp. Auflösung in neue Register. Vielleicht gibt es hier einen Leser, der was dazu sagen kann.
Witziges Spiel: die PR-Fuzzies müssen ihren Blödsinn immer weiter treiben um das, was nicht gesehen werden darf immer wieder in den Hintergrund zu drängen.
Halt! Hier hin:
zu Krim
gestern 09:48 Uhr
Sie verstehen nicht den Punkt: die Bewegung ist evident wegen der Abstandsänderung. Nach der Logik muss sich dann ja mindestens eines der Objekte bewegen. (Obwohl die heutige Schwachsinnsphysik auch noch „Raumerzeugung“ als Grund für Abstandsänderungen erfunden hat. Die soll sogar Überlichtgeschwindigkeit ermöglichen und sei für die „Inflation“ nach dem „Urknall“ verantwortlich).
Aber welcher der beiden Objekte darf als bewegt, welcher als ruhend angesehen werden? Die sRT führt dazu die Position des Beobachters ein. Was schon an sich abstrus ist. Denn das Ganze kann ja auch „von außen“, von einem Dritten beobachtet werden. Und schon haben wir drei verschiedene mögliche „Zeitdilatationen“. Schaltet man sich gedanklich („Gedankenexperiment“!) zwischen den verschiedenen Beobachter um, ändern sich damit ständig die physikalischen Befunde (Längen, Zeitverläufe) für jedes der Objekte – zumindest nach sRT.
Und Zeitdilatation wurde noch nie gemessen. Was gemessen wurde und wird ist die unterschiedliche und sich ändernde Signalankunft von sich relativ (zum „Beobachter“) bewegenden Signalquellen.
Die Signale der Pioneer-Sonde 10 bzw. 11) treffen mit immer weiter sinkenden Frequenzen ein weil jeder weitere Impuls von einem weiter entfernten Punkt abgestrahlt wird. Aber das nichts mit deren Geschwindigkeit zu tun – bzw. nur indirekt aufgrund der damit verbundenen Abstandsänderung, da die Pioneer-Sonden von uns wegfliegen.
„Die Sonden bewegen sich relativ zur Erde mit einer Geschwindigkeit, so dass durch den speziell relativistischenDoppler-Effekt eine Frequenzverschiebung stattfindet. Genauer gesagt handelt es sich wegen der zunehmenden Entfernung der Sonden von der Erde um eine Doppler-Rotverschiebung (zweite Gleichung im Eintrag Doppler-Effekt), so dass die Sonde eine kleinere Frequenz des von der Erde kommenden Radiosignals misst. “
Das „relativistisch“ ist natürlich Quatsch und der Zeitidiotie geschuldet. Es handelt sich schlicht um den Dopplereffekt, hier „doppelter Doppler“, weil ein Signal hin und wieder zurück geschickt wird.
h#ttps://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/pioneer-anomalie/345
„so dass die Sonde eine kleinere Frequenz des von der Erde kommenden Radiosignals misst. “ Ja, selbstverständlich, kann man da nur sagen. Nur hat das nichts mit dem Relativitätsquatsch zu tun. Doppler eben!
da Krim interessiert scheint will ich ihm mal das „Zwillings-Paradoxon“ analysieren:
die Geschichte ist bekannt: ein Zwilling bleibt auf der Erde, „in Ruhe“, der andere (Raum-)Zwilling fliegt mit einem Raumschiff eine Rundreise durchs All. Wenn der Raum-Zwilling zurückkehrt auf die Erde sei er jünger als sein Erd-Zwilling, weil sRT. Soweit das „Paradoxon“ (tatsächlich einfach nur reiner Unsinn, Gedankenspinnerei eben).
Die sRT bestimmt den Erd-Zwilling zum ruhenden Beobachter, den Raum-Zwilling zum bewegten Objekt der damit der Zeitdilatation ausgesetzt wäre. Das Problem für die sRT: wenn man den Raum-Zwilling als Beobachter wählt (wogegen nichts spricht), so kann er sich, zumindest in den Phasen der unbeschleunigten Bewegung, selbst als ruhend ansehen. Was zur Folge hat, dass der Erd-Zwilling dann relativ zu ihm in Bewegung ist und daher der Erd-Zwilling der Zeitdilatation ausgesetzt wäre. Ergo wäre der Erd-Zwilling bei der Rückkehr der Jüngere. Nun ist es schwierig wenn sowohl der Erd-Zwilling jünger sei wie der Raum-Zwilling und zugleich der Raum-Zwilling jünger sei als der Erd-Zwilling. Das ist keine Paradoxie sondern schlicht unmöglich! Eine Antinomie! Das in der Logik absolut Ausgeschlossene: es gelte sowohl A als auch nicht-A. Unmöglich!
Um dieses Problem auszuschalten wird nun behauptet, die Beschleunigungen denen der Raum-Zwilling ausgesetzt wäre seien der Grund dafür, dass eben nur der Raum-Zwilling der nach der Rückkehr jüngere sein könne.
Schauen wir uns das mal an: der Rundflug des Raum-Zwillings besteht, abgesehen von Richtungs-Aspekten aus zweierlei Bestandteilen:
a) Beschleunigungen (Start, Umkehr, Landung – auch Abbremsung ist eine (negative Beschleunigung)) und
b) unbeschleunigte Bewegungszustände, nämlich einmal von der Erde weg und einmal zur Erde hin.
Nun gilt nach dem korrekten Relativitätsprinzip (das viel älter ist als Einstein), dass unbeschleunigte Bewegung nicht von Ruhe unterscheidbar ist. Denn wenn sich zwei Objekte unbeschleunigt annähern oder voneinander entfernen ist nicht entscheidbar, welches Objekt sich bewegt, oder ob sich beide bewegen. Nur dass sich keines der Beiden bewegt ist ausgeschlossen. Die sRT „löst“ dieses Problem, indem es den Beobachter als Ruhenden erklärt. Aber wer ist denn der Beobachter? Das ist völlig frei wählbar. Also ist da gar nichts gelöst. Jeder in einer unbeschleunigten Bewegung Begriffene darf sich als ruhend ansehen.
Der in unbeschleunigter Bewegung begriffene, als ruhend angesehene Raum-Zwilling altert also in diesen Phasen „normal“ während der Erd-Zwilling in diesen Phasen langsamer alter (die spiegelsymmetrische Situation dazu, wenn man den Erd-Zwilling als in Ruhe betrachtet). Der Erd-Zwilling bleibt als in diesen Phasen gegenüber dem Raum-Zwilling im Altern zurück. Er altert langsamer. Würde der Raum-Zwilling ohne Beschleunigungen auskommen und seinen Erd-Zwilling treffen können, er wäre der Ältere.
Also die Beschleunigung muss diese uneindeutige Situation physikalisch eindeutig klären. Aber das kann sie nicht. Selbst wenn wir der Beschleunigung einen Effekt in dem Zusammenhang zuschreiben würden (was sie nach der Allgemeine RT ja angeblich sogar hat, ändert aber an dem nachfolgend ausgeführten nichts).
Tatsache ist: wenn wir den Raum-Zwilling als Beobachter wählen, dann wird er in den unbeschleunigten Bewegungsphasen älter als der Erd-Zwilling. Die Beschleunigungsphasen müssten das überkompensieren und eine „Verjüngung“ des Raum-Zwillings bewirken, so sehr, dass der Raum-Zwilling bei der Rückkunft doch wieder jünger als der Erd-Zwilling sein solle.
Man kann nämlich die Reise des Raum-Zwillings beliebige ausdehnen, ohne dass sich dabei an den Beschleunigungsphasen etwas ändert. Sprich: man führt mehrere solche Reisen durch, alle mit den gleichen Beschleunigungs-Werten und -Dauern, aber die unbeschleunigten Bewegungs-Phasen werden immer länger und länger gemacht. Mit irgend einer Länge während der sich in Ruhe sehenden Raum-Zwilling schneller altert als der Erd-Zwilling würde der (vermeintliche) Effekt des Langsamer-Altern durch die Beschleunigungen überkompensiert werden. Bei einer gewissen Reiselänge käme der Zwilling doch wieder gleichaltrig an. Bei noch längeren Reisen käme der Raum-Zwilling ÄLTER als der Erd-Zwilling an.
Ja, das ist Hirn-verdrehend. Aber schließlich konnte sich der Schwachsinn genau deshalb auch nur so lange halten.
######
IN KURZ: nach der sRT wäre der Zwilling im „Zwillings-Paradoxon“ der der Ältere, der sich als Beobachter ansehen würde – ungeachtet von Beschleunigungen (über die die sRT nichts aussagt). Und selbst wenn man einen Effekt der Beschleunigung annimmt, so wäre, sobald man die unbeschleunigten Bewegungsanteile im Verhältnis zu den Beschleunigungen sehr, sehr groß machen würde, die möglichen Effekte der Beschleunigung also im Verhältnis unbedeutend klein, die Situation nicht entscheidbar: wer war mehr (länger, schneller) in Ruhe, wer war mehr in Bewegung? Das ist alles relativ! Tatsächlich. Und damit unentscheidbar.
Das innewohnende, Hirn-verdrehende Phänomen ist, dass man automatisch und unbewusst den Erd-Zwilling als den Ruhenden ansieht – was er aber nach dem Relativitätsprinzip gar nicht zwingend ist. Und selbst die Beschleunigungen (Start, Umkehr, Landung) identifizieren den Raum-Zwilling nicht automatisch als, physikalisch gesehen, Bewegten. Auch das ist nur ein alltägliches, freilich verständliches Vorurteil, zumindest physikalisch gesehen. In jeder nicht-beschleunigten Phase des Experiments ist der in Ruhe, der sich als in Ruhe befindlich sehen will. Und damit altert jeder gerade so, wie es ihm gefällt – was jeder Vernunft und jeder Physik widerspricht. Wie die ganzen Einsteinschen Relativitätstheorien.
@Dirk, @El-G
Die erste und übergreifende Schwäche des Postings, das El-G gestern 16:52 bemeckert hat, hat wohl darin bestanden, daß ich es nicht mit einem Titel versehen hatte, der das Thema korrekt benennt: Erkenntnistheorie (primäre Schritte).
Damit war es ein Anschluss an ein sehr weit oben stehendes Posting, in dem ich geschrieben hatte:
Dirk hatte darauf geschrieben:
Ich war darauf nicht eingegangen, weil Dirk meine Darstellung falsch aufgefasst und wieder gegeben hat. Anscheinend kommt er mit der einfachsten Form einer physikalischen Formel, einem Bruch, der eine Proportion verschiedener Größen ausdrückt, nicht klar. Das korrekte Zitat hätte lauten müssen:
E / mc² = 1
Dirks Version ist physikalisch blühender Unfug, und indem er auf diesen noch eine „Charakterisierung“ gebaut hat, die „physikalisch“ zu sein behauptet („setzt voraus“), hat er gezeigt, er kennt überhaupt keine physikalischen Zusammenhänge, sie sind ihm vielmehr sprachliches Spielmaterial für philosophische Deutungen und Erwägungen.
Allerdings sollte man das Dirk nicht über die Maßen ankreiden, denn eine generelle Schwierigkeit des Themas ist, daß viele theoretischen Physiker in beträchtlichem Maße dasselbe machen und die populäre Darstellung ihrer Formeln und Überlegungen diese Ungegenständlichkeit vieler Ausdrücke theoretischer Physiker noch potenziert.
Das primäre Gegenmittel gegen solche Un-Sachlichkeit habe ich von meinem ersten Mathematik / Physik -Lehrer im Gedächtnis behalten, der uns jede Stunde einschärfte, nicht „Äpfel mit Birnen zu velwachseln“, und zu diesem Zweck die Einheiten hinzuschreiben, für die Zahlen oder Variablen stehen sollen. Im vorliegenden Fall wären das Joule resp. Newtonmeter im Nenner und Newton im Zähler. Wenn das gemacht ist, kann man sich Mahnungen von der Sorte „ontologisches Mißverständnis“ streng genommen sparen, denn dann ist in der Formel indiziert, daß sie ein Maßverhältnis repräsentiert, keinen Zusammenhang von Gegenständen „an und für sich selbst“, und daß die einzige verfügbare (experimentelle) Prüfung dieses Maßverhältnisses es selbst ist, d.h. bestenfalls die Frage beantworten kann, ob dies Maßverhältnis immer und überall da gilt, wo Messungen möglich sind, oder eben nicht gilt – period.
Wenn die experimentellen Physiker dann Messresultate produzieren(!), die mit einem in einer Formel festgehaltenen Maßverhältnis nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, muß geklärt werden, ob – und jetzt kommt der Übergang zu meinem erkenntnistheoretischen Posting – das Experiment die Abstraktion des in die Gestalt der Formel gebrachten Maßverhältnisses an den fraglichen Gegenständen darstellt, also reproduziert, oder nicht reproduziert. „Nicht reproduziert“ heißt einfach: Die Messungen könnten durch unbekannte oder unbeachtete Faktoren zustande gekommen sein, die in der abstrakten Formel des Maßverhältnisses gar nicht angesprochen sind und in ihr folglich nicht ->indiziert sein können.
Verallgemeinerung: Gegenstand der Physik, ob experimentell oder theoretisch, sind immer und überall nur Maßverhältnisse, also Beobachtungen. Weshalb die Arbeit und Leistung der Physiker nur darin bestehen kann, Beobachtungsgegenstände zu identifizieren, d.h. voneinander zu trennen, und hernach die getrennten Beobachtungen („Phänomene“) in einen möglichst experimentell prüfbaren epistemischen („Erkenntnis zum Gegenstand habenden“) Zusammenhang zu bringen.
Die philosophische Frage, die an diese Arbeit der Physiker immer gestellt wird – und die Dirk, Ratze und El-G einzig umtreibt – lautet:
„Ist der dargestellte epistemische Zusammenhang identisch mit einem Zusammenwirken „realer“ Kräfte, also mit Vorgängen, die nicht beobachtet sind, oder nicht.“.
Und diese Frage ist rundweg dumm. Diese behauptete Dummheit war und ist mein Gegenstand!
Warum soll sie dumm sein?
Weil eine Nichtidentität der epistemischen Zusammenhänge mit den unbeobachteten, fälschlich als „real“ bezeichneten (sind Beobachtungen etwa kein „realer Vorgang“), Vorgängen der ganzen Scheiße doch bitte voraus gesetzt ist – ja, es ist ihr allgemeiner Grund.
Doch ebenso allgemein wie dieser Grund ist der Zweck wissenschaftlicher Tätigkeit: Beseitigung der Nichtidentität.
Deshalb schrieb einst ein Hegel lapidar zu der dummen Frage:
„Die einzige Voraussetzung, die in der Wissenschaft zu machen ist und zu gelten hat, ist, daß sie geht“
Sonst treibt man halt Philosophie, keine Wissenschaft!
„Daß sie geht“ heißt nun praktisch nichts anderes, als daß ihr Ausgangspunkt, die Nichtidentität von auf Beobachtungen gegründeten Vorstellungen und Vorgängen „an und für sich selbst“, ein Schein sei. Bzw. genauer eine Erscheinungsform dieses „an und für sich selbst“ der Gegenstände sei, mit denen es ein Beobachter zu tun hat.
Das heißt aber umgekehrt, daß diese Erscheinungsform unüberwindbar bleibt. Sie kann allenfalls verändert werden.
Ziel solcher Veränderung ist dann logischerweise – nicht „real“ – ein Verhältnis zwischen primären und sekundären Erscheinungsformen darzustellen und dem Vergleich beider zu unterstellen, daß die Vergleichsdaten Eigentümlichkeiten des Beobachtungsgegenstandes zutage fördern, die unabhängig vom Beobachtungsvorgang sind.
Was soll der Grund der Unterstellung sein?
Das ist simpel und hatten wir im Grunde schon in der Formel E / mc²=1:
In dieser Proportion stehen verschiedene und voneinander unabhängige Messungen, also Beobachtungen, sowohl im Zähler, als im Nenner, und das heißt epistemologisch eben tat-sächlich:
Die Qualität „beobachtet“ ist aus der Proportion heraus zu kürzen und dann bleibt das numerische Zeichen für Identität, die Eins.
Aber ich wiederhole sicherheitsnadelhalber: Damit ist über ein „An und für sich“ weder von Masse noch Energie eine Ausage getroffen, nur über eine qualitativ UND quantitativ validierte Erscheinungsform ihres Zusammenhanges, mit der weiter zu arbeiten ist, die neue epistemische Grundlage wird.
Jetzt ist dies Posting schon so lang geworden, und hat mich so viel Zeit gekostet, daß ich die Darstellung und Diskussion des Zusammenhangs des oben Gesagten zu meiner von El-G angemeckerten Darstellung verschiebe.
Das Gewäsch mündet in der Behauptung, „E“ und „mc²“ seien „Messungen, also Beobachtungen“.
Peinlichere Blödheit geht wohl kaum noch. Obwohl, das Qana erweist sich als in allem Steigerungsfähig – nach unten.
Kannst du die „Blödheit“ identifizieren? … oder weißt du ausschließlich zu pöbeln …
Also sowas von lächerlich. Muss man Dir das auch noch erklären, was man sagt?
„Das Gewäsch mündet in der Behauptung, „E“ und „mc²“ seien „Messungen, also Beobachtungen“.“ bedeutet genau in der offensichtlich implizirten Aussage:
„E“ und „mc²“ sind NICHT Messungen/Beobachtungen!
Natürlich nicht. Messungen ergeben Werte, Zahlen mit Einheiten. Keine Formelzeichen.
Wer Messungen nicht mehr als konkrete Einzelereignisse versteht, versteht von Naturwissenschaften rein überhaupt gar nichts.
Nun, ich bin kein Experimentalphysiker. Ratze ist offenkundig auch keiner. Denn sonst wüßte er, daß die fragliche Formel in Synchrotron-Experimenten darstellbar sein sollte.
Experimentalphysik ist ein Handwerk ein potenziertes Handwerk obendrein, weil die benutzte Technologie gesondertes handwerkliches Produkt. Wer damit nicht beruflich befaßt ist, bleibt außerstande, die Experimente und ihre Resultate zu beurteilen.
In Synchrotronexperimenten werden identifizierbare Teilchen mit messbaren Energien kollidiert, und zwar derart hohen Energien und also resultierenden Geschwindigkeiten, daß sie zerlegt werden und dabei andere Teilchen entstehen, u. a. Elektron / Positron Paare, die einander auslöschen. Der Kollisions- Teilungs- und ggf. Auflösungsprozess wird in sog. „Nebelkammern“ dargestellt und vermessen. Ich weiß noch nicht mal, was das ist, eine „Nebelkammer“.
Ich weiß aber, daß hundert Tausenden Experimentalphysikern auf der Welt nicht 10 Tausende von GI’s beigeordnet sind, die mit Parabellums, Maschinenpistolen und Folterkammern mit Waterboarding und Elektroschöcks darüber wachen, daß auch ja die GRAND CONSPIRACY nicht angetastet wird, die Ratze für zuständig und verantwortlich für die Verbreitung der Formel E= usw halten will.
Also empfehle ich Ratze, entweder das Thema zu lassen, oder das Irrenhaus seiner Wahl aufzusuchen.
„Ratze ist offenkundig auch keiner“
Na, da sieht man ja wieder die Allwissenheit des Qana. Danke dafür, dass Du Dich so entblödest. Einen besseren Bärendienst für diesen Schwachsinn kannst Du gar nicht leisten.
„mit Waterboarding und Elektroschöcks darüber wachen, daß auch ja die GRAND CONSPIRACY nicht angetastet wird,“
Das lächerlichste aller „Argumente“ – und kommt an der Stelle immer!
Mal ein Besipeil, wie das auch ohne Waterboarding geht:
Über eine Zeitraum von über 80 Jahren galt das Verdikt: „es gibt keine adulte Neurogenese!“ Denn dieses Verdikt vuwrde von einem Nobelpreisträger (Santiago Ramón y Cajal) ausgesprochen, galt als sakrosankt. Bis es eben überhaupt nicht mehr haltbar war und zusammengebrochen ist. Bis dahin hat es aber viel Unheil angerichtet. Nicht nur dass Akademiker-Kariieren verunmöglicht wurden weil jemand an der Autorität gekratzt hat. Nein. Das wurde zB auch als Argument genutzt warum man Alkoholikern nicht helfen wollte, in der Nazizeit sogar als unwertes Leben ausgerottet hatte, weil ja die unheilbar geschädigt gewesen wären.
Und das ist NUR EIN, und vor allem ein heute AUFGEDECKTES Beispiel dafür, was sich und wie lange als Unsinn in der Wissenschaft halten kann – ohne jedes Waterboarding – einfach nach dem Autoritätsprinzip und Rückgratlosigkeit derer, die in der Forschung Karriere machen wollen.
Wie viel Unsinn – neben den Relativitätstheorien – hält sich und wurde eben einfach noch nicht als falsch entlarvt?
Es ist eine in Fachkreisen ungeleugnete Tatsache, dass der Fortschritt der Wissenschaften seit Jahrzehnten stagniert. Woran mag das liegen? Vielleicht an dem vielen Unsinn, den man da inzwischen angesammelt hat.
Ratze wechselt das Thema, wie das immer an solcher Stelle geschieht.
Ich hab kein Problem damit, daß jemand bilanziert, auch in den wissenschaftlichen Disziplinen, die gemeinhin für „exakt“ gelten (wollen), würden Mythen, Erzählungen und Dogmen mit ideologischem Hintergrund oder Zweck produziert. Ich habe oben eine Unterhaltung mit Denis Noble verlinkt, der genau das für Genetik und Evolutionstheorie behauptet und begründet.
Doch der begründet das halt. (Sagt, wie das zugegangen ist)
Und ich selbst kann begründen, warum ich seine Argumentation für stichhaltig halte und daher auch für zureichend für den Bereich, in dem sie gilt, nämlich die wissenschaftlichen Disziplinen und den zugehörigen professionellen Betrieb, die er adressiert. Über die Gründe, die es außerhalb dieses Bereiches gibt, also den breiteren Zusammenhang, weiß Noble auch einiges zu sagen, was ich für teilweise korrekt, also unvollständig halte. Anderes Thema, wie gesagt.
Also geh‘ mit deinem Strohmann ins Irrenhaus, Ratze, vielleicht kriegt er da neue Kleider …
Hier fehlt eine Antwort von mir, na egal. Den Anwurf, ich würde das Thema wechseln kann jeder selbst als falsch erkennen.
Das Thema, das sogar von Qana selbst aufgeworfen wurde, war sein „GRAND CONSPIRACY“(-Strohmann) weil es sonst angeblich keine anhaltenden Falschbehauptungen in der Wissenschaft geben könnte. Und genau darauf habe ich geantwortet mit meinem Beispiel.
Also …
PS.: In meinem EP sind in einem Satz Zähler und Nenner vertauscht. Ohne Belang für die Argumentation.
Kein Ratze hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Was für ein Elend …
Was soll man im Qana-Qualm nach lässlichen Fehlern suchen, lächerlich. Das Ganze ist der Fehler, die kleinen Detail-Fehler kommen höchstens noch dazu.
Seltsam, das gerade bei mir bei „letzte Kommentare“ von Qana angezeigt Posting „Qana vor 13 Minuten“ mit einer grau unterlegten „12“ (Kommentare-Anzahl zur Zeit des postens?) lässt sich in dem von mir mit dem Link aufgerufenenen Artikel nicht finden (auch nicht mit komplett aufgeklappten Kommentaren).
Fängt das also schon an: wenn die Wahrheiten zu bedrohlich werden folgt „shadow-banning“.
Wie schon einmal bemerkt: die Zukunft des Internets ist eine für jeden eigens und extra angezeigte „Realität“. Jeder sieht etwas anderes, denkt aber, alle anderen würden dasselbe sehen. Eine perfekte „KI“-Aufgabe. Wenn das nicht sogar genau dafür erfunden wurde: eine digitale Schein-Öffentlichkeit, ein digitaler Schein-Kommunikationsraum, eine Schein-Welt eben.
Okay. Jetzt ist das Posting von Qana da. Aber erst nach neu laden.
Seltsamer Effekt: nach klicken auf einen Link in „neueste Kommentare“ komme ich zu dem Artikel OHNE den angefragten Kommentar. Erst neu laden gibt den gesuchten Kommentar dann mit aus.
zu Qana
gestern 15:34 Uhr
Das Qana wird immer witziger. Ich belege mit einem Beispiel, dass seine Andeutung, Falsches sei in den Wissenschaften nur mit Gewalt und Verschwörung zu halten, falsch ist – und er behauptet, ich hätte das Thema gewechselt.
Auch das ist eine bekannte Methode, ein unliebsames Thema abzuwürgen: völlig haltloses Zeug zu bringen, so dass keinerlei sinnvolle Reaktion mehr möglich ist.
Mein Beispiel mit dem spanischen Nobelpreisträger offenbart aber die ganze Tragweite des Problems, denn: wer kennt schon Santiago Ramón y Cajal (oder hält den vielleicht eher für den Erfinder des Cajal-Stiftes)? Und dennoch hat sein Verdikt über 80 Jahren lang der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung widerstanden. Und war keineswegs unbedeutend, wie ich aufzeigte: nicht nur Nazis sondern auch Eugeniker in GB und USA zogen menschenverachtende Schlüsse mit einer angeblich wissenschaftlichen Begründung.
Und nun sehen wir zum Vergleich auf Einstein: ein weltweit bekannt gemachter Name, ein massiv-medial aufgebautes Idol, ein angebliches Genie, wie es uns schon im Kindergarten eingebläut wird. DER angebliche Ausnahme-Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Eine Überhöhung eines Menschen, wie sie in einer aufgeklärten, rationalen Gesellschaft eigentlich völlig unmöglich sein müsste. Und das bei einem Menschen, der Naturwissenschaften zu Farce gemacht hat, indem er „Gedankenexperimente“ einführte und damit Experimente als Erkenntnisgewinn-Instrument auf die hinteren Plätze verwies. Vor Planck und Einstein gab es kaum einen theoretischen Physiker, alle waren Experimental-Physiker. Heute gibt es unzählige Lehrstühle für theoretische Physik – und Experimentalphysik ist auf den Rang einer Hilfswissenschaft degradiert worden. (Wie überhaupt man sich nicht mehr die Finger schmutzig machen mag in bestimmten Kreisen. Am Computer sitzen ist doch viel „cooler“ als irgendwo im Dreck und Gestank, in unbequemer Haltung, und oft genug ergebnislos, herumzuschrauben. Und modellieren und simulieren und phantasieren ist ja „offiziell“ gesellschaftlich als angeblich wertvolle Arbeit anerkannt, wid hoch honoriert, finanzielle und mit Ansehen und Würden.)
Experimentalphysiker sind nur noch dazu da, die Theorien von abgehobenen Theoretikern mit allen Mitteln und Tricks zu „bestätigen“. Zeigt das Experiment etwas anderes als die Theorie, ist das Experiment falsch – nicht die Theorie. Das ist die heutige Situation. Und in diese Situation haben sich die heutigen „Wissenschaftler“ eingerichtet. Ganz ohne Waterboarding – sondern einfach aufgrund von Reputations- und Karrierezielen.
Heute forscht ein Wissenschaftler nicht mehr daran, was ihn interessiert, sondern daran, was nach irgendeinem „Ranking“ die größte Aufmerksamkeit erregt, die höchsten Fördermittel einbringt. Ja, das ist extrem formuliert und überspitzt. Aber anders kann man den Zustand nicht als unhaltbar wie er ist charakterisieren.
Ratze,
Erstens mißverstehst du Konzept, Inhalt und Funktion von „Gedankenexperimenten“, aber das laß ich für den Moment stecken, da ich eine taugliche Erklärung dazu schuldig bin – das was El-G angemeckert hat, war grad mal ein Auftakt solcher Erklärung.
Zweitens: Was du über das Verhältnis von Experimentalphysik und theoretischer Physik „extrem formuliert und überspitzt“ geschrieben hast, ist gar nicht extrem und überspitzt – es stimmt für wohlbestimmte Teilbereiche der Physik, namentlich alles, was Verbindung zur „Kosmologie“ hat oder haben / bekommen soll, die eine Theologie ist, wortwörtlich.
Aber eben „wohlbestimmte Teilbereiche“ – denn du unterschlägst komplett, daß Experimentalphysik DIE Säule der Technologieforschung ist. E=usw ist keine kosmologische Formel, sie dient auch nicht „bloss“ zur Grundlage astrophysikalischer Technologien, sie ist, soviel ich ohne Detailkenntnisse sagen kann, Bestandteil der Grundlagen von Plasmaforschung und Teilbereichen der Festkörperpysik. Und jeder fachlich genügend ausgebildete Mensch kann sich die Daten zugehöriger Experimente, z.B. der Synchrotron-Experimente, auf seinen Rechner laden und ihre Plausibilität hinsichtlich dieser Grundformel überprüfen.
Drittens: Aber auf Erstens zurück kommend hätte ich tatsächlich die Sache des Gedankenexperimentes halbwegs korrekt zu behandeln, um diese Argumentation „rund“ zu machen. Die Erfahrung hier, mit dir und El und ausbleibenden Kommentaren, demotiviert mich allerdings stärkstens.
ist auch besser so. Noch mehr Qana-Qualm verträgt dieser Kommentarbereich gewiss nicht gut.
Aber eigentlich warst Du doch schon längst fertig, erinnere ich mich irgendwie …
Rudimentäre Argumente zu „Gedankenexperiment“
meinen abstrakt-allegemeinen epistemischen Kommentar, hier:
https://overton-magazin.de/top-story/zwischen-leerstelle-und-logik/#comment-320800
hatte ich angehoben mit:
Solche Abstraktion, elementar die zweidimensionale optische Repräsentation eines dreidimensionalen Rauminhaltes, die hinsichtlich der Organik der Augen und der zugehörigen neuronalen Abschnitte des visuellen Kortex zwar „aktiv“ genannt werden muß, denn die visuelle Repräsentation ist kein physischer Spiegel, eine Spiegelung, wenn wir sie vorerst so nennen wollen, wird nicht „erlitten“, sie wird hergestellt (primär erstmal Drehung um 180°), aber solcher Repräsentation in einem ersten Schritt passiv Daten liefert.
Solche Passivität heißt erkenntnistheoretisch banal: Der visuelle biologische Apparat ist ein Reflex der gegenständlichen Umwelt eines Lebewesens, desjenigen Teiles von ihr, der Gegenstand des Fachbereichs Optik in der Physik ist. Wiewohl doch zugleich unterstellt ist, es handelt sich um anderes und mehr als ein reflektierendes Aggregat im Sinne eines gesonderten Bestandteiles, wie eine Spiegeloberfläche es ist.
Dies „andere und mehr“ kommt z.B. simpel zur Erscheinung, wenn der visuelle Cortex dem Lebewesen befielt, den Kopf zu drehen, wenn da etwas interessantes oder irritierendes am Rand des Sichtfeldes auftaucht oder geschieht.
Ich hatte angehoben, die logischen Schritte dieses Zusammenhanges abzuleiten, das lasse ich angesichts des kindischen Widerstandes („kann doch weg“) und mangelnden Interesses fallen
Für jetzt halte ich einfach fest: Das, was ein halbwegs aufgewecktes Kind über die Arbeit des visuellen Cortex lernt, erlaubt das gesicherte Wissen, es handele sich im Zusammenwirken mit dem restlichen sinnlich-motorischen Apparat um ein physikalisches Antizipationsorgan, hergestellt „mit evolutionsbiologischen Mitteln“!
Mit anderen Worten: Dieser Gesamtapparat ist ein Produkt biologischer sedimentierter Arbeit nicht weniger, als es physisches und physikalisch zu beschreibendes Produkt der Physik und Chemie des Sonnentrabanten namens „Terra“ ist, die wiederum ein Produkt der Physik und Chemie der Entstehung UND des Vergehens von solaren und anderen „Energie- und Materiekonvertern“ in der sogenannten „Milchstraße“ sind.
Und folglich ist Antizipation der einzige Erkenntnisweg, den es hat, und das einzige Erkenntnisresultat, das es gibt. Das gilt für die notorische Logik nicht weniger, als die notorische Wahnehmung, die haben nur unterschiedliche Pfadintegrale
Schluß jetzt, dumm und verbiestert bleibt ihr auch ohne mein Zutun.
Oh Gott, der, nach anderweitiger Ankündigung, erwartbare noch-mehr-Qana-Qualm.
Das Offensichtlich – dass „Gedanken“ und „Experiment“ Gegensätze sind, die sich freilich ergänzen, aber nicht im „Gedankenexperiment“, das ein Widerspruch in sich ist – wird mit viel Qualm und Gedöns versucht, unkenntlich zu machen.
Merkst du eigentlich gar nicht, wie du dich hier völlig unmöglich machst … Hälst du dich für den Ritter, der noch die in Fetzen hängende Fahne seines Königs hoch hält, wo alle um ihn rum und der König längst tot sind, und glaubt, damit würde er den Kampf für seine Seite entscheiden, wenn er nur nicht aufgibt?
Du könntest für die Mitwelt erklären, was dies:
aus dem „Qualm“ hervor heben soll.
Nur eine Idee will ich noch mitteilen, auf die ich tatsächlich gestern erst gekommen bin.
Denis Noble macht keine Angaben, welche Quelle der Gesamtaktivität einer Zelle, ihre „agency“ (Subjektdasein), gemäß plausiblen Vermutungen haben könnte.
Ich habe mich gefragt: Warum nicht – freilich auf vermittelte Weise – enzymatische Reaktionen?
Ein wesentlicher Bestandteil meiner Idee ist die räumliche Plausibilisierung zellulärer Vorgänge gewesen, Denis sagte, wenn sich der Zellkern (mit der DNA) faustgroß in der niederländischen Universität befände, in der das Interview stattfand, läge die Zellwand in Paris.
Enzymatische Umsetzungen haben einen Haufen Trajektorien in der Zelle mit ihren Organellen, und folglich sollten sie physikalisch eine Menge gerichteterzirkulativer Prozesse im Zellraum durchlaufen, auf deren Wegen sie konformativ verändert werden. Und schon liegt wieder das Muster einer „Aufladung“ vor, das ich philosophisch abstrakt „Zirkulation der Begierde zwischen Hingabe und Aneignung“ nenne, aber in einer stofflichen Elementarform, nicht in der Rolle einer Vermittlung.
Der primäre Effekt aber besteht einfach darin, daß enzymatische Prozesse eine geschlossene Thermodynamik innerhalb der Zelle vermitteln, die der Thermodynamik des halboffenen Systems zwischen Zelle und Umwelt ZUGLEICH entgegen wirkt, wie sie sie aufrecht zu halten hat. Folglich enthält das enzymatische System der Zellreproduktion etwas, das dynamisch einer Zweckbestimmung analog ist – mit entsprechenden Folgen für die Rolle der Organellen und Trajektorien und damit alle dynamischen Vorgänge in der Zelle. Abstrakt genommen wäre damit ein Überdauerungs- und Reproduktionszweck intrazellulär etabliert, der in erster Instanz unabhängig von Wirkungszusammenhang zwischen zellulärem Organismus und seiner (von ihm selektierten!) Umwelt ist, was für die Folgedynamik heißt, der enzymatische Apparat, mit allem was dranhängt, gerät in seiner Gesamtheit in Wechselwirkung mit der Umwelt, vermittelt durch interne Regulationsprozesse.
Nun, letzteres kennen wir in voller Entwicklung im Stoffwechsel funktional stark diversifizierter Mehrzeller.
Eine Idee, wie gesagt, und ich bin garantiert nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Ich werde dem nicht nachgehen, weder habe ich Zeit noch Lust, auf meine alten Tage Biochemie zu studieren.
zu El-G
gestern 21:11 Uhr
Anderes Beispiel für offensichtlichen Unfug:
angeblich würden Kerne radioaktiver Elemente „spontan“, wie man das nennt, zerfallen. Damit ist das erste Mal in der Geschichte der Neuzeit ein _akausales_ Moment in die Physik eingeführt worden. Wir kennen das von der Geschichte mit „Schrödingers Katze“ her: die Katze in der Kiste würde im Schwebezustand zwischen Leben und Tod existieren, da der konkrete Zustand der Katze von dem Zerfall eines radioaktiven Kerns abhängen würde. Dieser Schwebezustand wäre erst beendet, wenn durch eine Beobachtung die „Wellenfunktion zum Zusammenbruch“ gebracht werden würde. Auch hier wieder auffällig die Rolle des Beobachters.
Das Problem mit dem „spontanen Zerfall“: man könnte einen solchen spontanen Zerfall nur dann nachweisen, wenn sich _ALLE MÖGLICHEN_ kausalen Einflüsse auf die Kerne ausschließen lassen würden.
Wir wissen aber sogar, dass genau das unmöglich ist. ZB Neutrinos lassen sich nicht abschirmen. Ganz davon abgesehen, dass wir andere schwach wechselwirkende Teilchen vielleicht noch gar nicht kennen. Dass das Standardmodell alle existierenden Teilchen erfassen müsse, ist auch nur Wunschdenken des überheblichen, ordnungsfanatischen Menschens.
Also folgendes Modell: radioaktive Elemente sind bekanntlich instabil, also in einem Zustand der leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann. Angenommen, ein oder mehrere Neutrinos – oder andere, noch unbekannte schwach wechselwirkende Teilchen – müssten nur in einer ganz bestimmten Weise auf so einen instabilen Kern treffen um diesen damit _kausal_ zum Zerfall zu bringen.
Wie gesagt: die moderne Physik kann diese Möglichkeit nicht ausschließen, da sie experimentell nicht verifizierbar oder falzifizierbar ist. Damit ist aber die ganze Rede über Akausalität in der Natur gegenstandslos, weil ungewiss. Damit bricht aber auch das ganze Theoriengebäude der Quantenphysik ein.
Das heißt nicht, dass alles falsch sein müsste – aber dass vieles falsch sein könnte! Und einiges ganz gewiss.
Hier sind gleich mehrere Klöpse zu bewundern, aber derjenige, der von allgemeinem Interesse sein dürfte (zumindest aus kindlicher Sicht) betrifft das Konzept „Kausalität“.
Derjenige, der Ratzes Vorstellung von Kausalität richtig stellt, bekommt von mir ein besonders schönes musikalisches „Danke“.
@ratzefatz
Nun, Sie sagen es ganz richtig, nur weil eine Ursache unbekannt ist, heißt das nicht, dass sie nicht existiert. Allerdings sind viele Vorhersagen aus der Quantenphysik beobachtbar, auch wenn sie nicht hinreichend erklärbar sind. Dann gleich von einem vollständigen Zusammenbruch des Theoriegebäudes zu sprechen, ist doch wieder etwas weit gegriffen.
Gut, wenn eine Theorie weder verifizierbar noch falsifizierbar ist, dann ist es eine sch…lechte Theorie. Und es wird Zeit, eine bessere zu finden. Gegen Mauern zu schreien „ich habe recht und ihr seid blöd, verblendet, ignorant“, macht nur einen kratzigen Hals.
Und wenn ich mich recht erinnere (?), sagten Sie einerseits, Neutrinos existieren gar nicht, sie seien ja auch nicht messbar, und anderseits sollen sie womöglich für den spontanen Zerfall von Atomen zuständig sein. Ist auch nicht alles so richtig konsistent, oder?
Letztendlich bin ich der Ansicht, dass wir uns erkenntnistheoretisch noch im Kindergarten befinden, aber wenigstens hat sich die Wissenschaft größtenteils von irgendeinem Göttlichen gelöst. Mir persönlich ist kein Wissenschaftler bekannt, der seine Arbeit als Religionsersatz begreift, vielmehr wird gesagt: Unbekannt ist nicht unerklärlich. Und nach einem Abend voller peinlicher Fragen mag ich dieses Lächeln zwischen spitzbübisch und hilflos, das nur sagt: »Ich weiß es doch auch nicht.«
Kann ich mit leben.
Wieso spiegeln sie mich so falsch?
Sie schreiben „Dann gleich von einem vollständigen Zusammenbruch des Theoriegebäudes zu sprechen,“ wo ich
„Damit bricht aber auch das ganze Theoriengebäude der Quantenphysik ein. Das heißt nicht, dass alles falsch sein müsste – aber dass vieles falsch sein könnte! Und einiges ganz gewiss.“ schrieb?
Das ist ziemlich mies referiert um es mal milde zu sagen.
Und dann noch „Und wenn ich mich recht erinnere (?), sagten Sie einerseits, Neutrinos existieren gar nicht, “ … nein, sie erinnern nicht recht, sondern ganz falsch. Was soll das? Wie wäre es, wenn sie in so einem Fall ihren Blick heben würden, und die paar Zeilen weiter oben einfach nachlesen würden bevor sie mich so verlogen falsch rezipieren?
Das ist insgesamt mehr als mies … das ist hinterfotzig.
Zu den Neutrinos: es gibt ja Neutrinos-Detektoren. Das sind riesige Tanks voll von einer hochreinen Flüssigkeit, tief unter der Erde (/Eis?), um die Einflüsse anderer Strahlungen/Teilchen zu minimieren. In dieser riesigen Masse blitzt hin und wieder etwas auf, was mit Photomultipliern registriert wird. Da wären die seltenen Momente wo _Eines von Milliarden Neutrinos_ zufällig genau so auf ein Elektron trifft, dass dieses im Energie-Niveau angehoben wird und dann beim wieder zurückfallen ein Photon aussendet. So habe ich das in etwa in Erinnerung.
Das ist genau das, was ich als Möglichkeit für die Auslösung von scheinbar zufälligem „spontanen“ Zerfall instabiler Kerne als Möglichkeit beschrieben habe. Warum sollte ein Neutrino nur ein Elektron, nicht aber einen instabilen Kern, beeinflussen können?
Weil dann die ganze Wissenschafts-Mystik heutiger Zeit in Frage gestellt wäre? Weil dann das „follow the science“ sich als die Idiotie entpuppen würde, die es ist?
Ja, genau so schräg funktioniert das!
Verzeihen Sie, ich hätte mir mit der Antwort mehr Zeit lassen müssen und meine Unsicherheit/Erinnerungen bezüglich Ihrer Posts vorher beseitigen.
Es war nicht meine Absicht, Ihre Ausführungen zu diskreditieren.
Sorry!!!
Soso? Achnee. Glaube ich sofort. So einem Pr-Fuzzie, immer.
Nun, das können Sie natürlich halten, wie Sie wollen.
Sie haben ja frühere miese Erfahrung angedeutet, von daher kann ich das Misstrauen verstehen.
Mein grottiger Post ist mir tatsächlich sehr unangenehm und hat mich den Tag über beschäftigt. Aber ich stehe dafür gerade, wenn ich Mist gebaut habe.
Deswegen noch einmal sorry.
PS: »Pr-Fuzzie« trifft es nicht wirklich und ist noch harmlos gegen das, was Sie mir in diesem Fall berechtigter Weise an den Kopf werfen könnten…
Eine Richtigstellung der Ratze’schen Vorstellung von Kausalität wäre für meine Begriffe eine grundsätzlich dankbare Arbeit, weil sie das aufklärerische Vorurteil dekonstruieren könnte, ja müßte, Aberglaube hätte was mit Unwissenheit zu tun und sei deshalb auflösbar, indem man dem Probanden ein genügend breites Wissen zur Verfügung stelle.
Das ist allerdings wohl eine etwas mühsame Arbeit. Ich hatte sie soeben in der Absicht angesetzt, sie so kurz wie möglich zu halten. Das mißlang und deshalb lasse ich es, falls sich niemand einklinkt.
Nun, Aberglaube könnte auch einfach eine „komfortable Entscheidung“ sein, wobei der Entscheider das „Aber-“ sicher streichen würde.
Prinzipiell würden mich die Ausführungen dazu interessieren, doch ist der Dezember immer mein intelektueller Null-Monat, wie ich die vergangenen Tage (auch dieses Jahr) wieder bewiesen bekommen habe.
Deswegen auch mein Schweigen zu vorherigen Ausführungen…
Ratze bekennt sich zu einer Fundamentalopposition gegen eine priesterliche Obrigkeit in naturwissenschaftlichem Gewand, daran ist erstmal nix aufzuklären. Ich kann nicht erkennen, was daran „komfortabel“ sein soll.
Fundamentalopposition hat die Macke, gewöhnlich auf ein antithetisches Verhältnis zum Angegriffenen nicht nur fixiert, auch fest gelegt zu bleiben, weil sie die zünftige Schranke, die ihr zugrunde liegt, jeder konkreten Befassung mit Aussagen und Inhalten voran stellt und diesen Aussagen und Inhalten damit einen rein methodischen Zweifel entgegen setzt. Auf im engeren Sinn religiösen Gebiet endet das gewöhnlich mit fundamentalistischen Umwertungen: Aus „gut“ wird „böse“, aus „verworfen“ werden Bauelemente eines Gegenkultes.
Schematisch erkennt man das bei Ratze an der fälschlichen Entgegensetzung von „Kausalität“ und „Akausalität“, die von keiner Kenntnis der Gegenstände und Sachverhalte, die er anführt, beleckt ist.
Aber dann kann man die Frage stellen: Warum genau diese Gestalt der zünftigen Opposition gegen Obrigkeit?
Vielleicht ist die Frage überflüssig, ich bin mir nicht sicher.
„Fundamentalopposition “
Was für ein Qana-Quatsch wieder.
Es geht einzig und alleine um Fehler und Irrtümer im Wissenschaftsgebäude. Und um Idole- und Ikonenbildung die durch deren Unantastbarkeit wissenschaftlichen Fortschritt hemmen, gar verhindern.
Wer keine Bauschmerzen bekommt angesichts der inszenierten Apotheose, regelrechte Vergöttlichung des Einstein (wie an einem Gott ist Zweifel an Einstein, seinem „Werk“ eine Art Todsünde) hat kein bisschen Wissenschaftlichkeit im Blut, keinerlei Verständis von der wissenschaftlichen Methode.
Und was der über „fälschlichen Entgegensetzung von „Kausalität“ und „Akausalität“, “ munkelt ist schlicht leeres Gewäsch ohne Substanz, ohne Substantiierung. Quana-Qualm eben, wie bisher, wie gehabt. Da kann man nicht einmal inhaltlich etwas erwidern – mangels Inhalt oder auch nur irgend eines Ansatzes für irgendwas.
Die Entscheidung zum / für „Aberglaube“ kann natürlich komfortabel sein: „Ich glaube das jetzt, weil ich mich nicht weiter damit beschäftigen will und gut is.“
„Aberglaube“ zu »Fundamentalopposition« transkribieren, halte ich für sportlich.
»Fundamentalopposition« ist doch deswegen Käse, weil sie dem Gegenüber jegliche Glaubwürdigkeit abspricht.
In der Wissenschaft sind es doch immer »rein methodische Zweifel«, weil a) es die falsche Methode für einen Gegenstand ist (bspw. Fieber mit Gruppendynamik erklären), b) eine Methode falsch angewandt wurde oder c) eine Methode in sich falsch ist und zu falschen Ergebnissen führt (Zirkelschlüsse, Oxymora, Tautologien finden sich gerne in der Hermeneutik, aber auch Informatik)?
Das verstehe ich nicht?
Habe aber auch nicht alle Kommentare hier auf dem Schirm (vielleicht weil zu meiner jahreszeitlichen Vernagelung auch noch Erkältungsfieber gebucht wurde…)
Du verstehst wie üblich fast alles, was nicht in deinen ästhetischen Solipsismus paßt, methodisch miss:
„Aberglaube“ ist und bleibt was anderes, als Fundamentalopposition, aber falls und insoweit Fundamentalopposion in etwas mündet, was traditionell „Aberglaube“ heißt, dann ist sie vermutlich die Quelle. Um diese Klarstellung ging es mir, damit wir nicht ins Ungefähre des psychologistischen Universums reden.
„Zweifel an der Methodik“ ist scho‘ grammatisch einem „methodischen Zweifel“ entgegen gesetzt, vielleicht solltes du weniger nach Gusto Wörtlein in optische Zeilen reihen, im Übrigen hilft ->Google.
Die „fälschliche Entgegensetzung“ habe ich nur behauptet und begründet, warum: Eine gegenständliche Darstellung ist mir darstellungstechnisch mißlungen, auch deshalb, weil mir nichts einfiel, sie so elementar zu gestalten, daß sie ohne Resultate physikalischer Forschung gelingen könnte, die Ratze und Verrückte seiner Art methodisch verwerfen.
Mein Gott Walter, das war die letzte Antwort, die du von mir erhalten hast, auch deiner häßlichen Heuchelei halber, für mich gibt es kaum was Häßlicheres.
Zu viel? Genug? Noch mehr? Okay.:
Die heutige (jesuitisch : Georges Lemaître) verbreitete Vorstellung ist ja, dass das ganze Weltall auseinander fliegen würde. Das würde aus der Rotverschiebung folgen, die umso größer wäre, je weiter das beobachtete Objekt entfernt sei, weil diese um so schneller von uns fortfliegen würden. Und, ach was, dahinter steckt der ganz banale Dopplereffekt. Soso. Witzig, dass der Entdecker der Rotverschiebung, Hubble, nie an diese Erklärung geglaubt hat.
Nun, es mag ja so sein …
Aber es gibt genau so gute andere Erklärungen. Je weiter das Licht bis zu uns vordringt, umso mehr Raum muss es durchstrahlen. Aber nicht einfach leerer Raum! Der Raum ist erfüllt von Atomen, ja sogar überall wären virtuelle Teilchen am entstehen und verschwinden – und gar nicht zu vergessen: angeblich wären 90% der Materie „dunkel“, und damit letztlich unbekannt in seinen Eigenschaften. Die ist also auch noch dazwischen, wenn das stimmt.
Nun ist die naive Annahme der Weltall-Expandisten, dass das alles völlig irrelevant wäre. Diese ganze Suppe aus Teilchen und Masse und Fluktuationen und Energieströmen wären völlig wirkungslos gegenüber dem Licht. Licht sei völlig unbeeindruckt davon – und einzig die Fluchtbewegung der Sterne würde die Rotverschiebung verursachen. Dabei können wir sogar im Labor Effekte untersuchen die eine Rotverschiebung bewirken. Ganz davon abgesehen, dass wir Effekte die über solche riesigen Dimensionen und fremde Umstände überhaupt gar nicht kennen, beurteilen, abschätzen können.
Und trotzdem ist sich die Gemeinde völlig sicher: das kann nur Doppler, Weltall-Expansion, sein.
Peinlichpeinlich, wenn es nicht so blöde, und so Weltsicht-bestimmend wäre: „follow the science“! Denn die ist wahrer als wahr (PR schreckt ja bekanntlich auch vor „weißer als Weiß“ nicht zurück).
Ok, der Skepsis bezüglich der Rotverschiebung in einem nicht leeren Raum kann ich folgen.
Warum gibt es dann die Blauverschiebung als Indikator der Annäherung bei der Andromeda-Galaxie?
Natürlich tritt der Dopplereffekt bei Licht auf. Also sich entfernende Lichtquellen sind nach rot verschoben, sich annähernde nach blau. Andromeda ist übrigens in dem Zusammenhang als „sehr nahe“ anzusehen. Es geht um die Rotverschiebung ferner Lichtquellen.
Doppler ist eben nicht der einzige Effekt, der die Frequenz von Licht ändern kann. Auf die Schnelle das hier:
„Als Compton-Effekt bezeichnet man die Vergrößerung der Wellenlänge eines Photons bei der Streuung an einem Teilchen. “ (siehe Wikiblödia)
Vergrößerung der Wellenlänge = Rotverschiebung.
Nun, je weiter eine Lichtquelle entfernt ist, umso öfter muss dessen Licht im Weltall verteilte Atome und Teilchen passieren.
Und deswegen kann man eben nicht behaupten, dass eine beobachtbare immer größere Rotverschiebung bei immer weiter entfernten Lichtquellen automatisch eine höhere Fluchtgeschwindigkeit bedeuten muss. Es fehlt schlicht der eindeutige Beweis.
Soweit ich weiß, sind es nur Galaxien aus der lokalen Gruppe, die sich auf die Milchstraße zu bewegen, alle anderen hauen doch ab..?
D’accord.
Habe mich von diesem Satz in eine falsch Richtung führen lassen, weswegen ich die Blauverschiebung überhaupt erwähnte…
Zur Vorbeugung:
Abgesehen davon, daß Ratze sich als ein Gott mit universellem Blickwinkel wähnt, der deshalb gestreutes Licht als ungestreut wahr nimmt, ist zu bemerken, daß Röntgen- und Gamma-Quellen ebenfalls dem angezweifelten Doppler-Effekt unterliegen.
Klar, ist ja auch Licht bzw. elektromagnetischen Strahlung. Und Gamma-Strahlung wird irgendwann zu Röntgen und irgendwann zu UV. Und alles wird unterwegs gestreut.
Und er hat (mir jedenfalls) verdeutlicht, dass er nicht den Doppler-Effekt anzweifelt, sondern dass dieser der ausschließliche Grund für die Rotverschiebung entfernter Galaxien sein soll; denn das ist der „offizielle Beweis“ für die Expansion des Universums.
Das Einzige, was hier „streut“, ist dein korrupter Verstand
Ja, das habe ich vorhin (15:58 Uhr) eingeräumt, sowohl die Streuung als auch Korruption (im Sinne von fehlerhaft).
Und wahrscheinlich irre ich auch hier, aber es freut mich, dass ich noch als Windmühle durchgehe. Also hauche (nicht heuchle) ich ein: „Heute nicht weiter…“
Und was sei denn bei Röntgen- und Gamma-Strahlung prinzipiell anders? Auch da sind neben dem Doppler-Effekt auch noch andere Effekte bekannt, die zu Energie- bzw. Frequenz-Veränderungen führen können.
Und wo hätte ich denn Doppler-Effekt angezweifelt? Wieder eine Miese Masche des Qana-Qualmschlotes.
Nochmal: Das Licht aus Milliarden von Lichtjahren Entfernung durchdringt nicht etwa leeren Raum, wie man ja naive annimmt, sondern einen erfüllten Raum:
Staub
Moleküle
Atome
Ionen
Teilchen
Strahlung
Gravitation
virtuelle Teilchen
evtl. Dunkle Masse, Dunkle Energie, bisher unbekannte Formen von Energie/Materie
…
und dann wird behauptet, die Rotverschiebung wäre einzig und alleine dem Dopplereffekt geschuldet – obwohl man sogar andere Einflüsse, die zu Rotverschiebungen der Strahlung führen, kennt. Lachhaft!
Merke: einer Strahlung sieht man nicht an, warum sie Rotverschoben ist. Es gibt keine verschiedenen „Fingerabdrucke“ bei verschiedenen Rotverschiebungs-Effekten.
Das Qana funktioniert einzig und alleine nach einem ganz billigen Schema: Kritik an der HERSCHENDEN „Wissenschafts“-Erzählung ist nicht statthaft – und muss daher MIT ALLEN MITTELN der Lüge, des Betruges, der Rabulistik, der Verdrehung, der Verächtlichmachung, bekämpft werden.
Weiter will ich bemerkt haben, daß Ratze bei seinen Ausweichmanövern gegen die Erwähnung von Fakten und Argumenten in den vergangenen Tagen als Letzte Bastion des methodischen Zweifels die Kategorie der Gewissheit ins Feld geführt hat.
Gewißheit ist eine theologische (resp. philosophische, also ideelle) Kategorie, sofern sie nicht „Selbstgewißheit“ zum Gegenstand hat (1), und steht in fundamentalem Gegensatz zu Kritiereien wie „Verifizierbarkeit“ resp. „Falsifizierbarkeit“, die Ratze parallel dazu als Hilfsbegriffe in Anspruch nimmt.
(1) „Selbstgewißheit“ im cartesischen Sinne ist ein psychologisierter Schwachsinn, weil es das „Ego“ zirkulär unterstellt. Folglich ist zu sagen: „Selbstgewißheit“ ist nicht weniger eine theologische Kategorie, das „Ego“ Descartes ist das gläubige Ego, die einzige ächte Gewißheit eines Gläubigen ist die seiner Glaubenszweifel.
Dies Muster findet sich bei Ratze wieder.
Intellektuelle resp. wissenschaftliche Selbstgewißheit ruht auf der Selbstgewißheit einer entschlossenen Tat, sofern diese etwas „zurück liefert“ – actio et reactio. Man kann es auch Magie nennen, oder mit Jacky Venson:
Witchcraft: https://overton-magazin.de/top-story/zwischen-leerstelle-und-logik/#comment-318807
Was für ein Qualm hier … Qana qualmt
Als ein Letztes:
Ich bin eine Niete, was Technologien anbelangt, aber in den letzten Jahrzehnten sollte die Konstruktion der meisten technisch hochwertigen (miniaturisierten) Halbleiter auf der Anwendung des Tunneleffektes beruhen, der die Quantenmechanik validiert und erklärt, warum es Radioaktivität überhaupt geben kann.
Letzteres ist allerdings nur eine Hälfte der Erklärung für das Phänomen des statistischen radioaktiven Zerfalls unter Erhaltung von Halbwertszeiten.
Die andere Hälfte ist darin zu suchen, daß an dem Phänomen zwei Kraftwirkungen beteiligt sind, die zusammen wirken, obgleich sie keinerlei (inneren!) Zusammenhang aufweisen: a) Coulomb-Kraft der Abstoßung der Protonen b) starke Kernkraft. Nach der letzteren Seite folgt die Stochiastik des radioaktive Zerfalls derselben Phänomenologie, wie der Münzwurf. Auch da gleichen die beteiligten Kräfte, die chaotisch im ganzen Bereich von „gleichsinnig“ bis „gegensinnig“ am Werke sind, statistisch aus.
Ich kann nur hoffen, daß es mehr als ein paar Prozent Leute gibt, die nicht so komplett vernagelt, verloren, von allen guten Geistern verlassen sind, wie Ratze und El G.
Obgleich – recht eigentlich muß es mir wurscht sein.
Tunneleffekt. Noch so ein „Buzzwort“ hier völlig zusammenhanglos in den Ring geworfen.
Nochmal: so lange man kein Experiment ausführen kann, in dem _jeder_ Einfluss, der eine kausale Reaktion des instabilen Kerns auslösen könnte ausgeschlossen ist, so lange kann man die These von dem „spontanen Zerfall“ nicht beweisen.
Es ist bekannt, dass man Kernspaltungen instabiler Elemente provozieren, also deren Zerfallrate massiv erhöhen kann, indem man sie mit Neutronen beschießt. So funktionieren Atomkraftwerke und Atombomben. Niemand wird daherkommen und behaupten, diese provozierten Zerfalle wären „spontan“. (Obwohl, bei diesem Qana-Qualmer kann man nie sicher sein. Der kann jeden Unsinn zur Verteidigung seiner Wissenschaftskirche behaupten. Wie es sich für die moderne Form des Jesuiten eben gehört.)
Also: warum sollten nicht auch Neutrinos Zerfalle auslösen können? „Schwächer“, also seltener, aber eben doch in einem sicht- bzw. messbaren Ausmaß. Die so genannte „natürliche Radioaktivität“, der scheinbar spontane Zerfall instabiler Teilchen ohne zusätzliche, spezifisch induzierte Provokation. Einfach aufgrund des ständigen, massenhaften Beschusses mit allgegenwärtigen, alles durchdringenden Neutrinos. Selbst der Erdmittelpunkt wird ständig von Massen von Neutrinos durchschlagen. Niemand und nichts kann die abschirmen. Aber dennoch können die in seltenen Fällen wechselwirken.
Beweis: Neutrino-Detektoren.
„A neutrino detector is a physics apparatus which is designed to study neutrinos. Because neutrinos only weakly interact with other particles of matter, neutrino detectors must be very large to detect a significant number of neutrinos.“ (aus Wikiblödia)
und bitte: das mit den Neutrinos ist natürlich nur der Vorschlag für EIN mögliches alternatives Modell für den Mechanismus des radioaktiven Zerfalls. Es sind sicher auch andere denkbar.
Angesichts der Bedeutung der Erklärung für Radioaktivität für die gesamten modernen Pyhsik sollte man aber doch genau an dem Punkt besondere Sorgfalt und Kritizität erwarten. Denn, wie gesagt, der „spontane Zerfall“ läutete die Abkehr vom Prinzip der vorher als zentral angesehenen Kausalität in der Physik ein. Und das führte dann weiter bis hin zu „spukhaften Fernwirkungen“ (nach Einstein), usw.. Sollte Radioaktivität gar nicht spontan erfolgen, müsste (und vor allem könnte wieder) vieles neu überdacht werden. Was dringend notwendig ist!
Aber solange überall sofort diese Wissenschafts-Jesuiten auftauchen und die „Reine Lehre“ mit allen Mitteln verteidigen, so lange wird das nichts.
zu Qana
gestern 16:45 Uhr
Der Münzwurf ist keinen „zwei Kraftwirkungen“ unterworfen wie Kernbestandteile oder Kerne. Der „Zufall“ des Münzwurfs ist genausowenig zufällig wie das Schwingen eines mehrgliedrigen Pendels – nur unserer Wahrnehmung nach chaotisch und eben nicht vorhersehbar. Würde das Pendel zwei mögliche gleichwertige Endzustände aufweisen, es wäre ebenso nicht vorhersehbar, welchen das Pendel bei einer konkreten Anwendung schließlich einnehmen würde – absolut analog zum Münzwurf.
Und das hat alles schlicht und ergreifend Null und Nichts mit irgendwelchen Vorgängen in Atomkernen gemein.
Das erschreckende ist diese völlige Kenntnisfreiheit dieses Qana-Qualmers. Aber dieses Phänomen ist mir nichts Neues. Es sind immer gerade die, die am wenigsten wissen, sich aber am meisten für die angeblich einzig Wahre (offiziöse) Wahrheit dicke machen. Unwissenheit macht frei von Skrupeln und Vorbehalten – man kann umso leichter seinen absoluten Glauben verteidigen – dass die von Autoritäten vorgegebenen „Wahrheiten“ die einzig wahren sein müssen.
Hab mir mal ein Video von einem Kanal ‚reingezogen, den ich nicht besonders schätze, weil ich ein oder zwei Produkte in der Vergangenheit über alle Maßen generalisiert fand. Das trifft auch dieses hier:
https://www.youtube.com/watch?v=c-Q5r3THR3M
Aber im Zusammenhang mit den irrsinnigen Mißverständnissen in diesem Faden ist das nützlich, weil es zentral um die Rolle der Beobachtung, resp. „beobachtbarer Größen“ (observables) in den Quantentheorien geht und damit um die systemische Divergenz deterministischer Theorien, wie der Newton’schen und der Einstein’schen, zu mathematisch konsistenten und hinreichend abgeschlossenen Konstrukten, die das Ziel haben, Beobachtungen in Zusammenhang zu bringen und solchen Zusammenhang dann mit der Vorhersage von Beobachtbarem zu validieren.
Man kann mit Mathematik alles “ zu mathematisch konsistenten und hinreichend abgeschlossenen Konstrukten“ verwursten. Wie schon einmal angeführt als Beispiel: Splines bilden umso besser einen Zusammenhang ab, umso mehr Parameter angewandt werden. Das gleich Prinzip bei Modellen und den daraus abgeleiteten Simulationen.
Aber ein Spline sagt genauso wenig wie ein Modell oder eine Simulation etwas über den inneren Zusammenhang eines Umstandes oder Vorganges aus. Und dann kann man auch noch alles mit Wahrscheinlichkeitsrechnung erschlagen. Auch ohne irgendwelche Erkenntnisse daraus gewinnen zu können. Dass man eine Statistik von radioaktiven Zerfallen aufstellen kann und diese Statistik bei gleichen Isotopen gleich ist, besagt ganz genau Null und Nichts über den Hintergrund solcher Zerfalle. Alle häufigen, ähnlichen Ereignisse kann man statistisch beschreiben – ohne irgend einen Erkenntnisgewinn über Hintergründe oder Ursachen damit zu gewinnen.
Newton hätte ein Statistik aufstellen können, darüber, wie oft Äpfel vom Baum auf den Boden fallen. Er hätte gefunden, dass ein sich vom Baum lösender Apfel mit der Wahrscheinlichkeit von annähernd 1 dem Boden zustrebt. Völlig korrekte Mathematik also, konsistent, abgeschlossen, Blablabla. Aber was hätte diese Statistik ihm über den Grund für diese Beobachtung aufzeigen können? Genau NICHTS!
Mathematik kann genauso gut zum Erkenntnisgewinn wie auch zur Verarschung angewandt werden. Aber „follow-the-science“-Spinner sind überzeugt, dass eine mathematische Darstellung eines Sachverhaltes den Beweis dafür darstellen würde, dass die Wissenschaft dahinter wahr sei, wahr sein müsse. Dass man aber die angewandte Mathematik verstehen und interpretieren muss, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen, und dass da Spielräume sind, die in einer Bandbreite an Erklärungen zulassen, und dass genauso gut falsche Schlüsse gezogen werden können – bei völlig korrekter Mathematik – das verstehen sie einfach nicht. Oder wollen dieses Verständnis bekämpfen um ihre definitorische Vormachtstellung zu erhalten.
Wenn sich hier niemand mehr beteiligt (und bitte unter Berücksichtigung des einen oder anderen im langen Faden schon Vorgebrachten), werde ich das Thema lassen.
@ratzefatz
Es herrscht jetzt wohl Einigkeit darüber, dass der Wissenschaft der Physik mit genauso viel Vorsicht begegnet werden muss, wie allen anderen Wissenschaften auch. Schließlich finden sich hier auch Marktschreier und Schlangenölverkäufer, diese sind jedoch nur seltenst wirklich wissenschaftlich tätig.
Und eigentlich habe ich bei Physikern immer den Eindruck (jedenfalls bei jenen, die nicht berühmt sind oder eine besondere Reputation haben, also das Gesicht verlieren können), dass sie auf die Widerlegung alter und das Aufkommen neuer Modelle warten – es sind halt neugierige Menschen.
Ihrem Vorwurf an das gebetsmühlenartige „Follow the Science“ kann ich mich anschließen, doch kommt das hauptsächlich – wie gesagt – nicht von Vollblutwissenschaftlern.
@Qana
Danke für den interessanten und differenzierten Videolink. Habe mich mit Grippe auf dem Sofa liegend und einigen anschließenden und interessanten Videos durchs verlängerte Wochenende gehangelt…
Eines der unterhaltsameren Interviews war das von Brian Green an Kip Thorne, welcher aus eigener Erfahrung berichtete, wie lange es teilweise dauern kann, bis alte Erkenntnisse auch in der Physik abgelegt werden. Auch sein nachdrücklicher Hinweis, dass Mathematik und Physik nicht zu verwechseln sind, fand ich sehr wichtig.
Und hier noch einen:
„Nach dem Urknall standen Strahlung und Materie zunächst im thermischen Gleichgewicht. Infolge der Expansion des Universums sanken die Temperatur und die Dichte des gekoppelten Strahlung-Materie-Gemisches mit der Zeit. Schließlich konnten nach etwa 380.000 Jahren, bei einer Temperatur von etwa 3000 Kelvin, Protonen und Elektronen elektrisch neutralen Wasserstoff bilden, was in der Physik als Rekombination bezeichnet wird. Weil nun freie Elektronen und Protonen fehlten, konnte die Strahlung nicht mehr durch Thomson-Streuung von Photonen mit der Materie wechselwirken – das Universum wurde „durchsichtig“. Aus dieser Zeit, der Rekombinationsepoche, stammt die kosmische Mikrowellenstrahlung.[2] Sie wurde zum Zeitpunkt ihrer Entstehung im sichtbaren Spektrum ausgestrahlt. “ (nach Wikiblödia zu „Hintergrundstrahlung“)
Lassen wir mal den Unsinns weg, dass dort behauptet wird, dass Photonen mit Materie wechselwirkte _als es noch gar keine Materie in Form von Atomen gab weil noch nicht einmal das elementare Atom Wasserstoff existierte – und Materie doch wohl aus Atomen besteht, oder etwa nicht? -_ so wird dort behauptet, dass aus einem Punkt (an dem der Urknall erfolgte) Strahlung (und gleichzeitig Materie, aber ohne Atome!) entstanden wäre, und von dieser Strahlung noch heute Reste in Form der Mikrowellen- oder Hintergrundstrahlung beobachtbar wäre.
Nun ist es eine Eigenschaft nicht-korpuskularer Strahlung sich mit Lichtgeschwindigkeit _geradlinig_ auszubreiten (sofern kein Materie sie durch Streuung oder Reflexion, evtl noch Gravitation, daran hindert). Ganz offensichtlich verteilt sich Strahlung also schneller im Raum als Materie. Folglich wäre spätestens nachdem das Universum nach dem Urknall „durchsichtig“ wurde, die beim Urknall entstandene Strahlung aus dem dann sich mit Materie durchsetzenden Raum längst entwichen – einfach weil Strahlung schneller ist.
Man stelle sich vor: es sei eine Explosion die Materie und Strahlung in einen sonst leeren Raum auswirft. Bei idealen Bedingungen haben wir dann zwei punktsymetrisch ineinander liegende Kugelfronten: eine innere Kugelfront, bestehend aus der am schnellsten sich bewegenden Materie, und eine äußere Kugelfront, bestehend aus der sich _immer_ schneller als die Materie fortbewegenden Strahlung. Die Strahlungsfront eilte der Materiefront immer voraus. Materie eilt immer hinterher. Also gibt es keinerlei Veranlassung, dass die Ursprungs-Strahlung sich nicht geradlinig-strahlenförmig von dem Ursprungsort ausbreitet und – aus Sicht der Materie, also auch aus unserer Sicht – im äußeren, materiefreien Raum einfach verschwindet.
Man redet ja geradezu vom „Echo des Urknalls“ oder „Nachhall des Urknalls“. Echo und Nachhall benötigen aber Wände, an denen die Wellen reflektiert werden. Wo soll es außerhalb des Urknall-Ereignishorizonts Wände gegeben haben, die die Wellen, die Strahlung, reflektiert haben könnten? Und die Strahlung müsste schließlich zu uns _zurück_ reflektiert werden, um von uns wahrgenommen werden zu können. Oder nicht?
Was uns als so selbstverständlich und angeblich „logisch“ erzählt wird, hat bei genauer Betrachtung nicht Hand, nicht Fuß. Und wenn man einen Wissenschaftler fragt, was kommt dann wieder? „Die Formel Blablabla bedingt über das Integral Blubbblubbblubb und mit dem Standardmodell und Händewerfen ergibt sich dann Pipapo. Also muss alles so sein wie wir es sagen!“
Das wird heute als Wissenschaft verkauft: blühende, unsinnige Alogik, unter Mathematik-Gedöns vergraben, mit dem Stempel „Wissenschaft“ versehen und daher nicht anzweifelbar, nicht hinterfragbar, nicht verstehbar, sakrosankt eben. Und wir sollen das gefälligst fressen: „follow the science“ eben.
Nochmal: der Urkanll wurde von einem Jesuiten „erfunden“. Nun sind Papst-treue Glaubenskrieger uns als die objektivsten, neutralsten, jeglicher Idee und jedem Gedanken völlig aufgeschlossen gegenüberstehend bekannt, die objektivsten und einzig und alleine der Wahrheit und nichts als der Wahrheit verpflichteten Wissenschaftler, die es je gab – oder etwas nicht? ;-(
Es ist diese völlig irre Vorstellung, dass wenn ein Phänomen IRGENDWIE mathematisch beschrieben ist, damit das Phänomen auch verstanden und erklärt wäre.
Aber wenn man zB durch einige Messpunkte einen absolut passenden Spline durchgelegt hat, also eine mathematische Beschreibung der Messungen erzeugt hat, ist damit genau GAR NICHTS erklärt oder verstanden! Oder ein Modell, das geeignet ist, alle bisherig erfassten Messpunkte zu reproduzieren bedeutet überhaupt gar nicht, dass es deswegen zukünftige Messpunkte voraussagen könnte – oder irgendwas von dem Phänomen verstanden wäre.
Mathematisierung ohne Verständnis ist genauso nützlich, wie etwa eine Brücke zu bauen, die irgendwie wie ein Brücke aussieht, eine Brücken-Attrappe – aber deswegen noch lange nicht das halten muss, was eine Brücke eigentlich verspricht: Stabilität.
Parmenides reloaded:
https://www.spektrum.de/news/quantenkosmologie-loesung-des-informationsparadoxons-des-universums/2300455
Ich hatte das Thema am 30.11. angesprochen:
https://overton-magazin.de/top-story/zwischen-leerstelle-und-logik/#comment-320079
und zwei Tage vorher schon nebenher auf den Belang verwiesen:
https://overton-magazin.de/top-story/zwischen-leerstelle-und-logik/#comment-319474
Ich habe jetzt hier einige große Fragezeichen und sogar offensichtliche Fehler in der heute gelehrten Physik aufgezeigt.
Die Relativitätstheorie nach der sich angeblich Längen und Zeitverläufe real ändern würden („Ruhelänge“, „Längenkontraktion“, „Zeitdilatation“) – je nachdem von wo aus, mit welcher Relativgeschwindigkeit dazu, es ein Beobachter betrachtete.
Die experimentell nicht nachgeprüfte, weil so gut wie nicht nicht nachprüfbare, ikonographische Formel E=mc², die genausogut E=0,938*mc² – oder auch ganz anders – lauten könnte. Wenn es denn überhaupt Umwandlungen von Materie in Energie gibt. Chemische Energie, Verbrennungswärme zB, stammt aus Bindungsenergie – und kommt nicht von Masseverlusten.
Die Behauptung der angeblich zufälligen, akausalen, ursachenlosen, „spontanen“ Kernspaltung radioaktiver Elemente, die so lange nicht experimentell beweisbar ist, so lange nicht JEGLICHER Einfluss von Außen abgeschirmt werden kann, was zB für Neutrinos nicht geht. Dass aber Neutrinos, wenn auch selten, mit Materie wechselwirken, ist bekannt. Auch kann es noch schwächer wechselwirkende Teilchen geben, die aber aus eben diesem Grund noch nicht gemessen wurden, nicht bekannt sind.
Der Widerspruch zwischen dem angeblichen Phänomen des Urknalls, bei dem praktisch der gesamte Inhalt des Universums aus einem einzigen Punkt auseinander geflogen sei – und der angeblichen Existenz von Schwarzen Löchern, die sich daraus ergeben würde, dass ab einer gewissen Massekonzentration es ausgeschlossen sei, dass daraus etwas entweichen könne, also auch nicht expandieren kann.
Die unbelegte Behauptung, dass je ferner eine Strahlungsquelle im Kosmos sei, diese auch eine umso höhere Fluchtgeschwindigkeit, weg von uns, aufweisen würde (das bekannte Beispiel mit dem Luftballon mit Punkten drauf, der aufgeblasen wird), was angeblich aus der gemessenen Rotverschiebung gefolgert werden müsse, die angeblich nur auf den Dopplereffekt beruhen könne – dabei gibt es mindestens einen bekannten Streuungseffekt der Rotverschiebung bewirkt (und vielleicht auch noch noch etliche unbekannte andere Effekte), und es gibt im „leeren Raum“ genug Materie und Einflüsse, bekannte und Unbekannte (man denke an die angenommenen, aber absolut unerforschte „Schwarze“ Materie/Energie) die eine solche bewirken können – und logischer Weise liegt davon umso mehr zwischen uns und dem beobachteten Objekt, je weiter es weg ist, kann also auch umso mehr die Strahlung Rot-verschieben.
… … … … … … … …
Nun ist (oder wahr zumindest) Physik eine objektive Naturwissenschaft. Was man weiß sollte man sicher wissen können, und was man nicht sicher weiß, sollte man eindeutig als Hypothese, als Vermutung, kennzeichnen. Und genau das ist heute nicht mehr der Fall.
Wenn das aber schon für eine „objektive Naturwissenschaft“ heute so ist, wie ist es denn dann mit anderen Feldern der Wissenschaften, oder überhaupt mit der Wahrheit und Wahrhaftigkeit in überhaupt allen gesellschaftlichen Feldern, in Politik, Wirtschaft, Berichterstattung, Forschung, Lehre, Geschichtswissenschaften, verbreiteten Weltbildern, Binsenweisheiten, „Narrativen“, …, bestellt?
Schlecht, sehr, sehr schlecht!
Und zu „„Wir haben das per Hand nachgerechnet, es stimmt. Aber wir verstehen es nicht. Wir haben keine Ahnung, welchen physikalischen Effekt die KI da erzeugt hat.“ Aussage des österreichischen Physikers, Mario Krenn, über ein von KI generiertes Modell,“
Welcher physikalische Effekt, den die „KI“ erzeugt hätte? Dass die „KI“ bewirkt hat, dass sie etwas physikalisch, mit der Hand, gerechnet hätten? Muss wohl sehr bewegend gewesen sein auf so eine antike Methode wie „mit der Hand rechnen“ zurückzukommen. Schien denen wahrscheinlich so ähnlich atemberaubend wie das Erlebnis, Feuer mit Feuerstein und Zunderschwamm zu machen und ähnliche „vorsintflutliche“ Praktiken.
Wahrscheinlich mussten die das „mit der Hand rechnen“ erst einmal in alten Büchern und Folianten studieren und monatelang üben …
;-(
… und in der Zusammenfassung noch vergessen:
die angeblich hier immer noch herumgeisternde Strahlung aus dem Urknall, die Hintergrundstrahlung, die anscheinend von irgend etwas hier festgehalten, von irgendwas immer wieder zurückgeworfen worden sein muss – nur von was wenn es außerhalb der Urknall-Späre es gar nichts gab.
Ich habe also damit schon alleine sechs „Leerstellen“ in Wissenschaftler-Hirnen beschrieben, und es gibt gewiss noch mehr.
Aber: „follow the science, denn da liegt die Wahrheit und das letzendliche Wissen, die Weisheit, die einzig gültige Orientierung in dieser Welt, Du musst nur ganz, ganz, ganz fest glauben und alles wird gut …“ und Harald Lesch und Mai Thi sind seine TV-Propheten.
Urknall-Sphäre
Mein Bedürfnis, diese Stränge sichtbar zu halten, ist mir selbst verdächtig, aber sei’s drum.
Hier eine Präsentation, „What Physics Means by Fields — Richard Feynman“, 25 min.
https://www.youtube.com/watch?v=O2kemSh_mUg
Keine Ahnung, aus welcher Zeit das Original stammt, aber das Motiv der Präsentation kenne ich:
Studenten einen Teil der Vorurteile auszureden, die ihr theologisch verseuchter Verstand ohne ein bewußtes Zutun produziert. Deshalb ist der Vortrag von erheblicher Redundanz geprägt.
i>
Feynman ist durch und durch Praktiker gewesen, deshalb ist ihm nicht eingefallen, den Begriff eines (physikalischen) Universum etwa fallen zu lassen, der im Minimum ein theologisches Geschmäckle hat. Aber er dekonstruiert den populären Universumsbegriff zu einem Gegenstandsbereich, dem der Physik halt, ganz analog, wie ein Biologe das mit seinem Gegenstandsbereich macht, „dem Lebendigen“, wenn er den aus der Physik spezifisch abgrenzend aushebt: „Stabile Zustände fern des thermodynamischen Gleichgewichts“.
Der praktische Effekt:
„Gott“ oder „Die Schöpfung“ (das ist die vorgestellte Entität, die der monotheistisch gestrickte Verstand verdoppelt und die Verdopplung sogleich für „kollabiert“ erklärt) wird zum Gesprächspartner, er fängt an zu reden und sich befragen zu lassen, und die Arbeit des Physikers besteht dann in nichts weiter, als Fragen zu ersinnen, auf die „das Universum“ ebenso eineindeutig wie präzise antwortet.
Da ist überhaupt nichts sichtbar. Die Hirne sind viel zu verqualmt, nicht nur mit Qana-Qualm. Die Indoktrination und Apotheotisierung von Wissenschafts-Idolen setzt ja schon im Kindergarten an.
Nehmen wir mal dieses El-G. Das tut so, wie wenn es irgend etwas von dem, was ich hier brachte, nachvollziehen wollte oder gar könnte. Und dann: nichts mehr. Dabei stelle ich das uns massiv eingetrichterte Weltbild völlig in Frage. Dieses beredte Verstummen ist deutlich: da tat jemand nur so, als ob.
Es wird hier nur simuliert. Selbst die scheinbare Sichtbarkeit ist simuliert. Denn wenn die Scheuklappen fest sitzen, kann man sogar offensichtliche Wahrheiten nicht mehr wahrnehmen. Funktioniert.
Wie bestellt, gestern erschienen (23 min)
https://www.youtube.com/watch?v=eWuv775pvsw
Feynman to particles.
Ich hab erst den Anfang gehört, aber der approach reicht mir, es zu posten.
Da ist überhaupt nichts neu erschienen. Bill Gates hat die ganzen Feynman-Lectures schon lange Online gestellt. (Siehe Vorwort zu „Sie belieben wohl zu scherzen, Mister Feynman“) Gates ist Fan von Feynman. Wahrscheinlich weil er überhaupt nichts verstanden hat. ZB dass Feynman die „Cargo-Kult-Wissenschaften“ anprangert.
Wer Feynman mit einem kritischen Blick liest, erkennt, dass dort das moderne Wissenschaftssystem nicht bestätigt sondern entlarvt wird. Feynman stellt sich ja selbst als Blender, als „Cheater“ dar. Das kann man ihm zugute halten. Er kritisiert sogar das Nobelpreis-System obwohl er selbst einen erhalten hat für „irgendwas im Zusammenhang mit Quantenelektrodynamik“.
Q uod E rat D emonstrantum! Pyhsiker sind nicht erst seit Teilchen wie „Quarks“ und „Higgs“ echte Spaßvögel – wahrscheinlich weil sie sich selbst nicht mehr ernst nehmen können. Und die, die sie ernst nehmen, das staunende Publikum, schon ganz, ganz lange nicht mehr – Siehe Einsteins Zunge.
Man muss sich nur mal vor Augen halten, dass die Behauptung des angeblich „spontanen“, angeblich a-kausalen, angeblich zufälligen, angeblich nur Wahrscheinlichkeits-Bedingungen folgendem natürlichen Kernzerfalls instabiler Elemente (Isotopen) aus nichts anderem abgeleitet wird als der Tatsache, dass man bisher keine Ursache, keinem kausalen Mechanismus folgenden Auslöser solcher Zerfalle gefunden hat.
Damit ist aber nichts bewiesen außer der Tatsache, dass man nichts bewiesen hat.
Dann vergegenwärtige man sich mal die aus der Behauptung des „spontanen“ Kernzerfalls folgenden Implikationen und Ausweitungen (bis hin zu „Schrödingers Katze“ und zur „spukhaften Fernwirkung“ Einsteins, etc.). Kurz gesagt wurde damit das mechanistische Weltbild, das bis Planck und Einstein in der Wissenschaft (vor)herrschte über den Haufen geworfen. Also ein Weltbild umgeworfen, gestürzt, völlig umgekrempelt.
Ja, wenn die Behauptung des „spontanen“ Kernzerfalls wissenschaftlich hieb- und stichfest gesichert wäre, wäre ja nichts dagegen einzuwenden. Aber ein Nicht-Wissen, das „Wissen“, dass man _bisher_ noch keine kausale Ursache für einen „spontanen“ Kernzerfall gefunden hat – aber man damit noch lange nicht ausschließen kann, dass es doch eine gäbe – kann doch nicht dazu hergenommen werden, ein völlig neues Weltbild als einzige neue „Wahrheit“ zu verkünden.
Schon alleine mit dem Verständnis dieses Punktes muss es doch einem wie Schuppen von den Augen fallen: da läuft was gehörig schief!
Und die Sackgasse in die die moderne Physik heute gefangen ist, die offensichtliche Stagnation, zeigt ja, wohin so was führt. Indem Hypothesen auf Hypothesen auf Hypothesen geschichtet werden geht das Bewusstsein dafür verloren, dass ganz am Anfang auch nur eine Hypothese stand – also das ganze darauf aufgetürmte Kartenhaus nichts halten kann.
Es ist der bornierte Wunsch aus Wissenschaft eine moderne Religion zu machen, die Gewissheit, und nichts als Gewissheit, Weisheit, letzgültige Wahrheiten, und schließlich letztendlich sogar noch ein (Techno-)Paradies auf Erden gewährleisten solle.
Hybris!
Elitäre Hybris von Personen, die sich als hervorragend und ausgezeichnet ansehen wollen und dazu ein selbstreferentielles System von Verkündigungen („Lehre“), Seilschaften, Selbstbeweihräucherung, Selbstbestätigungen, „Würden“, „Ehren“, Ehrungen, Preisverleihen, Pfrünten und überdurchschnittlichen Vergütungen geschaffen haben.
Hier gibt es doch dutzende Modelle oder Kameraden, die ungefähr dasselbe weltanschauliche Strickmuster spazieren tragen, wie Ratze, und daher mehr oder minder geschworene Feinde Qanas sind.
Und wenigstens die Hälfte dieser Modelle – schätze ich mal – könnte Ratze verklickern, daß und warum die Konzepte „zufällig“ und „kausal“ einander nicht entgegen gesetzt sind, vielmehr Bestandteil desselben Erklärungshorizontes und -Schemas.
Tu das einer mal – vielleicht als gute Tat zu Weihnachten. Der Ratze dreht sonst womöglich ernsthaft ab.
Danke im voraus.
Anregung: Ich gehe gleich aus dem Haus. Erkläre einer Ratze, warum es zugleich ein zufälliger und „notwendiger“ – im Sinne von kausaler – Vorgang wäre, falls mir unterwegs ein Dachziegel die Birne zerschmetterte.
Jetzt wird es auch noch witzig, das Qana.
Was soll ein angeblich anlassloser und einwirkungsfreier „spontaner“ Kernzerfall mit einem zufälligen Zusammentreffen von Umständen im Leben eines schrägen Vogels zu tun haben? Das verrennt sich nur noch.
Frohe, nachdenkliche Weihnachten!
Ich versuche es nochmal diesem Laien hier den Unterschied zwischen „kausal“ und „akausal“ zu erklären. Dazu muss man erste einmal verstehen, dass es in der modernen Physik und dem modernen Denken ZWEI verschiedene Arten von „Zufall“ gibt.
a) „Zufall“ im Sinne von _unvorhersehbar für uns_. Beispiele: Würfel oder mehrgliedriges Pendel. Das Ergebnis eines Würfelwurfes oder die Bewegung eines über ein gewisses Maß hinaus angestoßenes, mehrgliedriges Pendels ist natürlich kausal bedingt. Aber wir können es nicht vorhersehen wegen solchen Aspekten wie die Vielfalt der Einflussgrößen, die unsere Erfassungsmöglichkeiten übersteigen, und/oder wegen des Einfluss von kleinsten Faktoren die bei geringster Ungenauigkeit der Erfassung zu riesigen Unterschieden im Ergebnis führen können. Hier etwa „Schmetterlingseffekt“, Chaostheorie. Noch einmal: das ist kein Zufall im Sinne einer Akausalität sondern _Zufall aufgrund von Nichtwissenkönnen_. Unter diesen Aspekt fallen auch die zufälligen Begebenheiten unseres täglichen Lebens. Alle solche Begebenheiten sind natürlich kausal bedingt. Nur ist es in vielen Fällen nicht möglich, die Überschneidung von unterschiedlichsten Kausalketten vorherzusagen – aufgrund der unüberschaubaren Anzahl von möglichen und tatsächlichen Einflussgrößen.
b) „Zufall“, der auf Akausalität beruht. Diese Begrifflichkeit von Zufall hat erst mit der modernen Physik Eingang in das menschliche Denken gefunden. Soweit ich weiß, genau nämlich mit der Behauptung, dass natürliche, „spontane“ Kernzerfälle unvorhersehbar „zufällig“, weil akausal und „spontan“, erfolgen würden.
Diese zweite Art Zufall ist also völlig neu in der Geistesgeschichte der Menschheit. Alleine die Tatsache, dass dieser Fakt so unbekannt und unterbelichtet ist, zeigt schon, dass da was faul ist.
Freies Denken macht froh. Frohe Weihnacht!
Punktlandung.
Noch eine kleine Ergänzung der Termini: Unser Verständnis von Zufall nennt sich „Deterministisches Chaos“.
Mit anderen Worten: Der Eindruck des Zufalls entsteht durch unvollständige Information.
Der Würfel benötigt den Menschen, um Zufallsfunktion sein zu können.
Echte Zufälle sind bis jetzt nicht bekannt und/oder nicht ausreichend erforscht.
Wie sagte Einstein? „Gott würfelt nicht.“
Mich beschleicht aber auch der Verdacht, dass @Qana genau das gemeint haben könnte…
„Punktlandung“? – Grober Unfug! Aus verschiedenen Gründen, aber im Zentrum steht dies:
Das ist NO THING, schon methodisch, weil eine Negation keine Bestimmung ist. Klar „gibt“ es sowas, nämlich als Spekulation, und es ist wahr, daß sich Physiker auf der Basis der Formelapparate der Quantenphysik zu reiner Spekulation ermächtigen.
Die simple Basis davon ist, daß diese Apparate keine linearen Raumzeit-Operatoren von der Gestalt enthalten, wie die ART sie verwendet. Nicht daß ich mich in den Details auskennen täte! Aber solche linearen Operatoren braucht es, um Transformationen vorwärts und rückwärts auszuführen, und dies „vorwärts und rückwärts“ ist Voraussetzung für Zuweisungen der Sorte „Ursache (Grund) – Wirkung (Folge)“.
Die Quantentheorien – beginnend mit Plancks Konstante, zu der es oben ein Video gibt – stellen daher materielle Lücken in etwas dar, was NICHT materiell ist:
Ein deterministisches Weltbild.
Aber die Quantentheorien funktionieren auf etlichen Feldern, die oben mehrfach angesprochen waren (z.b. der Tunneleffekt, der eine Erklärung des Beta-Zerfalls liefert), wie deterministische Theorien, nämlich technisch
C’est tout.
„Der Eindruck des Zufalls entsteht durch unvollständige Information.“
Wobei es da auch noch zwei Varianten gibt:
1) unvollständige Information aufgrund von ungenügender Information (aber prinzipiell wäre vollständige Information möglich. Sie ist nur zu aufwändig zu erlangen. Beispiel hierfür wäre eine viel zu lange Kausalkette, als dass diese vollständig erfasst werden könnte, zB das unerwartete „zufällige“ Treffen mit einem lange nicht gesehenen und gesprochenen Freund, etc)
2) unvollständige Information aufgrund von der Unmöglichkeit, vollständige Information erlangen zu können. (hier gehört die „Heisenbergsche Unschärferelation“ hin: es ist für uns nicht möglich, gleichzeitig Ort und Impuls eines Elementarteilchens zu bestimmen, da jede Messung entweder den Ort oder den Impuls des Teilchens verändert, unkenntlich macht.)
Aber, zum letzten Satz: was Qana meinen könnte ist völlig in dessen Qualm verborgen, Spekulationen, was er meinen KÖNNTE, sind völlig vergebens. Jemand der nichts als Sülze produziert, einfach um ein Thema zuzulabern, hat nichts dazu beizutragen. Es will nur verwirren.
Qana ist der typische Fall von etwas, was meint, wenn man Wikiblödia kopieren kann, wäre das ein Plazet zum Mitreden. Verständnis, eigene Gedanken, Gesamtschau, Überblick? Fehlanzeige! Null!
Könnte eine „KI“ sein, oder das typische Beispiel eines Menschen, der sich dem Niedergang durch das Digitale anpasst. So wie wenn man am Telefon mit digitalen Automaten sein eigenes Reden dem Duktus des Automaten anpasst, so passen sich auch mehr und mehr Menschen dem inhaltslosen „Denken“ von Automaten an.
Tja, so geht’s halt zu, wenn Neonazis denken.
Übrigens hatte ich in meinem letzten Posting in der Eile Alpha- und Beta-Zerfall verwechselt. Aber Ratze will korrigieren, indem er enthirnt – sprich vergasen will, wenn sich das praktisch anbietet, damit das Volksgut des deterministischen Weltbildes vor vermeintlichen „Zersetzern“ geschützt bleibt.
Wenn der Qana-Qualm bisher nicht gestunken hat – jetzt stinkt er gewaltig.
Ekelhaft.
Für manche scheint die letzte Rettung ihres elenden Selbstbildes nur noch darin zu liegen, andere als Nazis zu beschimpfen.
Widerwärtig.
„Letzte Rettung“ stimmt offenkundig nicht, denn hierunter steht noch was.
Mit der Erwähnung von Planck und dessen Einführung des „Wirkungsquantums“, da seine Formeln für Strahlung sonst zu unendlich großen Energien geführt hätten, wurde immerhin ein gutes Stichwort geliefert (zwischen ausgemachtem Blödsinn). Damit fing tatsächlich das ganze Elend des nichts mehr Verstehens in der Physik an. Es ist die ganze Un-Anschaulichkeit und Paradoxie gegenüber Erfahrungen unseres täglichen (makroskopischen) Lebens.
Ich will damit keineswegs sagen, dass unsere täglichen Erfahrungen eine sichere Richtschnur für Richtigkeit sein könnten. Warum war die Vorstellung, dass die Erde um die Sonne kreist, im Mittelalter so unvorstellbar? Weil unsere, und die Erfahrung des mittelalterlichen Menschen natürlich erst recht, die ist, dass nicht gehaltene Körper auf den Boden fallen. Nun gibt es schon immer Gegenbeispiele: die Vögel, ein geworfener Stein, ein Pfeil, ein Speer, ein Papierdrache, heute Ballons, Flugzeuge, Raketen. Aber zu all diesen Gegenbeispielen ist auch die Beobachtung gemacht worden, dass Vögel, geworfene Gegenstände, ja auch Ballons und Flugzeuge doch auch immer wieder zurück zum Boden kommen. (Raketen sind die erst spät hinzugekommenen echte Ausnahme).
Es war für den mittelalterlichen Menschen schlicht undenkbar, dass schwere Körper wie Sonne, Mond und Planeten frei im Raum schweben könnten. Auch nicht auf Kreisbahnen. Und daher sah der mittelalterliche Mensch die Sonne, Planeten, den Erdmond, Kometen, die Sternen, an Himmelsschalen befestigt. Und da alles sich anscheinend um die Erde bewegte, war eben die Erde das Zentrum der Welt, wie das _Alles_ damals noch hieß.
Heute sind wir mit anderen Unanschaulichkeiten konfrontiert. Das begann mit der Beobachtung, dass sich Wellen durch den Raum bewegen, ohne dass man für diese Wellen einen Träger, ein Medium, identifizieren könnte. Wir kennen aus der Anschauung aber nur Wellen, die eben einen solchen Träger haben: Wasserwellen, Schallwellen in der Luft, Wellenbewegungen an einer gerüttelten Schnur, auf Saiten, auf Trommelfellen, Erdbebenwellen.
Damit verbunden kommt gleich die nächste Unanschaulichkeit: der Welle-Teilchen-Dualismus, der von Plancks Lichtquant seinen Ausgang nahm. Es ist der Gipfel nicht nur der Unanschaulichkeit sondern pure Widersprüchlichkeit und schlicht unmöglich, dass etwas örtlich-punktuell – als Teilchen – und gleichzeitig ebenso räumlich ausgebreitet – als Welle – existieren können soll. Damit sind die Ausgangspunkte unseres heutigen Dilemmas ausgemacht.
Die Beobachtungen und darauf aufgebauten Theorien führten schließlich dazu, dass heute Paradoxie und Unanschaulichkeit geradezu als Qualitätsmerkmal von Wissenschaft angesehen wird. Auf die unverstandene Verballhornung „Alles ist relativ“ wurde schließlich geradezu der Glaubenssatz „Unverständlich, also Wissenschaft und daher richtig“ aufgesetzt. Und „wissenschaftlich“ begründet und untermauert wird das ganze, indem behauptet wird, diese Dinge ließen sich nur noch mathematisch beschreiben und verstehen, und daher wäre jedes Unterfangen eines Laien moderne Physik zu verstehen, sowieso prinzipiell zum Scheitern verurteilt. Damit macht sich die (akademische) Wissenschaft unangreifbar. Dabei wurde das Gros des sicheren wissenschaftlichen Bestandes nicht von akademischen Wissenschaftlern, sondern von interessierten Laien entwickelt. Angefangen mit der Alchemie, in der, sehr langsam, über sehr lange Zeit hin, die Methoden des Experimentierens entwickelt wurden, bis hin zu exakter Naturbeobachtung und Beschreibung und dazu noch die Entwicklung der Mathematik – fast alles Laien, fast alles Autodidakten, die den Grundbestand unseres heutigen SICHEREN Wissens geschaffen haben.
Mit Planck und dem Strahlungs-Quant wurde das elementare Gegensatzpaar „Raum – Punkt“ aufgehoben. Einstein setzte das Zerstörungswerk fort, indem er die Gewissheit über elementare Begriffe wie der (einheitliche) Zeitverlauf in der Welt oder die eindeutige Ortszuweisung durch allgemeingültige Längenmaße (die eindeutige Ortsangabe im Koordinatensystem) oder die Konstanz einer unbeeinflussten Masse zerstörte, letztere würde angeblich mit deren purer unbeschleunigt-geradlinigen Bewegung, ihrer Geschwindigkeit (gegenüber was?) variieren. Wenn dem allem gewiss so wäre, wäre es eben so. Aber es sind zu viele offensichtlichen Lücken und Inkonsequenzen – ja eindeutigen Fehler – in dem Konstrukt, vom Kleinsten, Atome, Elementarteilchen, bis hin zum Größten, dem Kosmos. Ich habe einige hier aufgeführt. Und die erwartbare Stagnation einer immer stärker fehlgehenden Wissenschaft ist heute deutlich beobachtbar.
Man mache sich nur einmal klar, was für ein Rechtfertigungsdruck auf den Großforschungseinrichtungen (CERN, Ligo, Virgo, …) lastet, die ihre Millionenbudgets verteidigen wollen aber keine Ergebnisse mehr liefern können, da die ja im Rahmen der immer falscher werdenden Hypothesenkonstrukte liegen sollten. Kein Wunder, dass man da auf jede in die scheinbar richtige Richtung weisende Falschmessung aufspringt – ja vielleicht sogar Falschmeldungen produziert um weiter finanziert zu werden.
Ein abgeschlossenes Milieu, selbst-reproduzierend durch Lehre und Dogmenverbreitung in Wort und Schrift, Auslese nach Kriterien des Selbsterhalts und der Selbstbestätigung des Zirkels, verbunden mit einer gesellschaftlichen-politischen Subventionierung und Alimentationskultur, die erhalten oder gar gesteigert werden will – das waren im Mittelalter die klerikalen und sind heute die akademischen Zirkel, die an den Schaffenden und produktiv Tätigen nassauernd und durch politische und hyperreiche Unterstützung immer weiter auf Abwege geraten, sich immer weiter in Schwurbel- und Lügengespinsten verfangen. Denn eine Umkehr würde das Eingestehen von gewaltigen Fehlern und Fehleinschätzungen an Sachthemen und Personen bedeuten. Reputationsverlust ist heute der größte Schmach in der „Wissenschafts-Society und -Community“. Beim Einzelnen wie auch im Gesamten. Also arbeitet der Einzelne wie auch das Gesamte möglicher Eingeständnissen von grundlegenden Fehlern entgegen. Dazu muss sich der Einzelne keineswegs im Klaren darüber sein, um was es im Großen und Ganzen geht: das Ganze zu verteidigen scheint ihm als Akt der Selbstverteidigung und dient ihm zugleich zur Selbstvergewisserung.
Nun, wenn die Menschheit lange genug überlebt wird sie auch das Überwinden.
Der Zufall, daß ein Ziegel mein Hirn zerschmettert, ist kein anderes Wort für „unzureichende Information“, beruht vielmehr auf dem Umstand, daß der singuläre Zusammenhang zwischen mir und dem Ziegel darin besteht, daß wir beide dem selben Ereignisraum angehören.
Dieser Zusammenhang bestimmt, daß mir irgendwann notwendig ein Ziegel auf den Deetz fällt, vorausgesetzt, ich lebe lang genug und kann obendrein noch laufen oder einen Rollstuhl bedienen. Warum? Weil der singuläre Grund des Vorgangs die beschleunigte Masse des Ziegels ist, die ihm eigen ist, ob er nun auf dem Dache ruhe, oder von ihm falle.
Ob er falle, oder nicht falle, und ob in mich zum selben Zeitpunkt in seinem Fallweg aufhalte, hat anders herum unverbundene Ur-Sachen, die für das Eintreten oder Nicht-Eintreten des Ereignisses GLEICH – gültig sind. Diese Gleich-Gültigkeit bestimmt, daß keine dieser Ursachen für einen Grund, eine Kausa qualifiziert.
Dies Posting hat mit dem voran gegangenen die Verbindung, daß es einen kausalen Grund für die Vergaser-Mentalität von Neonazis des Ratze’schen Schlages anbietet.
Aberglaube.
Hier gehört das Gedankenspiel vom allwissenden, Laplaceschen Dämon her, und die Frage, ob dieser Dämon, der alles über die aktuellen Gegebenheiten des Kosmos wissen würde, damit die weiter Entwicklung, die Zukunft, voraussagen können müsste.
Heute müsste man bei diesem Gedankenspiel mit Dämon noch bestimmen, ob der dem Nichtwissenkönnen aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation unterliegen solle womit er die Zukunft nicht aus dem ihm vorliegenden Wissen deduzieren könnte aufgrund mangelnder Vollständigkeit der Information – oder eben, ob Kernzerfall kausal oder akausal ist. Im letzteren Fall wäre dem Dämon damit auch die Deduktion der Zukunft verwehrt.
Aber für uns als Beruhigung bezüglich unseres Freien Willens bleibt auf jeden Fall der Ausweg aus dem Determinismus aufgrund der Heisenbergschen Unschärfe bestehen.
Und hier zum guten Ende noch etwas im Netz anzuschauen:
h#ttps://albrecht-storz.hier-im-netz.de/
„Merke: Geschwindigkeit ist eine völlig willkürliche Zuweisung [bezüglich einer prizipiell frei wählbaren Referenz] die überhaupt keine physikalischen Konsequenzen haben kann oder Veränderung bewirken kann, solange nicht eine Wechselwirkung mit einem anderen Körper oder mit einem Feld erfolgt. Die „magischen Auswirkungen“ die in der Speziellen Relativitätstheorie der wahlweise, je nach Bezug, auswechselbaren Geschwindigkeitszuweisungen zugeschrieben werden, sind pure Beobachtungsphänomene oder Verwechslungen von Ursache und Wirkung. Masse beispielsweise kann nicht von einer rein nominalen Geschwindigkeitszuweisung abhängig sein [sich schnell bewegende Objekte sollen massereicher sein als „unbewegt“], sondern höchstens von einer energetischen Einwirkung, einer Ursache, wie es eine Beschleunigung ist – die natürlich wiederum zugleich Änderungen bei der Relativ-Geschwindigkeit bedingt.“ (Nicht-Einstein)
Oh, gehörte hier her:
Mit der Erwähnung von Planck und dessen Einführung des „Wirkungsquantums“, da seine Formeln für Strahlung sonst zu unendlich großen Energien geführt hätten, wurde immerhin ein gutes Stichwort geliefert (zwischen ausgemachtem Blödsinn). Damit fing tatsächlich das ganze Elend des nichts mehr Verstehens in der Physik an. Es ist die ganze Un-Anschaulichkeit und Paradoxie gegenüber Erfahrungen unseres täglichen (makroskopischen) Lebens.
Ich will damit keineswegs sagen, dass unsere täglichen Erfahrungen eine sichere Richtschnur für Richtigkeit sein könnten. Warum war die Vorstellung, dass die Erde um die Sonne kreist, im Mittelalter so unvorstellbar? Weil unsere, und die Erfahrung des mittelalterlichen Menschen natürlich erst recht, die ist, dass nicht gehaltene Körper auf den Boden fallen. Nun gibt es schon immer Gegenbeispiele: die Vögel, ein geworfener Stein, ein Pfeil, ein Speer, ein Papierdrache, heute Ballons, Flugzeuge, Raketen. Aber zu all diesen Gegenbeispielen ist auch die Beobachtung gemacht worden, dass Vögel, geworfene Gegenstände, ja auch Ballons und Flugzeuge doch auch immer wieder zurück zum Boden kommen. (Raketen sind die erst spät hinzugekommenen echte Ausnahme).
Es war für den mittelalterlichen Menschen schlicht undenkbar, dass schwere Körper wie Sonne, Mond und Planeten frei im Raum schweben könnten. Auch nicht auf Kreisbahnen. Und daher sah der mittelalterliche Mensch die Sonne, Planeten, den Erdmond, Kometen, die Sternen, an Himmelsschalen befestigt. Und da alles sich anscheinend um die Erde bewegte, war eben die Erde das Zentrum der Welt, wie das _Alles_ damals noch hieß.
Heute sind wir mit anderen Unanschaulichkeiten konfrontiert. Das begann mit der Beobachtung, dass sich Wellen durch den Raum bewegen, ohne dass man für diese Wellen einen Träger, ein Medium, identifizieren könnte. Wir kennen aus der Anschauung aber nur Wellen, die eben einen solchen Träger haben: Wasserwellen, Schallwellen in der Luft, Wellenbewegungen an einer gerüttelten Schnur, auf Saiten, auf Trommelfellen, Erdbebenwellen.
Damit verbunden kommt gleich die nächste Unanschaulichkeit: der Welle-Teilchen-Dualismus, der von Plancks Lichtquant seinen Ausgang nahm. Es ist der Gipfel nicht nur der Unanschaulichkeit sondern pure Widersprüchlichkeit und schlicht unmöglich, dass etwas örtlich-punktuell – als Teilchen – und gleichzeitig ebenso räumlich ausgebreitet – als Welle – existieren können soll. Damit sind die Ausgangspunkte unseres heutigen Dilemmas ausgemacht.
Die Beobachtungen und darauf aufgebauten Theorien führten schließlich dazu, dass heute Paradoxie und Unanschaulichkeit geradezu als Qualitätsmerkmal von Wissenschaft angesehen wird. Auf die unverstandene Verballhornung „Alles ist relativ“ wurde schließlich geradezu der Glaubenssatz „Unverständlich, also Wissenschaft und daher richtig“ aufgesetzt. Und „wissenschaftlich“ begründet und untermauert wird das ganze, indem behauptet wird, diese Dinge ließen sich nur noch mathematisch beschreiben und verstehen, und daher wäre jedes Unterfangen eines Laien moderne Physik zu verstehen, sowieso prinzipiell zum Scheitern verurteilt. Damit macht sich die (akademische) Wissenschaft unangreifbar. Dabei wurde das Gros des sicheren wissenschaftlichen Bestandes nicht von akademischen Wissenschaftlern, sondern von interessierten Laien entwickelt. Angefangen mit der Alchemie, in der, sehr langsam, über sehr lange Zeit hin, die Methoden des Experimentierens entwickelt wurden, bis hin zu exakter Naturbeobachtung und Beschreibung und dazu noch die Entwicklung der Mathematik – fast alles Laien, fast alles Autodidakten, die den Grundbestand unseres heutigen SICHEREN Wissens geschaffen haben.
Mit Planck und dem Strahlungs-Quant wurde das elementare Gegensatzpaar „Raum – Punkt“ aufgehoben. Einstein setzte das Zerstörungswerk fort, indem er die Gewissheit über elementare Begriffe wie der (einheitliche) Zeitverlauf in der Welt oder die eindeutige Ortszuweisung durch allgemeingültige Längenmaße (die eindeutige Ortsangabe im Koordinatensystem) oder die Konstanz einer unbeeinflussten Masse zerstörte, letztere würde angeblich mit deren purer unbeschleunigt-geradlinigen Bewegung, ihrer Geschwindigkeit (gegenüber was?) variieren. Wenn dem allem gewiss so wäre, wäre es eben so. Aber es sind zu viele offensichtlichen Lücken und Inkonsequenzen – ja eindeutigen Fehler – in dem Konstrukt, vom Kleinsten, Atome, Elementarteilchen, bis hin zum Größten, dem Kosmos. Ich habe einige hier aufgeführt. Und die erwartbare Stagnation einer immer stärker fehlgehenden Wissenschaft ist heute deutlich beobachtbar.
Man mache sich nur einmal klar, was für ein Rechtfertigungsdruck auf den Großforschungseinrichtungen (CERN, Ligo, Virgo, …) lastet, die ihre Millionenbudgets verteidigen wollen aber keine Ergebnisse mehr liefern können, da die ja im Rahmen der immer falscher werdenden Hypothesenkonstrukte liegen sollten. Kein Wunder, dass man da auf jede in die scheinbar richtige Richtung weisende Falschmessung aufspringt – ja vielleicht sogar Falschmeldungen produziert um weiter finanziert zu werden.
Ein abgeschlossenes Milieu, selbst-reproduzierend durch Lehre und Dogmenverbreitung in Wort und Schrift, Auslese nach Kriterien des Selbsterhalts und der Selbstbestätigung des Zirkels, verbunden mit einer gesellschaftlichen-politischen Subventionierung und Alimentationskultur, die erhalten oder gar gesteigert werden will – das waren im Mittelalter die klerikalen und sind heute die akademischen Zirkel, die an den Schaffenden und produktiv Tätigen nassauernd und durch politische und hyperreiche Unterstützung immer weiter auf Abwege geraten, sich immer weiter in Schwurbel- und Lügengespinsten verfangen. Denn eine Umkehr würde das Eingestehen von gewaltigen Fehlern und Fehleinschätzungen an Sachthemen und Personen bedeuten. Reputationsverlust ist heute der größte Schmach in der „Wissenschafts-Society und -Community“. Beim Einzelnen wie auch im Gesamten. Also arbeitet der Einzelne wie auch das Gesamte möglicher Eingeständnissen von grundlegenden Fehlern entgegen. Dazu muss sich der Einzelne keineswegs im Klaren darüber sein, um was es im Großen und Ganzen geht: das Ganze zu verteidigen scheint ihm als Akt der Selbstverteidigung und dient ihm zugleich zur Selbstvergewisserung.
Nun, wenn die Menschheit lange genug überlebt wird sie auch das Überwinden.