
Noch ist das Klonen von Menschen verboten. Bei Tieren wird die genetische Reproduktion aber aus wirtschaftlichen Gründen gemacht. Oder Menschen meinen, dass sie ein von ihnen geliebtes Haustier wieder um sich herum haben wollen, wie das etwa der argentinische Präsident Milei mit seinem Mastiff Conan gemacht hat, der sich gewissermaßen vervierfacht hat.
Allerdings ist das Problem, dass ein Klon genetisch identisch mit dem geklonten Lebewesen ist, aber er wird sich anders verhalten und eine andere Persönlichkeit entwickeln, weil sich die Geschichte nicht wiederholt, man nicht zweimal in denselben Fluss steigen kann, wie schon Heraklit sagte. Daher fehlen dem Klon auch die Erinnerungen. Was weiterlebt, ist dann selbst nur eine biologische Kopie und bestenfalls eine Erinnerung an einen Verstorbenen.
Tech-Enthusiasten sind meist nicht nur Anhänger von Vorstellungen, den Tod durch Anti-Aging-Methoden hinausschieben oder gar als behebbare Krankheit zur Unsterblichkeit verdrängen zu können. Manche lassen sich einfrieren in der Hoffnung, dass später Menschen willens sein werden, sie mit künftiger Technik wieder lebendig und gesund zu machen. Da hatte es das Christentum einfacher: Den Gläubigen wurde die Wiederauferstehung im Himmel versprochen, aber mit einem gesunden Körper eines 30-Jährigen, da in dem Alter Jesus wiedergeboren und in den Himmel aufgefahren ist. Vor 30 Jahren entstand mit dem Transhumanismus und den Anfängen der VR-Technik die Idee, man könne doch sein Gehirn auf einen Computer oder ins Netz laden bzw. kopieren, was allerdings schwer nachvollziehbar war, zumal wenn das Gehirn in einen biologischen Körper eingebettet ist.
Jetzt hat der 89-jährige Alan Hamel, in den USA ein bekannter Fernsehpromi, seine vor zwei Jahren an Krebs gestorbene Frau Suzanne Somers als KI-Klon bzw. Suzanne KI-Zwilling wiederauferstehen lassen. Zumindest verkauft er dies so. Er sagt, es sei ihr Wunsch gewesen, als Klon weiterzuleben. Wollte sie die Bühne nicht verlassen und die Aufmerksamkeit verlieren? Oder will er sie tatsächlich weiter irgendwie neben sich haben? Oder geht es nur um ein kommerzielles Projekt? Angestoßen worden sei die Idee durch die Bekanntschaft mit dem KI-Propheten Ray Kurzweil, der schon seit Jahrzehnten vom Durchbruch zur Singularität der KI träumt.
Sie war bei ihrem Tod 76 Jahre, beide haben 55 Jahre zusammengelebt. Er hat also viel Erfahrung von und mit ihr. Suzanne war Schauspielerin, auch im Fernsehen tätig, hat Hunderte von Interviews geführt und 25 Bücher, einige Bestseller, geschrieben, meist über Gesundheitsthemen, mit dem Verkauf von Medikamenten und Kosmetika machte sie auch Geschäfte. Es gab also viel Material von ihr, um die KI mit Äußerungen von ihr zu füttern, die als Quelle dienen, damit der digitale Klon nun einigermaßen persönlich und in ihrer Sprechweise auf Fragen antworten kann. Beim ersten Gespräch mit ihr sei er für zwei oder drei Minuten befremdet gewesen, sagte Hamel People, aber dann habe er vergessen, dass er mit einem Roboter spricht.
Die Geschäftsidee ist allerdings banal. Wenn der KI-Klon vollendet ist, soll er auf der Website des Online-Shops von Domers, auf dem weiterhin Kosmetika verkauft werden, eingebaut werden: „Wir werden alle ihre Fans und alle unsere Kunden einladen, zu kommen und mit ihr zu sprechen. Sie können einfach vorbeikommen und mit ihr plaudern. Sie können ihr alle Fragen stellen, die sie möchten. Sie wird rund um die Uhr verfügbar sein, und ich denke, das wird wirklich wunderbar sein. Es wird Leute geben, die ihr Fragen zu ihren Gesundheitsproblemen stellen, und Suzanne wird ihnen antworten können. Nicht mit Suzannes Version der Antwort, sondern direkt mit der Antwort des Arztes, den sie zu genau diesem Thema interviewt hat, also von einem Mediziner.“
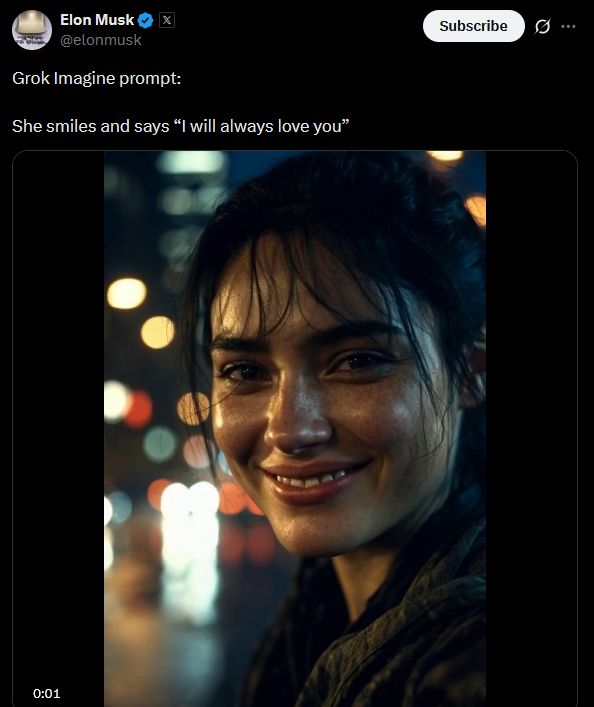
Hamel reichte es aber nicht, nur einen Chatbot-Klon von ihr zu erstellen, er wollte sie offenbar auch mit einem Roboterkörper wiederauferstehen lassen – nicht in hohem Alter, sondern als junge Frau. Das war bekanntlich auch den frühen Christen wichtig, dass die Wiederauferstehung im Himmel mit einem intakten, gesunden und relativ jungen Körper im Alter des gekreuzigten Jesus geschieht. Da steht sie nun, offenkundig eine Maschine, deren Gesicht kaum Ähnlichkeit mit ihr hat und keineswegs lebendig wirkt, auch nicht die Bewegungen des Roboters. Hamel scheut nicht davor zurück, den KI-Zwilling als täuschend echt zu bezeichnen. Hersteller ist die Firma Realbotix, die personalisierte Roboter im Aussehen, mit Stimme, Mimik, KI-Klon anbietet – eine billigere Kopf-Brust-Variante, die allerdings ziemlich spooky ist, und teure Vollkörperroboter, die aber nicht gehen, sondern nur rollen können. Nichts für arme Schlucker, es sei denn, man legt von sich selbst einen Billigklon an mit hollo.ai.
Wahrscheinlich wird es bald von virtuellen KI-Klonen von lebenden Personen wimmeln, und auch solche von Verstorbenen, die zu einem irdischen Nachleben wiedererweckt werden, werden sich auf die Bühnen drängeln. Eigentlich ist es ja unheimlich, wenn solche Zombies, die untot oder eher unlebendig sind, weiter existieren und sich vielleicht auch durch Lernen weiterentwickeln. Andererseits können sie sich (noch?) nicht wehren und sind problemlos entsorgbar, wenn man genug davon hat.
Offenbar können wir die Irreversibilität des Todes nicht wirklich akzeptieren. Vornehmlich in der Tech-Kultur gibt es den Wunsch nach einem langen Leben durch Optimierung, Anti-Aging, Gentechnik oder Kryonik, aber auch durch Digitalisierung. Gleichzeitig gibt es in vielen Kulturen, wenn nicht in allen, eine Angst der Lebenden vor den Toten, wenn sie nicht ganz tot sind und wiederkehren, eine Nekrophobie. Deswegen müssen in vielen Kulturen die Toten schnell beerdigt werden, die sonst als Schatten oder Untote umherirren und die Lebenden belästigen und ängstigen.
Ähnliche Beiträge:
- Kryonik: Vorsorge für die Wiederauferstehung mit schwierigen Fragen
- Roboter, die ihren festen Körper verflüssigen und wiederherstellen können
- Roboter sollen verstehen, wie es ist, ein Mensch zu sein
- Bewusste KI? – Ja, wessen denn, zum Teufel?
- Wenn KI das Denken übernimmt und die Gehirne befreit



Bild: Realbotix
„Das gute Modell kostet ab 175k das mittlere ab 135k nur der Kopf ab 20k“
Quelle: Netzfund
Das sieht man dem Klo(w)n aber nicht an.
Die Frage ist doch: Hat Hamel Aktien der Firma Realbotix in seinem Portfolio?
–
Nachtrag:
Kann doch nicht so schwer sein…
„Beim ersten Gespräch mit ihr sei er für zwei oder drei Minuten befremdet gewesen, sagte Hamel People, aber dann habe er vergessen, dass er mit einem Roboter spricht.“
Das ist der springende Punkt. Bei offenbar immer mehr Menschen ist der innere Wesenskern bereits so stark erodiert, dass es für sie keine Rolle mehr spielt, ob sie mit mit einem Computer quatschen oder mit echten Menschen.
Bei den Betagten in Japan, die immer mehr mit Robotern statt Pflegekräften (oder Angehörigen) reden, mag Demenz eine Rolle spielen, jüngeren hat vielleicht eher das Smartphone die Seele und den Verstand abgesaugt.
Es zeigt sich auch eine zunehmende Verflachung echter Empathie, die von egozentrischer Bedürfnisbefriedigung abgelöst wird: Hauptsache, das Gegenüber redet so, wie es einem gefällt und ist auf Verlangen zur Stelle ‒ die fehlende echte Interaktion auf emotionaler Ebene und das unnötige Eingehen auf die Befindlichkeiten werden eher als entlastend denn als Defizit erlebt.
Kurz: seelenlose Zombies quatschen mit Computern. Die meisten Menschen sind wohl noch nicht an diesem Punkt.. aber die Grenzen sind fliessend.. und viele sind erkennbar auf dem Weg dahin.
Der Hirnfick durch soziale Medien, Apos auf dem Smartphone usw usf. verdirbt den Charakter. Die eigensüchtige Bedürfnisbefriedigung wird dort ja gezielt ausgenutzt um den Benutzer zu an das Gerät zu binden. Eigentlich sollte man Smartphones Skinnerphones nennen nach Skinners Kisten mit den Ratten drin. Immer schön die Gier kitzeln.
Und was machen wir hier? Mit „echten Menschen“ reden?
Ob Deine Zeilen oben von einem Menschen verfasst wurden,
ob „Zebraherz“ einen Menschen bezeichnet, woher soll ich das
wissen? Ich kann nur den Text lesen, der unter Deinem Namen
steht, ihn interpretieren und versuchen mir vorzustellen, was
für ein Mensch das wäre, der da schreibt.
So eine personalisierte KI scheint ja für einige das nächste große Ding zu sein. Ich hörte kürzlich ein Interview mit dem Geschäftsführer einer deutschen Firma (Name leider vergessen), die so etwas macht oder machen will. Erster prototyp ist der GF selbst. Die KI wurde mit mehreren 10.000 seiner E-Mail gefüttert, dazu Geschäftsberichte der Firma, Kundenverträge etc.pp. Die KI soll dann, als Avatar, an Verhandlungen mit Kunden teilnehmen, wenn der Chef selbst keine Zeit hat.
Kunde kann natürlich auch eine andere Firma sein, die ihrerseits einen KI-Avatar als Chef benutzt, wenn der keine Zeit hat. Dann mal fröhliches dealen… 😁
Ja natürlich, ist ja das Ziel der Fa., solche KI-Modelle zu verkaufen.
Es ist bestimmt schon 15 Jahre her, als es noch Anrufbeantworter auf dem Tisch gab,
da hat ein automatischer Anrufdienst einem Anrufbeantworter etwas am Telefon
verkauft. Daraufhin kam der Gesetzgeber ins grübeln und die Gesetze wurden
verändert.
Es ist heute schon Praxis, dass KI bis zu einem gewissen Maße Verhandlungen überlassen werden. Größere Abschlüsse macht ein GF nicht ohne seine Rechtsabteilung. Und da kommt es oft vor, dass man sich gegenseitig mit ellenlangen Vertragsentwürfen und Änderungsvorschlägen förmlich überflutet. Weil es zu lange dauern würde, den ganzen Kram zu lesen, setzt man KI ein, die dann auch direkt Gegenvorschläge machen kann.
„Die KI wurde mit mehreren 10.000 seiner E-Mail gefüttert, dazu Geschäftsberichte der Firma, Kundenverträge etc.pp.“
🤣🤣🤣
und vorher musste DIE KI ein non disclosure agreement unterschreiben, damit sie diese geheimsten aller Geschäftsgeheimnisse (Vertragskonditionen und Vertragspartner) nicht ausplaudert! Und das
tut sie dann niemals, denn so eine kluge KI, die weiß ja, was ihr dann droht!
LEUTE, GEHTS NOCH? Merkt hier überhaupt noch einer was?
👆Hier, ich hab’s gemerkt:
Wirtschaftsspionage 😉
Na, ja, eines der berühmtesten Bilder der Menschheit, ist das Arnolfini Porträt von Jan van Eyck. Die dargestellte Frau war wahrscheinlich zum Datum der Fertigstellung schon verstorben, das Bild ein Versuch die Erinnerung festzuhalten.
Gemälde, Fotos, Filme, wir wollen das und vor allem die Menschen festhalten, die uns etwas bedeuten. Wie gut das gelingt, liegt an der eigenen Person und auch an der geistigen Fähigkeit.
Natürlich kann das auch dazu führen, dass jemand eine bewegliche Puppe haben möchte. Auch nichts Neues, Automaton gibt es seit den Zeiten der Antike. Eine Neuauflage, versehen mit Software, die Texte mit Bezug auf die gemeinsame Vergangenheit, oder einfach nur Banales wiedergibt, ist nur eine größere Ausgabe einer Puppe, die Druck „Mama“ sagt.
Dass sie einen Avatar mit entsprechender Software koppeln können, und dies als persönliche Beratung/Dienstleistung bereitstellen können, ist auch nichts Neues. Alle Vorgänge, die einem strikten Regelwerk, oder einem Skript folgen, mit relativ eingeschränkter Antwortmöglichkeit, können und werden so automatisiert werden. Die Umsetzung der DIN ISO 9001 legt dafür die Grundlagen.
Aber diese Entwicklung erzeugt natürlich nicht den gleichen emotionalen Effekt wie der Begriff Klon.
Geschäft ist Geschäft. Wem das nicht gefällt, der soll nicht nach Gesetzen heulen, sondern das Profitprinzip zum Teufel jagen. Da gehört es hin.
das (auch die Gier s. Musk 1 Billion $) ist schon so weit fortgeschritten… das will nicht mal der Teufel..
Vergiss die Gier, die ist nicht die treibende Kraft, sondern die Folge. Kannst nicht ein Wirtschaftssystem aufziehen, bei dem mehr immer mehr ist (es also nie reicht), und dann animistisch in die abhängigen Variablen (auch Elon ist eine) reingeheimnissen, sie wären die Ursache der Kraft, die auf sie wirkt.
Mal ganz im ernst. KI’s sind empathielose, soziopathische Monster. Sie wird ihm das erzählen was er hören will und ihn dann fertig machen.
Na und? Beim Geldmachen stört das emotionale Getue doch nur.
Ob es nur um das Erzählen geht? Vielleicht will er ja weniger quatschen, als
die Ganzkörperfunktion des Avatars zu nutzen, so wie es früher auch mit der
echten Frau gewesen ist. Nur hatte die immer Kopfschmerzen.
Zu den Gummipuppen hat der Rötzer mal einen Telepolis-Salon gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=Si00mWcvwWU
Für mich in meinem zarten Alter sage, macht nur so weiter, ich bin ich und wenn der gevadder Tod ruft, bin. ich bereit mit ihm zu gehen.
Die Kunst alles verändern zu wollen, hat nichts göttliches, sie ist ein satanisches Blendwerk.Zur Zeit lebe ich auf einer touristischen Insel und gucke mir diese Weiber an mit ihren modifizierten Lippen, Brüste und Ärsche und empfinde das schrecklich. Diese Art ist ein Persönlichkeitsproblem und lässt tief in die Psyche der Manipulationen blicken,
Toll! Abermillionen geklonter Nazis überschwemmen das Land. Myriaden yon Dummdeppen vervielfachen sich. Prima.
Wer träumte nicht von einer solch verheißungsvollen Zukunft?
Welche Wahlergebnisse wird die grün-linke CDSPDU wohl erzielen, wenn sich diese Hanseln milliardenfach geklont haben? Soll so etwas eine lebenswerte Welt sein?
Sowas ist kranke, menschenfeindliche, satanistisch-globalistische Transhumanisten-Sche**e.
Wenn Sie gut Englisch können, googeln sie mal TESCREALISM, bei soviel neoliberaler, narzisstische Dummheit stehen Ihnen die Haare zu Berge, einige Namen kommen Ihnen vielleicht sogar bekannt vor, das ist Transhumanismus auf allen Drogen zusammen.
Die wollten sogar mal Luft zum atmen privatisieren……
Ich denke, das wollen die Globalisten immer noch. Zum Teil ist es ihnen mit ihrer „CO2-Bepreisung“ ja schon gelungen.
Und Sie haben das Recht auf unbegrenzten Abgas-Ausstoß in den Innenstädten – mit Ihrem hoch subventionierten SUV -, indessen Sie sich danach von ihrem anstrengenden Konsum im grünen Vorort erholen.
Die werden uns vor allem das Wasser nehmen…alles schon vorbereitet, weil das Grundwasser schon unter halb ist…aber was red ich..
Zum Abschluß meines Abends teile ich mal meine heutige Gute-Nacht-Musike, weil sie in euer Thema passt.
Da gibt es diese junge Frau, die für sich die bösen Geister von Jimmy und SVR gebannt hat, indem sie deren gute Geister für sich und bei sich aufgehoben hat. Denn jeder verdammte Ton ist original „Orianthi“, obwohl Ton und Technik der großen Ahnen darin mitschwingen:
„Voodoo Chile“
https://youtu.be/SRk7NzLtzc4?si=nRZeTJAwIUD_Lksu
Welch ein Gekniedel von Mädchen in Rockstarposen…
https://youtube.com/shorts/8Uut-vxCRFk?si=c0zX1EKYaTCFTa-K
*grins*
Ja, kann einer so sehen. Besonders dann, wenn er von guten wie bösen Geistern verlassen ist.
Aber vielleicht gibt es ja jemanden, den das Thema interessiert, deshalb stelle ich ein, was Orianthi mit „Voodoo Child“ gemacht hat, als sie noch ein Kind gewesen ist:
https://youtu.be/mK6tcgsKgps?si=PHY4NqOD8hLIubTp
Orianthi ist schon irre. Aber so ganz Kind war sie bei der Aufnahme nicht
mehr. Ich glaube sie war 19 Jahre alt. Gegenüber vielen Möchtegerngitarristen
kann sie wenigstens richtig mit der Gitarre umgehen. Es gibt noch viele Frauen,
deren Können viel zu wenig gewürdigt wird. Keine geklonte Puppe wird deren
Genialität nachmachen.
Shagawuhu mit Hirnspalte: Solange Deine Mutter noch ins Gebüsch kommt,
wird das nix mit Gummipuppen. Was hat Deine Mutter erzählt, Du kannt die
Dinger nicht aufblasen?
Sarkozy in Frankreich ist auch ohne KI wieder auferstanden. Nach nur 3 Wochen aus der Haft entlassen, angeblich wegen des Alters. Jetzt die Frage: Wie viele über 70 sitzen in Frankreichs Gefängnissen?
Na ja, La Garde ist ja schließlich auch auf freiem Fuß
😜
Keiner von denen kommt in den Knast, das müssen wir schon selber in die Hand nehmen.. sage ich schon seit 1974…!!
Da gehts mal wieder vor allem darum, viel Geld zu verdienen,egal mit was,typisch USA.
Bezeichnend auch ,dass da paralell ein Kosmetikshop mitspielt
https://www.wsj.com/tech/biotech/genetically-engineered-babies-tech-billionaires-6779efc8
https://www.wsj.com/tech/biotech/genetically-engineered-babies-tech-billionaires-6779efc8
dazu passt:
Der Führer schenkt den Klonen eine Stadt
https://www.youtube.com/watch?v=zI4A_mIwK9M&list=RDzI4A_mIwK9M&start_radio=1
Kapitalismus halt…nichts weiter… da kann man nichts machen… 😉
Hahaha, wie der aus Serenity (Firefly) der seine Sexpuppe geheiratet hat.
Mir täte der alte Sack ja leid, wenn er nicht derart offensichtlich Werbung für den Schwachsinn machen würde.
Ich kann von einem Selbstversuch berichten. Ich dachte, ich könne ja Zeit sparen, wenn ich meine Overton-Beiträge von der KI schreiben lasse. Ob sie bereit sei, meine Beiträge zu lesen und ein Abbild von mir zu erstellen? Und ob sie dann bereit sei, auf neue Artikel in meinem Sinne zu antworten? Ja, war die Antwort von Chat GPT. Damals gab es nur das. Was man ja dann so schalten könnte, dass es auch nach meinem Ableben weiter macht.
Aber dann der erste Versuch bei einem Artikel von Herrn Rötzer. Richtungsmäßig war das zwar richtig, aber dann doch nicht in meinem Sinne. Das war zu 99 Prozent entschärft. Das Markerschütternde fehlte. Und das Faustische. Die Nachwelt hätte den Eindruck gewonnen, ich sei Redakteur bei der Süddeutschen gewesen.
Dann eben nicht.
Wie auch in der Kunst: Eine Kopie reicht normalerweise NIE an das Original ran! Stellt Euch nur mal „Stones“-Klone vor, mit einem zusätzlichen ‚Brainchip‘, der synthetisierte ‚Erinnerungen‘ der Originale in diese Puppen uploadet. Wären das noch die ‚echten Stones‘? Eben! Das kreative Momentum unterscheidet eben den Menschen von einer Maschine und DAS kann nicht kopiert werden.
Ihr ALLE seid einmalig, also seid Euch dessen auch bewußt!
MfG
F.B.
Es wäre vor Allem sehr schwer, sich wieder an die jungen Gesichter von Keith Richard
und Mick Jagger zu gewöhnen. Ob es überhaupt möglich wäre Genmaterial zu finden,
mit dem man noch etwas anfangen kann ist auch sehr fraglich. Statt Keith Richard hat
man nach Abschluß des Klonprozesses wahrscheinlich ein Glas Whiskey vor sich stehen.
Als sie dann versucht haben, die Gesichter der Neanderthaler zu rekonstruiren, fiel mir auf, dass diese Ähnlichkeit mit den Rolling Stones hatten. Das fände irendwie sinnvoll, wenn wir die _Neanderthaler zurück züchten und dann endlich wieder ordentliche Rockmisik bekommen!
was für den Kriegsminister
Creepy und traurig..
Ich kann mir die Depression nur vorstellen die man schieben muss, wenn man erkennt, dass der Roboter halt doch nur ein Haufen Silikon und Motoren ist.. Menschen mögen zwar nicht perfekt sein, aber zumindest sind wir in gewisser Weise einzigartig..
Der gute Mann scheint auch nicht mehr besonders gut zu sehen ansonsten will mir nicht in den Sinn wie man so etwas mit einem echten Menschen verwechseln könnte..
Herr Milley hat seine geklonten Hundchen ja nach Ökonomen benannt.. Da kann man nur hoffen das die ökonomie nicht irgendwann kommt und ihm in den Arsch beißt.. 🐶😖
Mfg Makrovir
Also gibts bald den ewigen Trump mit KI von irgendwem?