
Wo Menschen zusammenleben, treffen Interessen und Meinungen aufeinander. Spannungen sind unausweichlich – aber um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern und einen Konsens zu finden, braucht es produktiven Streit und öffentliche Debatte. Ein Plädoyer.
Wir leben im permanenten Krisenmodus. Alte Gewissheiten verlieren ihre Gültigkeit, etwa die vom steten Wachstum, von Frieden und Wohlstand. Krisen sind in der modernen Gesellschaft kein Ausnahmefall, sondern der Normalzustand. Die einzige verlässliche Erwartung an die Zukunft besteht darin, dass noch weitere Krisen auf uns zukommen: Krieg, Flucht, Klima. Kurzum: Wir leben in einer fragilen Wirklichkeit. Politiker und Parteien verlieren an Vertrauen, auch die tragenden politischen und parlamentarischen Institutionen. Wo aber Vertrauen fehlt, entstehen Enttäuschung, Rückzug, Ignoranz und Teilnahmslosigkeit. Kein guter Zustand, denn unsere Demokratie lebt auch von der Hoffnung, dass Dinge besser werden. Der Verlust von Zukunftsglauben ist ein Problem für die Demokratie.
Die Tonlage hat sich geändert. Demagogen, Populisten und Untergangs-Propheten aller Couleur erkennen und nutzen ihre Chance, die Demokratie zu schwächen. Sie zeichnen das Zerrbild einer kaputten Republik, die von Eliten okkupiert wird und überhöhen die Probleme der Demokratie zu Identitäts- und Existenzfragen. Sie kostümieren sich als Retter des Abendlandes – und sie haben Erfolg damit.
An Streit-Anlässen herrscht kein Mangel: die Auswirkungen des Klimawandels, Krieg und Flucht, die Folgen der Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das antisemitische Massaker der Hamas und der folgende Krieg im Gazastreifen, das Erstarken von Nationalismus und Rechtspopulismus– da kommt vieles zusammen.
Demokratie braucht Widerspruch und Disput. Streit – ob in den Höhenlagen der Politik oder den Niederungen des Alltags – ist der Sauerstoff unserer Demokratie. Er ist gewissermaßen „systemrelevant“. Oder wie Helmut Schmidt schon festgestellte: „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.“ Kurzum: Wir sollten den Streit wertschätzen.
„Allzu eigensinniges Denken gilt als Normenverstoß. Die Herrschaft des Gleichen schätzt keine Aufmüpfigkeit“
Wie aber sieht es aus mit der allseits geforderten „Streit-Kultur“ im Land? Haben wir verlernt, uns gepflegt zu streiten? Ist die Debattenkultur in Deutschland „verkümmert“, wie die Süddeutsche Zeitung feststellt? Kann man seine Meinung nicht wirklich nicht mehr öffentlich äußern, ohne fürchten zu müssen, Opfer von Hassreden und Shitstorms in sozialen Medien zu werden? Tatsächlich gerät schnell in Verdacht ein nervender Streithansl oder eine narzisstische Querulantin zu sein, wer gegen allgemein-verträgliche Sichtweisen opponiert, auf der eigenen Meinung beharrt, um seinem Gegenüber zu sagen: Das sehe ich völlig anders! Allzu eigensinniges Denken gilt als Normenverstoß. Die Herrschaft des Gleichen schätzt keine Aufmüpfigkeit.
Dabei ist das Beharren auf die eigene Sichtweise nicht nur hilfreich, sondern Voraussetzung für einen konstruktiven Streit. Wankelmütigkeit und allzu große Flatterhaftigkeit in Bezug auf den eigenen Standpunkt verhindern eher einen guten Streitverlauf. Das Aufeinandertreffen von Meinungen, Haltungen und Positionen sollten wir nicht als Störung, sondern als demokratie-stärkenden Interaktion wertschätzen.
Streiten will gelernt und geübt sein. „Wer streiten kann, setzt sich mit Andersdenkenden auseinander“, sagt die Berliner Philosophin Svenja Flaßpöhler, denn: „Nur wo wir den Streit erlauben und ermöglichen, kann sich Demokratie beweisen.“ Damit ein Streit jedoch nicht eskaliert und die streitenden Parteien unwiederbringlich auseinandertreibt, müssen „die Bindungskräfte mächtiger sein als der Vernichtungsdrang“, nur so kann das Streiten eine konstruktive Richtung nehmen, so Flaßpöhler in ihrem Buch „Streiten“. Mit Genugtuung dürfen wir festhalten, dass ein guter Streit eine zivilisatorische Leistung ist, die unsere Demokratie hervorgebracht hat – und weiterhin voranbringt. Es wird nicht zu viel gestritten im Land, allenfalls schlecht, zu schrill, zu dumm, zu vulgär.
„Dissens, Aufbegehren, Widerstand sind keine Untugenden in einer freien Gesellschaft, sondern deren Grundlage“
Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und politisch sozialisiert worden. In Frankfurt wurde und wird immer gestritten. Engagiert und leidenschaftlich. Laut und zornig. Intensiv und kreativ. Rau und militant. An Anlässen herrschte kein Mangel: gegen Startbahn-West, für bezahlbaren Wohnraum. Für und gegen eine neue Altstadt, für eine andere Verkehrspolitik, gegen einen völlig überforderten Oberbürgermeister, der für alle eine Zumutung war, aber sich selbst penetrant großartig fand. Die Frankfurter Stadtgesellschaft hat ihn abgewählt. Streit gehörte und gehört zum Sound der Stadt. Und das ist gut so.
Dissens, Aufbegehren, Widerstand sind keine Untugenden in einer freien Gesellschaft, sondern deren Grundlage. Streit ist konstitutiv für die Demokratie – auf allen Ebenen: privat, kollektiv, institutionell. Nur durch ständige öffentliche Debatte können wir die unterschiedlichen Interessen erfolgreich koordinieren. Nur im Streit klären wir, was uns als Gesellschaft wichtig ist, welche Werte wir grundsätzlich vertreten wollen und welche politischen Entscheidungen wir als Gesellschaft zu tragen bereit sind. Am Ende aber steht der Kompromiss. Er darf nicht der Anfangspunkt einer streitbaren Diskussion sein, sondern deren Endpunkt.
Freilich, nicht jeder Streit ist anregend, erhellend und klug. Vor allem auf digitalen Plattformen wird beleidigt, gepöbelt, denunziert und erniedrigt. Von links und von rechts – und auch aus der sogenannten schweigenden Mitte. Ein mitunter schwer erträglicher rechtsfreier Echoraum, in dem Hass-Tiraden als freie Meinungsäußerung reklamiert werden. Auch in Talkshows und TV-Politrunden ist man gern auf Radau aus. Schon die Auswahl der Teilnehmenden folgt dieser Dramaturgie. Hier scheinen differenzierte Positionen weniger gefragt zu sein als laute Diskurs-Trompeten, die ihren Standpunkt möglichst schrill vorstellen. Der Volksmund sagt – möglicherweise aus gutem Grund: „Wer schreit, hat Unrecht.“ Wobei wir ebenfalls wissen: Auch im leisen, sanften Ton vermag sich die gemeine Lüge zu verstecken, die rhetorische Falschmünzerei, die bornierte Besserwisserei …
Wie und wodurch aber kann ein produktiver, ein erkenntnisreicher, guter Streit entstehen? Das Formulieren der eigenen Position, der Haltung, der These, des Gedankens, also das Deutlichmachen, wofür man steht, ist der erste Schritt eines produktiven Streits. Wenn alle Beteiligten den gleichen Raum und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, dann kann ein guter Streit beginnen.
„Nichts aber ist schlimmer und demokratiefeindlicher als Denken im Gleichschritt“
Hierzulande gilt der oft beschworene „Grundkonsens der Demokraten“ als das stabilisierende Fundament der Nachkriegsrepublik. Statt Streit und Debatte wünscht man sich Kompromiss und Konsens. Aber Vorsicht: Zuviel – vor allem zu leicht und schnell erreichter – Konsens begünstigt schalen Opportunismus, er belohnt Kritiklosigkeit, er bedroht die Individualisierung des Denkens. Nichts aber ist schlimmer und demokratiefeindlicher als Denken im Gleichschritt.
Verteidigen wir also die engagierte Gegenrede und die lebhafte Streiterei – jederzeit und allerorten, auch wenn es mitunter nervend und anstrengend ist. Und wenn wir danach sagen, es war gut, dass wir uns gestritten haben, auch wenn wir den anderen nicht überzeugt haben, dann hat es sich gelohnt. Nicht nur für uns.
Der Text stammt aus dem Buch des Autors: Heimatkunde – Falsche Wahrheiten. Richtige Lügen, editionfaust, 208 Seiten, 22 Euro.

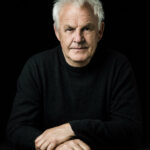



Zu dem was in Gaza passiert:
In den letzten vierundzwanzig Stunden sind acht Menschen verhungert. Zwei davon waren Kinder.
Ja … man sollte meinen, die Hamas würden die Vorräte, die sie bekommen, als erstes an Kinder und Familien geben. Aber mit hungernden Kindern bekommen sie international mehr Zuspruch, also müssen sie leiden.
Kann man nur hoffen, dass auch die von der Hamas gemeldeten Todeszahlen übertrieben sind. Ein schwacher Trost.
Ich bin gespannt auf die Antworten auf meinen Beitrag im Hinblick auf die Streitkultur, um die es doch eigentlich hier geht …
Ach so, die Streitkultur bezieht sich also darauf, ob es sich um 50.000* Tote oder nur 50* Ums-Leben-Gekommene
handelt.
Und: klar, ALLES, was die offizielle israelische Verlautbarungen (Hamas hält Lebensmittel zurück, sooo viele Tote gibt es gar nicht und wenn, sind sie doch wohl ausschließlich auf Vorerkrankungen zurückzuführen) betrifft, ist ohne Wenn und Aber zu vertrauen.
* beliebige 2- oder 3-stellige Zahl einsetzen
Sarkasmus ist kein Argument. Termolo hat Zahlen genannt, darauf habe ich reagiert.
Es geht ja nicht um die Frage, ob insgesamt von Israel genug geliefert wird, sondern um die Verteilung von dem, was ankommt. Dafür ist doch die Hamas als de-facto-Regierung verantwortlich oder nicht?
Es scheint offensichtlich zu sein, dass für die Hamas hier die Versorgung von Kindern keine Priorität hat.
Nur weil man die einen für Lügner hält, müssen die anderen nicht recht haben.
@ Wannenmacher : typischer
Kommentar eines oberklugen
Schreibtischbewohners, dem
es an Vorstellungskraft fehlt
Und schon sind wir beim „Argumentum ad hominem“, das darf ja in keinem kultivierten Streit fehlen. 😀
…Israel hat jedoch zu 100% an der jetzigen Situation in Gaza die Verantwortung, um mal bei Ihrer fachlich-sachlichen Argumentation zu bleiben. Und die einzigen, die diese Situation aktuell nachhaltig ändern können, sind auch die israelischen Politiker.
Ich bin auch eine Freundin des (konstruktiven) Streits, denn das ist meines Erachtens gelebter Pazifismus. Pazifismus ist eben gerade kein Eiapopeia und Wir-haben-uns-alle-lieb und decken alle Konflikte zu, sondern die Bereitschaft, sofort auch massiv zu interventieren, wenn einen etwas stört und nicht aus Höflichkeit oder Konfliktscheu solange zu warten, bis man so verletzt ist, dass man vollkommen überreagiert.
Eine pazifistische Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, in der viel gestritten und diskutiert wird und Konflikte sofort ausgetragen werden, weil man eben nicht im Hinterkopf die Bereitschaft hat, nötigenfalls in den Krieg zu ziehen. In einer pazifistischen Ehe würde man beispielsweise auch so rechtzeitig intervenieren, dass dann eben nicht die nicht zugeschraubte Zahnpastatube irgendwann zum Scheidungsgrund wird, weil einen der andere nur noch ankotzt, weil man zulange zuviel hingenommen hat.
Pazifismus ist nicht bequem. Pazifismus benötigt den Willen zum Konflikt, das ist es, was soviele Kriegsbefürworter nicht kapieren, die lieber zuwarten und zuwarten und dann brutal losschlagen. Pazifismus ist demzufolge auch nicht naiv. Naiv ist es, Kriege zu führen und durch diese Kriege Lösungen von Konflikten zu erwarten. Wie idiotisch ist es bitte, nicht streiten zu wollen und dann im Endeffekt die brutalstmögliche Form der Auseinandersetzung zu riskieren.
Pazifismus ist, Feuer aber keine Feuerwehr zu haben. Das heisst, ich muss mit dem Feuer sehr viel umsichtiger umgehen, sehr viel mehr Schutzmassnahmen einbauen. Putin ist genauso kalter Krieger wie die westlichen Politiker auch. Er hätte sehr viel früher auf die NATO-Osterweiterung reagieren müssen, beispielsweise mit der Drohung, der EU den Gashahn abzudrehen. Russland ist ein riesen Markt. Als ob er diese Tatsache nicht hätte nutzen können! Das hat er nicht gemacht, weil er als Miliarist eben auch im Hinterkopf hatte, dass er bis zum Schluss höflich und konsequenzlos mahnen, aber dann trotzdem militärisch brutal zuschlagen kann.
Die grösste Lüge über den Pazifismus ist, dass sich Pazifisten alles gefallen lassen. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Wer Krieg (oder jede andere massive Zuspitzung eines Konflikts) eben nicht geschehen lassen will, der muss frühzeitig intervenieren und sagen, was ihn stört und sich dann auf dieser niedrigen Stufe des Konflikts entweder einigen oder sofort Konsequenzen ziehen. Man darf nicht bequem sein, man darf nicht konfliktscheu sein, man darf nichtmal allzu höflich sein, wenn das Gegenüber einen dann vielleicht nicht richtig versteht.
Alles richtig. Allerdings, ohne jetzt besondere Sympathie für Putin zu haben: Hat er nicht jahrelang die Hand ausgestreckt, dann gemahnt, um Rücksicht gebeten, später verhandeln wollen? Leider hat man ihm die Tür vor der Nase zu geschlagen, seine Positionen ignoriert und lächerlich gemacht, ihn sogar an der Nase herumgeführt, und das sogar offen zugegeben??
Ich glaube nicht, dass Putin im Herzen ein Militarist ist. Als Jurist ist er ein Mann des Wortes. Sicher ist er kein Unschuldslamm. Er hat einiges auf dem Kerbholz. Aber als eingefleischten Militaristen würde ich ihn nicht sehen. Wäre er ein solcher, würde der Ukrainekrieg noch eine ganz andere „Qualität“ haben. Disclaimer: Damit rechtfertige ich selbstverständlich nicht sein Vorgehen in dieser Frage.
John Mearsheimer: «Ich hätte dasselbe getan wie Putin. Ich hätte die Ukraine sogar noch früher überfallen»
https://meilleur-en-suisse.ch/john-mearsheimer-ich-haette-dasselbe-getan-wie-putin-ich-haette-die-ukraine-sogar-noch-frueher-ueberfallen/
Ist das ein Argument? Weil Mearsheimer das sagt? Darum ist es das Evangelium?
Putin ist seit Jahrzehnten (mit der Unterbrechung Medwedjew) Präsident des grössten Landes der Welt mit den meisten Ressourcen. Mir fallen noch zwei bis drei andere Möglichkeiten ein, wie er auf die Provokationen von NATO und EU hätte reagieren können, ohne deshalb einen Krieg vom Zaun brechen zu müssen. Er hätte nur viel früher reagieren müssen. Ich finde es übrigens auch aus Sicht der Russen überhaupt nicht nett, dass er massenhaft russische Soldaten opfert, nur um selbst 20 Jahre lang zu westlichen Politikern höflich bleiben, sich von ihnen verarschen und russische Ressourcen billig an ziemlich offensichtlich feindlich gesinnte Länder verkaufen zu können. Minsk II war ja offensichtlich ein Witz wie Hollande und Merkel ganz unverblümt zugegeben haben.
Sorry. Dafür dass Putin hier im Westen als geradezu omnipotenter Bösewicht dargestellt wird, hat er sich ziemlich lange an der Nase herumführen lassen, um dann einen Krieg zu beginnen, dessen Ende nicht absehbar ist (Trump hin oder her). Ich finde das nicht rational.
Sie sollten mal die Perspektive ändern und die Entscheidungen der russischen Regierung aus dem Blickwinkel der Innenpolitik betrachten. Die russische Regierung braucht gute Gründe, um einen langjährigen Krieg in der Ukraine gegenüber dem Russ. Volk vertreten zu können. Auf die Frage: habt ihr wirklich alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft und alles menschenmögliche getan, um ohne Krieg das Ukraineproblem zu lösen, kann die russische Regierung auf die durchaus intensiven achtjährigen Bemühungen verweisen.
Nun ja, für Putin ist Krieg offensichtlich (auch) ein Mittel der Politik. Ich kritisiere ja gerade, dass er nicht viel zeitiger auf den Tisch gehauen hat und zwar ganz ohne Militär. Selbstverständlich hat auch Russland Sicherheitsinteressen, die von der NATO nicht berücksichtigt wurden (um es mal höflich auszudrücken). Das Geschwätz der NATO-Apologeten, die vor dem bösen Iwan warnen, aber behaupten, die NATO wäre ein lammfrommes Verteidigungsbündnis, ist ja nicht ernstzunehmen. Ein beliebtes „Argument“ von denen ist ja immer: Jaha, es haben zwar gar nicht so wenige NATO-Staaten in den letzten Jahrzehnten ziemlich viele andere Länder völkerechtswidrig überfallen, aber doch nicht die heilige NATO selbst. Klar. Und wenn Mafia-Paten ein „Verteidigungsbündnis“ schmieden, dann hat das auf deren „Verteidigungsbündnis“ keinerlei Vertrauensauswirkungen, versteht doch jeder. Nicht.
Ich bleibe dabei: Putin hätte viel früher nichtmilitärisch reagieren müssen. Es ist ja an sich schön, wenn man höflich bleibt, aber aus den von mir genannten Gründen wird höflich bleiben in krassen Konfliktsituationen halt von vielen als Schwäche interpretiert und genau das dürfte z.B. einem Pazifisten nicht passieren, weil man sich Respekt auch manchmal verschaffen muss. Wie gesagt: Nicht angenehm, nicht harmonisch, aber viel besser als eine völlige Eskalation, wenn es einem dann irgendwann komplett reicht.
Da sind wir beim Grundproblem, das Herr Ortner anspricht: Konstruktives Streiten setzt auf beiden Seiten ein Mindestmaß an Achtung und Fairness beim jeweils anderen voraus. Putin scheint anfangs von dieser Grundannahme ausgegangen zu sein. Und da stimme ich ihnen zu: die Gegenseite hat das bewusst unterlaufen und von Anfang an unlauter agiert.
Zwei Punkte dazu:
1. Es ist ein Fehler, Gewalt nur auf das Millitär zu beschränken. Wirtschaft, z.b. Sanktionen, kann ebenso Gewalt sein — durch Wirtschaftssanktionen kommen tatsächlich weltweit mehr Menschen um als durch Kriege.
2. Putin hatte meiner Einschätzung nach vor 2021 nicht die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um erfolgreich „auf den Tisch zu schlagen“. Und sein Versuch, das 2021 ohne Militär zu bewerkstelligen ist ja krachend gescheitert.
Ja nun… Den Kriegstreibern habe ich nicht umsonst den Krieg erklärt…
Schönes Foto, mit den 2 Schwalben.
@Bettina-di-Monaco
Gute Analyse & Beitrag.
Find ich auch!
Nun handelt es sich bei dem Artikel von H. Ortner um Auszuege aus einem seiner Buecher, es ist also nicht sicher, dass seine Aussagen nicht auch relativiert werden. Doch fuer gewisse Formulierungen gibt es keine Entschuldigung.
„die Folgen der Corona-Pandemie“
Hier wird die Schreib-bzw. Sichtweise der Herrschenden uebernommen. Kein Anfuehrungseichen lässt auf eine kritische Sicht dieser Zeit der Ermächtigung schliessen.
„ der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine“
Auch hier die unkommentierte Sicht des Nato-Westens. Kein Hinweis auf 14000 Tote im Donbass seit 2014 durch den Beschuss seitens der Ukrofaschisten.
„das antisemitische Massaker der Hamas“
Der H. Ortner verschweigt, dass die Palästinenser seit Jahren in Gaza im grössten Freiluftgefängnis der Welt leben und ständig sich gegen Provokationen durch die Israelis/Zionisten erwehren muessen.
Ein Streit, der eine zufriedenstellende Lösung als Resultat hätte, muesste auf Augenhöhe gefuehrt werden! Das ist aber in keinem der geschilderten Fälle gegeben. Hier diskutieren (wenn ueberhaupt) nur die Machthaber/Herrschenden mit ihren Untergebenen.
Richtig! Nur noch eine Ergänzung:
„Die Folgen des Klimawandels“ Ja, über die Folgen darf man debattieren, so viel man will, damit niemand auf die Idee kommt, nach dessen Gründen zu fragen.
Streiten? Unbedingt vermeiden!
Ein emotionalisierter Meinungsaustausch bringt keinerlei neue Erkenntnisse, sondern stellt nur glühend vorgetragene Überzeugungen zur Schau.
Tagesschau? Ach ne, Overton.
Blödsinn.
Sehe ich auch so. Am Ende kann auch stehen, dass jeder bei seiner Meinung bleibt, ohne den anderen abzuwerten. So ist jedenfalls bei mir und ich habe kein Problem damit. Ich sage immer meine Meinung, auch in der Firma. Und oft kommt es zum Streit, aber wenn der andere bei seiner Meinung bleibt, dann ist das für mich auch ok.
Sehe ich auch so. Am Ende kann auch stehen, dass jeder bei seiner Meinung bleibt, ohne den anderen abzuwerten. So ist jedenfalls bei mir und ich habe kein Problem damit. Ich sage immer meine Meinung, auch in der Firma. Und oft kommt es zum Streit, aber wenn der andere bei seiner Meinung bleibt, dann ist das für mich auch ok.
https://www.dmss2020.de/tag-der-freiheit/
„Wenn alle Beteiligten den gleichen Raum und die gleiche Aufmerksamkeit bekommen, dann kann ein guter Streit beginnen.“
Ich habe selten erlebt, dass das ohne Moderation durch Dritte funktioniert.
Die meisten Menschen wollen nicht streiten. Die wollen gewinnen. Da wird auf jede Regel geschissen!
Ja, erlebe ich ähnlich. V.a. wird i.d.R. ein Streitgespräch gar nicht erst zugelassen. Da wird abgeblockt, was das Zeug hält.
Dem Gegenüber wirklich zuhören, es ernst nehmen bzw. überhaupt wahrnehmen – häufig Fehlanzeige und nicht selten im sogenannten ’näheren‘ Umfeld.
Und wie wir ja hier regelmäßig live und in Farbe erleben können, wird gerne mal beschimpft, beleidigt, verhöhnt, beleert und mit größtmöglicher Arroganz kluggeschissen. Respekt, Höflichkeit, Verständnis und Empathie scheinen für viele Kommentatoren hier Fremdwörter zu sein. Ich frage mich dann immer wieder, geilt das diese Personen (die Trolle lass ich jetzt mal außen vor) auf, regelmäßig rumzupöbeln und denken die sich „Dem habe ich’s jetzt aber gezeigt !“ ?
Hat für mich immer etwas von Kirmes-Proll, aber gut, wer’s braucht…
In Bezug auf Diskussionen habe ich mal einen für mich treffenden Satz gelesen : „Ich will nicht, daß man mir recht gibt. Ich will, daß man sich mit mir auseinandersetzt“. Und ich glaube, damit stehe ich wohl nicht so alleine da.
Ich musste in meinem Leben stets fest stellen, wenn ich meinem Mitdiskutanten Offenheit, Zugänglichkeit und Verständnis suggerierte, wurde das meistens gnadenlos ausgenutzt.
Von gegenseitigem Entgegenkommen oder gar Dankbarkeit für eine de-eskalierende Streitkultur keine Spur.
Irgendwann lässt man das dann halt bleiben, und an dem Punkt sind wohl die meisten heute. So etabliert sich eine Ego-Gesellschaft im Laufe der Zeit selbst. Wir stecken in einer ziemlich fest gefahrenen Situation.
Ich habe inzwischen nur noch wenig Lust, mich mit anderen auseinander zu setzen. Es bringt einfach nichts. Entweder man war vorher schon einer Meinung, dann pinselt man sich halt gegenseitig den Bauch. Das kann ich auch alleine machen. Vor allem weil daraus auch gar nichts konstruktives erwächst, außer kollektivem Ego-Wichsen. Oder man geht im Streit auseinander, davon kriegt man dann nur ’nen Hals.
Jemanden von etwas überzeugen? So gut wie ausgeschlossen.
Was als Option bleibt, ist der ungefährliche Smalltalk. Aber darauf habe ich keine Lust, da entsteht bei mir keinerlei tiefere Bindung zur anderen Person.
Berührungen, die über einen Händedruck hinaus gehen, sind ja sowieso verpönt.
Auch dem kann ich mich wieder nur anschließen.
Ich erlebe das auch seit vielen Jahren (und schon lange vor dem ganzen Cocolores-Gedöns) so, daß ich auf der Suche nach tiefergehenden Gesprächen/Auseinandersetzungen/Interaktionen, etc. immer wieder nur gegen Wände renne. Kaum Resonanz – auch, wie Sie ja richtig bemerken, auf der Berührungsebene. Aber letztlich passt das ja auch : die Menschen lassen sich – sowohl auf der buchstäblichen, als auch der übertragenen Ebene – von nichts und niemandem mehr wirklich berühren. Stattdessen Oberflächlichkeit in allen Varianten, Ignoranz; alles so ein bißchen ironisieren oder ins Lächerliche ziehen; bloß nichts und niemanden so wirklich ernst nehmen.
Damit schrammt man immer wieder haarscharf am Leben vorbei.
Und ja, auch mich ermüdet das ungemein. Ähnlich wie Sie habe ich darauf auch keine Antwort mehr. Und keine Lust mehr. Auf das oberflächliche Getue, das krampfhafte Vermeiden jeglicher Tiefe und Nähe, schlußendlich jeglicher wirklichen Lebendigkeit. Auf das Hinterhertrotten so vieler Menschen, das nichts infragestellen und das Mitmachen auch noch des allergrößten Irrsinns.
Und auch das ausgenutzt-werden kenne ich zur Genüge. Zumindest, was z.B. das Zuhören betrifft.
Zuhören durfte ich bei vielen immer wieder, gerne auch in epischer Breite. Wenn es allerdings dann mal auf Gegenseitigkeit beruhen sollte, waren die meisten ganz schnell weg, oder es wurde schlichtweg abgeblockt.
Wenn man sowas dann wieder und wieder (und über viele Jahre) erlebt, ist die Konsequenz dann zwar nicht schön, aber letztlich unausweichlich : man zieht sich mehr und mehr zurück.
Ich habe schlicht und ergreifend keine Lust mehr, irgendjemandem hinterherzulaufen.
PS :
Es hat mich übrigens gefreut, Ihre „Bekanntschaft“ zu machen. Ihre Kommentare (und die von einigen anderen) gehörten zu denen, die ich gerne gelesen habe.
Wenn es allerdings bei diesem Cookie-Blödsinn bleibt, werde ich diese Seite – wenn überhaupt – wahrscheinlich nur noch sporadisch frequentieren. Ich mag mich irren, aber irgendwie habe ich den Eindruck, daß ein paar andere Kommentatoren sich hier auch schon verabschiedet haben (vom Altlandrebellen z.B. hört man derzeit auch nichts mehr).
Warum es diesen Quatsch jetzt auch hier braucht, will mir nicht in den Sinn, v.a. nach so langer Zeit. Ich mag eine solche Entwicklung nicht.
Keine Ahnung, wie ich das noch handhaben werde, aber prophylaktisch sage ich mal für’s Erste : Machen Sie’s gut !
Danke, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit! Wir ticken wohl recht ähnlich. 🙂
So long and thanks for all the fish!
Herr Ortner plädiert im Sinne des letzten deutschen Kaisers: „Meinen dürft ihr, gehorchen müsst ihr!“ (sinngemäß) Das ist sein Begriff von wehrhafter Demokratie, wie es auch das aktuelle Regime meint.
Denselben Stuss hat man uns auch in der Schule erzählt. Man sieht ja heute, wohin das geführt hat.
Eine Meinung ist einen Scheiß wert, so lange sie keinen Anspruch auf Wirkmächtigkeit erheben darf und zur reinen Pose degradiert wird. Und die Leute spüren das, der daraus entstehende Frust entlädt sich dann eben auf die Mitmenschen, auf die Politik, auf Ausländer oder die neueste Sau, die man gerade durchs medial-populistische Dorf treibt.
Diejenigen, die das dann gar nicht mehr integriert bekommen, begehen dann Suizid oder laufen Amok.
->Selbst geschaffenes Problem, geboren aus ignorantem Machtwillen, wenn man Menschen halt nur wie Nutzvieh behandelt.
Nichts gegen einen guten Streit, aber sollte man sich nicht wenigstens über den Zweck einig sein? „Für unsere Demokratie“ streite ich mich nicht, wir haben keine. Die „demokratie-stärkende() Interaktion“ ist doch nur eine Turnübung am toten Objekt, egal was ein Helmut Schmidt dazu meint, der mir im Deutschen Herbst die „Rasterfahndung“ und Verkehrskontrollen mit entsicherter MP bescherte.
Der Autor fordert den Streit, „um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern und einen Konsens zu finden“. Damit benennt er – irgendwie – das Richtige, nämlich den „Krieg Arm gegen Reich“ (Warren Buffet), will aber das Falsche, nämlich einen Konsens innerhalb des bürgerlichen Systems, welches er fälschlich Demokratie nennt.
Das System lässt sich durch eine Streitkultur nicht retten, auch wenn Helmut Ortner uns jede Menge Streitpunkte vorschlägt: „Klimawandel(), Krieg und Flucht, die Folgen der Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, das antisemitische Massaker der Hamas [], das Erstarken von Nationalismus und Rechtspopulismus“.
Jaja, „da kommt vieles zusammen“, auch wenn sich mir bei vielen seiner Formulierungen die Fußnägel hochrollen, aber der entscheidende Punkt fehlt ohnehin: die Ausplünderung der Bevölkerung. Wer vom Klassenkampf nicht reden will, sollte wenigstens die Herrschaftsinstrumente zum Thema machen: Manipulation von Wahlen, Fakten, Meinungen und Köpfen, polizeiliche, geheimdienstliche und gerichtliche Maßnahmen, die Missachtung der Grundrechte…
Da die Instrumente höchst wirksam sind, gibt es in meiner Klasse natürlich reichlich Anlass zum Streit. Produktiv ist dieser aber nur, wenn er zu mehr Solidarität führt, sich also selbst überflüssig macht. Wenn der Autor mir stattdessen den „Streit [als] eine zivilisatorische Leistung“ verkaufen will, „die unsere Demokratie hervorgebracht hat“, will er ausgerechnet vom Klassenkampf nicht reden, dem großen Streit, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht und längst nicht ausgestanden ist.
👍
Eine Absage:
„Wo Menschen zusammenleben, treffen Interessen und Meinungen aufeinander. Spannungen sind unausweichlich – aber um die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern und einen Konsens zu finden, braucht es produktiven Streit und öffentliche Debatte. Ein Plädoyer.“
Hm… – „Wo Menschen zusammenleben“? Streit sei also eine allgemeine Konstante des Menschseins? Ganz getrennt vom Inhalt des Streits. Sieht da jemand den Balken im eigenen Auge nicht? Spaltung der Gesellschaft?
1. Ist die Gesellschaft nicht schon längst gespalten – in zwei Klassen nämlich. Kapital und Arbeit. Will der Autor daran was ändern – ich denke nicht. Es geht ihm um demokratische Sitten.
2. Ist das gesellschaftliche Leben nicht durch und durch, von der Wiege bis zur Bahre, bis hinein in das letzte gesellschaftliche Atom als Konkurrenz, als Streit jeder gegen jeden, organisiert? Und das soll keine gesellschaftliche Einrichtung, sondern eine menschliche Konstante sein?
3. Trotzdem soll ein „Konsens“ zustande kommen, damit die Gesellschaft nicht auseinander fliegt. Man soll sich Sorgen machen, ob der Konsens gelingt und für das Gelingen des Konsenses soll „produktiver Streit“ ein Mittel sein?
Ja – nee, lass mal. An diesem Konsens will ich mich nicht konstruktiv beteiligen. Von der kapitalistischen Konkurrenz halte ich nichts. Die gehört abgeschafft. Soweit kommt es noch, dass ich mich um ihre Stabilisierung sorge und mit konstruktivem Streit daran beteilige, um ihre Funktion zu gewährleisten.
Der Meinungspluralismus(den es nur eingeschränkt gab) wurde immer mehr demontiert(scheibchen für Scheibchen in den letzten 35 Jahren(oder länger).
Es wird zunehmend skandalisiert, polarisiert und ausgegrenzt und schlimmeres. Dialog wird immer mehr vepönt, verachtet und kriminalisiert, (insbesondere mit Andersdenkenden). Stuhlkreise werden homogen…
Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Hauptsache Faschismus und gerne in Bunt
divide et impera.
OT :
Jetzt wir hier auch mit Cookies gearbeitet, die man akzeptieren muss und bei denen man keine Wahl hat ?
Das wird diese Seite definitiv Leser kosten. Und ich werde mir das auch noch überlegen, ob ich diese Seite noch länger besuche, wenn es dabei bleibt.
Dito. Habe mich auch erschrocken vorhin.
„Zerrbild“, soso. Entweder ist der Autor naiv oder er will sich bei eben diesen Eliten einschmeicheln.
Offtopic: Die cookies sind mir wurscht, mein Browserverlauf wird sowieso in kurzen Abständen regelmäßig gelöscht.
Ich verstehe die Aufregung nicht, es gibt so gut wie keine Website ohne cookies. Und bei der Gelegenheit: Viele lesen ja nach wie vor TP. Was macht Ihr damit?