
Warum die Amerikaner ihre Meinung zu politischen Themen immer seltener öffentlich äußern.
Seit Jahrzehnten nimmt das Vertrauen der Amerikaner untereinander ab, wie die jüngste Allgemeine Sozialerhebung zeigt.
Ein wichtiger Faktor für diesen Rückgang ist die gleichzeitig zunehmende Polarisierung zwischen den beiden großen politischen Parteien. Anhänger von Republikanern und Demokraten betrachten die gegnerische Seite weitaus häufiger als in der Vergangenheit mit Misstrauen.
Diese politische Polarisierung ist so stark, dass viele Amerikaner nach einer aktuellen Studie kaum noch mit Menschen aus den gegnerischen Lagern freundschaftliche soziale Kontakte pflegen, in deren Nähe wohnen oder sich mit diesen treffen.
Sozialwissenschaftler bezeichnen diese Art von Feindseligkeit häufig als „affektive Polarisierung“, was bedeutet, dass Menschen nicht nur in vielen oder den meisten politischen Fragen gegensätzliche Ansichten vertreten, sondern auch Mitbürger verachten, die eine andere Meinung vertreten. In den letzten Jahrzehnten ist eine solche affektive Polarisierung in den USA alltäglich geworden.
Die Polarisierung untergräbt die Demokratie, indem sie die wesentlichen Prozesse der demokratischen Beratung – Diskussion, Verhandlung, Kompromiss und Verhandlung über öffentliche Politik – schwierig, wenn nicht gar unmöglich macht. Weil die Polarisierung so weitreichend und tiefgreifend ist, sind manche Menschen nicht mehr bereit, ihre Meinung zu äußern, bevor sie sich nicht vergewissert haben, dass sie mit jemandem sprechen, der ihrer Meinung ist.
Ich bin Politikwissenschaftler und habe festgestellt, dass die Amerikaner viel weniger bereit sind, ihre Meinung öffentlich zu äußern, als dies noch zu Zeiten der McCarthy-Ära der Fall war.
Das Verstummen der amerikanischen Stimme
Einem Buch der Politikwissenschaftler Taylor Carlson und Jaime E. Settle aus dem Jahr 2022 zufolge beruht die Angst, sich zu äußern, auf der Angst vor sozialen Sanktionen für die Äußerung unliebsamer Ansichten.
Und dieses Zurückhalten von Meinungen erstreckt sich auf ein breites Spektrum sozialer Umstände. Im Jahr 2022 habe ich beispielsweise eine repräsentative Umfrage unter etwa 1500 Einwohnern der USA durchgeführt. Dabei stellte ich fest, dass zwar 45 % der Befragten Bedenken hatten, ihre Meinung gegenüber Mitgliedern ihrer unmittelbaren Familie zu äußern, dieser Prozentsatz aber auf 62 % anstieg, wenn es darum ging, sich öffentlich in der eigenen Gemeinschaft zu äußern. Fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie sich weniger frei fühlen, ihre Meinung zu sagen, als sie es früher taten.
Im Vergleich mit der Zahl derer, die dies während der McCarthy-Ära sagten, gaben drei- bis viermal so viele Amerikaner an, dass sie sich nicht frei fühlen, ihre Meinung zu äußern.
Zensur in den USA und weltweit
Seit dieser Umfrage haben die Angriffe auf die Meinungsfreiheit deutlich zugenommen, insbesondere unter der Trump-Regierung.
Themen wie der israelische Krieg in Gaza, Kampagnen von Aktivisten gegen „Wokeism“ und die immer häufigeren Versuche, Menschen für die Äußerung bestimmter Ideen zu bestrafen, erschwerten den Menschen, sich zu äußern.
Das Ausmaß der Selbstzensur in den USA in jüngster Zeit ist weder beispiellos noch einzigartig für die USA. Untersuchungen in Deutschland, Schweden und anderswo berichten über eine ähnliche Zunahme der Selbstzensur in den letzten Jahren.
Wie die „Schweigespirale“ die Selbstzensur erklärt
In den 1970er Jahren prägte Elisabeth Noelle-Neumann, eine renommierte deutsche Politikwissenschaftlerin, den Begriff der „Schweigespirale“, um zu beschreiben, wie Selbstzensur entsteht und welche Folgen sie haben kann. Auf der Grundlage ihrer Untersuchungen zur Bundestagswahl 1965 stellte Noelle-Neumann fest, dass die Bereitschaft des Einzelnen, sich öffentlich zu äußern, von der Wahrnehmung der öffentlichen Meinung zu einem Thema abhängt.
Die so genannte Spirale tritt auf, wenn jemand eine Meinung zu einem kontroversen Thema äußert und dann auf heftige Kritik einer aggressiven Minderheit stößt – vielleicht sogar auf scharfe Angriffe.
Ein Zuhörer kann dem Redner Kosten für die Äußerung seiner Meinung auferlegen, z. B. in Form von Kritik, direkten persönlichen Angriffen und sogar Versuchen, den Redner durch die Beendigung von Freundschaften oder die Verweigerung der Teilnahme an gesellschaftlichen Ereignissen wie Erntedank- oder Feiertagsessen „auszuschalten“.
Diese Art der Sanktionierung ist nicht nur auf soziale Interaktionen beschränkt, sondern es gibt sie auch, wenn jemand von weitaus größeren Institutionen bedroht wird, von Unternehmen bis hin zur Regierung. Der Sprecher lernt aus dieser Begegnung und beschließt, in Zukunft den Mund zu halten, weil die Kosten für die Äußerung seiner Meinung einfach zu hoch sind.
Diese Selbstzensur hat Auswirkungen, da Ansichten weniger häufig geäußert werden und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man Unterstützung von Menschen mit ähnlichen Ansichten erhält. Die Menschen kommen zu der Überzeugung, dass sie in der Minderheit sind, selbst wenn sie in Wirklichkeit die Mehrheit bilden. Diese Überzeugung trägt dann auch dazu bei, dass man seine Ansichten nicht äußern will.
Die Meinungen der aggressiven Minderheit werden dann dominant. Die wahre öffentliche Meinung und die geäußerte öffentliche Meinung klaffen auseinander. Vor allem aber wird die für die demokratische Politik so notwendige freie Debatte im Keim erstickt.
Natürlich ist dies nicht bei allen Themen der Fall – nur bei Themen, bei denen es eine engagierte und entschlossene Minderheit gibt, die einem bestimmten Standpunkt Kosten auferlegen kann, kommt es zu dieser Spirale.
Die Folgen für die demokratische Willensbildung
Die Tendenz zur Selbstzensur führt dazu, dass die Zuhörer die zurückgehaltenen Ansichten nicht mehr hören können. Der Markt der Ideen wird verzerrt; die Wahlmöglichkeiten der Käufer auf diesem Markt werden eingeschränkt. Die für eine Demokratie so notwendige robuste Debatte wird unterdrückt, wenn die Ansichten einer Minderheit als die einzigen „akzeptablen“ politischen Ansichten angesehen werden.
Es gibt kein besseres Beispiel dafür als das Fehlen einer Debatte in den heutigen USA über die Behandlung der Palästinenser durch die Israelis, ganz gleich, zu welchem Ergebnis eine solche lebhafte Diskussion führen würde. Aus Angst vor Konsequenzen halten viele Menschen ihre Meinung über Israel zurück – ob Israel beispielsweise Kriegsverbrechen begangen hat oder ob israelische Regierungsmitglieder sanktioniert werden sollten -, weil sie fürchten, als antisemitisch gebrandmarkt zu werden.
Viele Amerikaner beißen sich auch auf die Zunge, wenn es um DEI (diversity, equity, and inclusion), affirmativ action und sogar die Frage geht, ob politische Toleranz für die Demokratie unerlässlich ist.
Aber auch die vorherrschenden Ansichten werden durch diese Spirale benachteiligt. Dadurch, dass sie sich nicht mit ihren Konkurrenten auseinandersetzen müssen, verlieren sie die Möglichkeit, ihre Überzeugungen zu überprüfen und, falls sie bestätigt werden, ihre Argumente zu untermauern und zu stärken. Gute Ideen verlieren die Chance, besser zu werden, während schlechte Ideen – wie so Extremes wie die Leugnung des Holocaust – Raum erhalten, sich zu entfalten.
Die Schweigespirale wird somit zum Feind pluralistischer Debatten, Diskussionen und letztlich der Demokratie selbst.
Dieser Artikel – hier im englischen Original – wurde The Conversation unter einer Creative Commons Lizenz mit der freundlichen Genehmigung des Autors entnommen.![]()
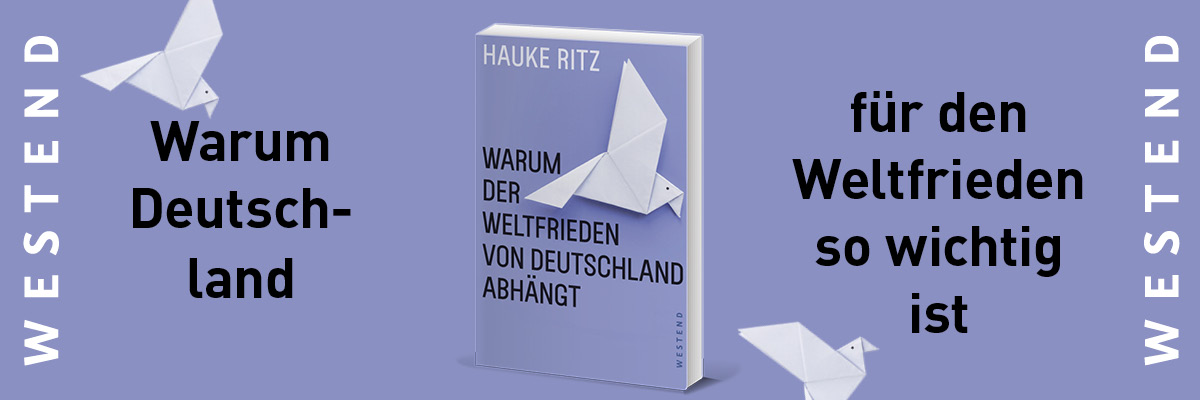




Ist das in Deutschland anders?
Wenn du sagst Israel sei ein faschistischer Staat, der Völkermord begeht, verstößt du gegen die deutsche Staatsräson und das kann teuer werden.
Auch Politiker öffentlich kritisieren kann teuer werden. Das passierte doch den Rentner aus Haßfurt, der Habeck kritisierte.
Die radikale Minderheit ist heute die sog „demokratische Mitte“, die liberale, reiche Bildungsbürgerschicht.
Gerade das Thema Genozid in Gaza ist mittlerweile auch in alternativen Medien ein Tabuthema geworden. Bitte nicht zuviel über verhungerte Kinder in Gaza berichten, sonst verlierst die Autoren, die zwar Scheiße erzählen, aber Geld bringen. Dieses Geld brauchen Verlage aber um auch kritische Literatur zu verlegen. Kritik, Behandlung von Tabuthemen, ist geschäftsschädigend.
Tatsächlich sind es die Hauptmedien, die dem Publikum die extrem wirksamen Werkzeuge der sozialen Ächtung in die Hand geben. Querdenker, Corona-Leugner, Putinversteher – allesamt durch die Hauptmedien in Nachrichten, Kultursendungen und Talks eingeführte und bis zu Erbrechen vertiefte Kampfbegriffe, die dazu führen sollten, dass jegliche Diskussion von beliebig einfältigen Anwesenden mit einem Wort unterbunden werden können.
Solche Ausgrenzungsstrategien entstehen nicht aus Versehen. Das TV ist das alltägliche Kasperletheater für vorgeblich Verständige, das angemessenes Verhalten beim Auftauchen des Krokodils lehrt und ebenfalls – und noch viel wichtiger -, was und wer alles als Krokodil anzusehen und zu bekämpfen ist.
Naja, als US-Bürger kann man mittlerweile schnell in einem salvadorianischen Horrorknast landen und enden, ohne die Aussicht auf Rückkehr. Dafür hat der Faschistenführer Trump mit seinem Lieblingsdiktator gesorgt.
Warum sollte man unter solchen Bedingungen noch frei seine Meinung äußern wollen?
„Themen wie der israelische Krieg in Gaza“
Da habe ich aufgehört zu lesen. Der Autor unterstützt mit solchen Aussagen den Terror der Israels. Wer das gezielte Schießen auf Kinder und Frauen, das absichtliche Aushungern und Verhungern lassen hnderttausender von Menschen als Krieg bezeichnet, ist es nicht wert gelesen zu werden.
Im Übrigen schließe ich mich meinem Vorposter an. Das ist in Deutschland ebenso.
Auch hier möchte kein Grüner neben einem AfD-Mitglied leben. Die Blasen sind geschlossen. Debatten verboten. Wer dem grünen Meinungsterror widerspricht, wird als günstigstenfalls als ewig-gestriger beschimpft. Aber meistens schnell aus der Gruppe entsorgt. Damit man weiter unter sich ist.
So isses.
Ich lebe seit über 20 Jahren nicht mehr in Deutschland und habe trotzdem bis vor einiger Zeit oft regen Kontakt zu ein paar uralten Freunden gehabt. Seit ich offen die Rolle der NATO in der Ukraine und den Genozid in Gaza kritisiere sind die Leitungen tot. Zu Anfang schickte ich auch mal wirklich informative links, da kam dann maximal das übliche Geschimpfe, meist aber gar nichts mehr. Am aggressivsten waren da zwei Anhänger der Olivgrünen.
Ab hier ist es scheinbar nicht nötig, den Kommentar weiter zu lesen: »Selbstzensur« funktioniert – hier als autoritärer Reflex anschaulich gemacht, was sich durch Abwesenheit jeglicher Auseinandersetzung mit dem Artikel äußert. »… es eine engagierte und entschlossene Minderheit gibt…« wird auch fein demonstriert.
Hab trotzdem weiter gelesen (!) und nicht neues gelernt.
Sei’s drum.
Also ich hab mit affektiver Polarisierung immerhin einen neuen Begriff gelernt.
Bonnie liefert unfreiwillig ein schönes Beispiel, aber ich erwisch mich selbst auch immer öfter dabei :/
Der AfD Terror ist laut und stark und kostet Menschenleben. Wir hatten bereits eine schlimme Nazizeit in Deutschland und Österreich.
Diese Entwicklungen sind politisch gewollt und werden auch von der Politik proaktiv befördert. Der Grund ist, weil sich die Menschen hilflos fühlen sollen und sich dann deswegen aus dem Politischen vollständig zurückziehen sollen, was auch funktioniert.
Ziel ist die Errichtung einer de facto Diktatur faschistischen Stils. Eine Herrschaftsform, die die Machteliten schon immer wollten und aufgrund der digitalen Möglichkeiten mittlerweile auch umsetzen können. Oder anders ausgedrückt, aufgrund der digitalen Möglichkeiten können die Machteliten jetzt endlich so, wie sie schon immer wollten.
Diese Digitalisierung hat zur Folge, dass man sich nur noch über eine Revolution erfolgreich wehren kann.
In den USA wird das, Trump`s Politik sei Dank, in immer breiter werdenden Kreisen erkannt. Deswegen entstehen zurzeit in den USA, im Gegensatz zu Deutschland (Der Gehorsam lässt schön grüßen!), breite Gegenbewegungen.
Und um dem entgegenzuwirken, wird von Trump, mit dem stillen Einverständnis der Demokraten und der direkten Umsetzung durch die US-amerikanischen Geheimdienste, das Konzept der „politischen Gewalt“ umgesetzt.
In diesem Gespräch wird näher darauf eingegangen:
https://www.youtube.com/watch?v=mVk-l2esf9Y
In den USA entsteht grad eine breite Gegenbewegung dazu? What?!
Es gibt atm keine polarisiertere Gesellschaft als die USA, alles (da sind wir uns einig) by design.
Die scheinbare Unversöhnlichkeit zwischen
den Parteien dient lediglich dem Zwecke,
die Gesellschaft zu spalten und zu herrschen.
Bei alles grossen Fragen herrscht ansonsten
Einigkeit.
Von welcher Demokratie spricht der Autor hier eigentlich?
Das verwirrt mich schon seit geraumer Zeit, alle reden ständig über diese ominöse Demokratie, die immer bedroht zu sein scheint.
Ich kann keine Demokratie entdecken, weder hier noch auf der anderen Seite des Tümpels.
Aber was weiß ich schon. Der Autor ist ja Politikwissenschaftler, der wird schon wissen wovon er spricht.
Ist einfach zu erklären. Zumindest im deutschen gibt es zwei Demokratien. Es gibt „unsere Demokratie“ und „Nazi-Denken“. Wann immer im deutschen Medien von „unserer Demokratie“ gesprochen wird, wird von einer Politik gesprochen, bei der die falschen Leute nicht mitmachen dürfen. Die falschen Leute werden gecancelt, ausgegrenzt, hinter eine Brandmauer geschoben.
Hallo Tuka Ram,
ja, so kommt es mir auch vor. Demokratie scheint zu sein, wenn die richtigen Leute mit den richtigen Meinungen die richtigen Parteien wählen. Alle anderen, die anderer Meinung sind, sind Nazis, Russenknechte und Terrorunterstützer und müssen kriminalisiert werden. Die Frage die sich dann stellt ist: was hat diese Demokratie mit Demokratie zu tun? Und warum ist das alles irgendwie schützenswert und warum ist eine Bedrohung dieses Systems überhaupt ein Problem?
In den USA ist es noch mal ein bisschen anders. Dort existieren zwei Parteien, deren Vertreter unisono Politik für Milliardäre machen und auch ständig Kriege führen wollen. Alternativen werden von den Kartellparteien weggebissen. Auch hier die Frage: was hat das mit Demokratie zu tun?
Die Konzentration und die Herrschaft des großen Geldes ist in den USA weit fortgeschritten. Die Milliardäre streiten sich in den beiden Parteien um den richtigen Weg für ihre Interessen- Immerhin darf dann das Volk darüber abstimmen welchen von den beiden Oligarchen-Richtungen es dem Vorzug gibt. Das ist immerhin an Demokratie in den USA noch übrig geblieben. Bei Laune gehalten wird das US-amerikanische Volk zudem von der Ideologie der Außergewöhnlichkeit der USA (dem Exzeptionalismus), der US-Form des Nationalismus, der alle Unverschämtheiten der USA in der Welt rechtfertigt.
Also Demokratie als Politzirkus im Sinne von Brot und Spielen (mit zunehmend weniger Brot), und zwischendurch treten Pausenclowns auf, die den Zuschauern versichern wie großartig sie doch sind? – Könnte hinkommen.
politikwissenschaftler haben ev. einen guten überblick, nach ein paar jahren studium sollte es auch so sein, wurden aber mehr sozialisiert und indoktriniert als andere im sinne der herrschenden klasse.
die „richtigen“ pw werden vom staat angestellt. falls es andere gibt, sieht und hört man sie nicht. ich denke, daß 10% nen job in der politik kriegen, der rest programmiert webseiten oder so.
So habe ich es auch bisher erlebt. In meinem nächsten Umfeld aus Familie und Freunden gibt es mehrere Geisteswissenschftler, drei von denen haben sogar Doktortitel. Eine dieser Personen arbeitet direkt für die Regierung, die anderen beiden Doktoren arbeiten für regierungsnahe „NGOs“. Diese Personen sind mit Abstand die am schlimmsten indoktrinierten Menschen die ich kenne. Die plappern jeden noch so idiotischen „Talking Point“ der Staatspropaganda 1 zu 1 nach.
Geht ja wohl auch nicht anders. Wenn sie kritische Gedanken zulassen würden, könnten sie in ihrem Arbeitsumfeld kaum funktionieren.
Und wer traut sich in Deutschland z.B. im Zug über die „Ukrainehilfen“ zu sprechen? Je omnipräsenter ein Thema in den Nachrichten ist, desto weniger wird von Privatleuten öffentlich darüber gesprochen – komisch, nicht?
Soziale Distanzierung braucht man als Zwischenschritt, wenn als Nächstes unbemerkt Leute verschwinden sollen. Wo in Kürze humanoide Roboter die Welt bereichern sollen, ist für Menschen schlicht kein Platz. Das geht aber erst, sobald kein Hahn mehr danach kräht.
„Die so genannte Spirale tritt auf, wenn jemand eine Meinung zu einem kontroversen Thema äußert und dann auf heftige Kritik einer aggressiven Minderheit stößt – vielleicht sogar auf scharfe Angriffe.“
Diese aggressive Minderheit ist allerdings auf vielen Politikfeldern die woke Schickeria, vorzugsweise die Kinder der sorgenbefreiten oberen Mittelschicht.
Insofern irritiert mich, dass er da „Kampagnen von Aktivisten gegen ‚Wokism'“ als Beispiel anführt, also der hoffnungslose „Konflikt“ zwischen rechten und woken Schreihälsen. Auch wenn ich verstehe, was er meint, waren es trotzdem die Woken, die damit angefangen haben, zumindest in Europa, in den USA mag das anders sein.
Ich kann jetzt hier zum xten Mal die Webersche Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik empfehlen. Der „Wertewesten“, auch diese Bezeichnung zeigt das, hat sich in eine Art Gesinnungstyrannei verwandelt, ich sage „eine Art“, weil Werte ja nicht mehr erkennbar sind. Es wird halt ständig eine neue apokalyptische Sau durchs Dorf getrieben.
Die Regierenden wollen ihre Bevölkerungen zu Aktivisten für die Regierungsvorhaben erziehen, die angeblich samt und sonders der Verhinderung des Weltuntergangs dienen.
Das ist natürlich nur noch die Simulation von Gesinnung. Was nicht dabei herauskommen kann, ist eine Gesellschaft, die souverän die eigene Zukunft in die Hand nimmt. Da hat der Autor natürlich recht. Und nur dann, wenn wirklich konstruktiv über die Zukunft geredet werden soll, zahlt sich Pluralusmus auch aus.
Wir erleben die Auflösung des Westens –
kaum jemand ist drauf vorbereitet.
Diese Auflösung greift schneller und viel weiter um sich, als es Emmanuel Todd erwartet hat.
Ich finde es recht verdienstvoll, dass der Autor – wenngleich sehr kurz – auch die zweifellos stattfindenden Kampagnen GEGEN den ‚wokeism‘ erwähnt. Vielleicht kenne ich ja die falschen Leute, aaaaber zumindest in persönlichen Gesprächen höre ich von den Mit-Dialogisierenden nie Sprüche, die in Richtung fanatischer PC gehen, normale Äußerungen, Maß und Mitte, auch Desinteresse an Sprachbewusstsein bis hin zur Kritik, derlei sei übertrieben (worden), zuweilen auch mit dem Hinweis versehen, man dürfe ja weniger sagen als früher bzw. kaum noch etwas … usw. usw.; möglicherweise habe ich halt vor allem Umgang mit recht konservativen bis maximal sehr gemäßigt linksliberalen Leuten, Sprachpolizei: Fehlanzeige.
Kapitalismus halt…..
Ich sehe da aber auch eine Heuchelei des Autors. Hat „Cancel Culture“ mit Trump begonnen, oder die Zensur sozialer Medien, Debanking von Blogs und Webauftritten, Verfolgung und Massenentlassung von Journalisten, die den „Russiagate“-Betrug kritisierten? Der NeoMcCarthyismus begann spätestens 2016, als die Siegesgewissheit der Demokraten und des liberalen Milieus durch den Wahlsieg Trumps erschüttert wurde, er hat aber auch frühere Wurzeln in der ideologischen Machtergreifung der Neocons, bipartisan wise.
In den USA, wie ich sie aus den sechziger bis achziger Jahren kannte, gab es eine Kultur des agree to disagree, Vielleicht etwas harmoniesüchtig, aber es machte es möglich, dass Evangelikale und Kommunisten in der selben Familie, im selben Club, derselben neighbourhood mit einander friedlich umgingen, in einer Weise, die in der BRD schwer vorstellbar gewesen wäre. Die das zerstört haben, waren eher die „Woken“ und die „progressiven“ „culture wars“. Man fühlte sich im Recht, als SJW, und machte keine Gefangenen.
olala, da bin ich jetzt ein Heuchler, wenn ich einen Zusammenhang außer acht lasse! Naja, wir leben ja offensichtlich in Zeiten der `kreativen´ Neudefinierung von Begrifflichkeiten….
…im übrigen sehr ich die beschriebenen Zusammenhänge auch historisch und nicht aktuell situativ,,,
Super Analyse. Danke dafür und (! – ganz im Sinne des Textes), daß sie hier, auf Deutsch, veröffentlicht wurde.
Interessant ist, dass in der zitierten Sozialstudie das gegenseitige Misstrauen am tiefsten im Jahr 2015 war. Also vor der Wahl Trumps. Und sich danach das Vertrauen verbessert hat. Also aus der Studie ergibt sich keine Schuld von Trump. Eher im Gegenteil.
https://www.pewresearch.org/2025/05/08/americans-trust-in-one-another/
Man sieht an den Kommentaren ganz deutlich, das mal wieder der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Es geht doch nicht um Trump, Wokeism oder Israel, das sind doch nur Beispiele. Sondern es geht um Noelle-Neumann und das Phänomen der Schweigespirale.
Insofern schade, dass der Artikel dieses Phänomen nicht tiefer ergründet. Bei Themen wie Essen, Kleidung, Fußball, Frisuren oder Automarken darf es doch pluralistisch sein, da schweigt niemand. Man wird für abweichende Meinungen vielleicht mal schief angesehen, aber deswegen nicht gleich verstoßen.
Für mich stellt sich deshalb zunächst die Frage, warum ein Clan-Wesen sich entgegen seiner Natur wie ein Herdentier verhält. Man dackelt zunächst mal nur seinem sozialen Umfeld hinterher, auch wenn einem die Richtung nicht gefällt. Das ist kein echter Herdentrieb, sondern die Bindung zur einer Gruppe und die Furcht um seine soziale Existenz.
Was die Clans veranlasst, sich bestimmten Meinungsströmungen einer Herde anzuschließen, muss also von besonderer Bedeutung für bestimmte Personen sein. Das können eigentlich nur diejenigen sein, welche die hierarchischen Hühnerleitern bevölkern, wo sie untereinander eigene Gruppen bilden. Der Staatssekretär gebietet den Referatsleitern, diese befehlen ihren Direktoren, die wieder den Abteilungsleitern und so weiter. Da gelten bestimmte Meinungen als Ungehorsam und werden nicht geduldet.
Stellt sich dann die Frage, wie das soziale Umfeld der Wichtigtuer in den Sog der von oben verordneten Meinungen gerät. Lose verbundene Gruppen aus Familie und Arbeitskollegen, Schrebergartenverein oder Nachbarschaft werden wie durch unsichtbare Schnüre in den Mainstream gezogen, selbst gegen den Willen einzelner. Genau das führt zu einer gruseligen Verunsicherung. Das sei rational nicht mehr nachvollziehbar, schrieb hier kürzlich mal jemand. Aber bei diesen speziellen Themen der Wichtigtuer geht es eben immer auch um den Status. Ob sich solche Themen von selbst finden oder dazu erdacht werden, ist eigentlich egal. Selbst der niedrigste Rang ist noch einer, weil er sich unterordnet und damit dem Clan angehören darf. Wer das irrational findet, der bezweifelt möglicherweise, dass seine Daseinsberechtigung vom Wohlwollen eines Wichtigtuers abhängen sollte. Glückwunsch.
Ich bin überzeugt, dass die Konzernmedien schon länger hochprofessionell mit einer unterbewussten Verschlüsselung arbeiten, die sich auch thematisch an Rädelsführer richtet. Panische Angst um ihre Ehre bereitet ihnen Schweißausbrüche, während sie ihr Umfeld mit Teile-und-Herrsche-Strategien traktieren, ohne dazu aufgefordert oder belehrt worden zu sein. Anprangern, Herabwürdigen, Verurteilen, Besserwissen, Verleumden, Drohen usw., all das machen die Obrigkeitsmedien doch rund um die Uhr vor – machen sie eigentlich noch was anderes? Und die „Alternativen“ helfen dann auch nicht viel, wenn sie zwar in der Sache andere Meinungen bedienen, aber in ihrer Art nicht unähnlich agieren. Da schafft der Zank um die Reizwörter kostenlosen Content, während die Herde unaufhaltsam weiterzieht…
Was bin ich froh in Deutschland zu leben.
Hier ist mir erst bewusst geworden wie wertvoll meine Meinung ist.
Die ist so wertvoll, die behalte ich lieber für mich.
Mir ist das gerade bei den Youtube- Fans des Neoliberalen aufgefallen, die maulen über so ziemlich jede „Demo“ von den Anderen, begreifen aber nicht dass da nur ihre eigene Forderung nach Arbeiten für kleines Geld bedient wird.
Oder glaubt wirklich jemand das die Gay- Paraden kein bezahltes, reisefreudiges Mietpublikum hat.
Wenn da nicht die Faeser und die Paus ein NGO- Reisebüro eingerichtet haben…