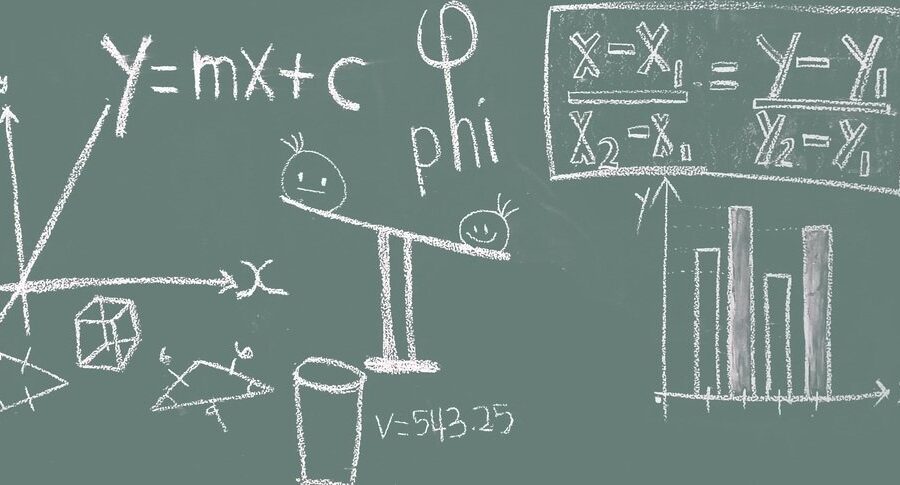
Eine Nachbemerkung vorab, in Reaktion auf die Diskussion mit den Leserinnen und Lesern: Der Unterschied zwischen anlasslosen Untersuchungen auf der einen Seite und medizinischer Diagnostik bei konkreten Problemen auf der anderen sollte stärker berücksichtigt werden. Der folgende Artikel bezieht sich auf die anlasslosen Untersuchungen. Niemand, der ein körperliches oder psychisches Problem zu haben glaubt, soll von der Inanspruchnahme professioneller Hilfe abgehalten werden. Eine neuere Studie in der angesehenen Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine zeigte erst kürzlich, dass durch die Ausdehnung von Untersuchungen bei jüngeren Personen immer mehr Tumore gefunden werden – inzwischen tatsächlich sogar mehr als doppelt so viele wie Anfang der 1990er. Die Sterblichkeit durch Tumore bleibt allerdings konstant. Vereinzelte Ausnahmen, zum Beispiel beim Darm- oder Gebärmutterhalskrebs, werden mit einem ungesünderen Lebenswandel in Zusammenhang gebracht.
Eine kurze Lektion vom deutschen Statistik-Papst, Beispiel Mammografie (Brustkrebsuntersuchung).
Gesundheit ist ein hohes Gut, für manche vielleicht sogar das höchste. Denn wer möchte schon lange leben, wenn das ein Dahinsiechen wäre? Dementsprechend finden wir auch in der medialen Welt täglich Gesundheitsinformationen. Nicht allen tut das gut: Sie erfahren Krankheitssymptome, über die sie lesen, am eigenen Leib oder der eigenen Psyche. Oder sie werden zumindest verunsichert. Und oft heißt es: Je früher man etwas entdeckt, desto besser die Heilungschancen.
Ein Gang zum Hausarzt oder zur Fachärztin soll Klarheit schaffen. Die biomedizinische Forschung und Anwendung verspricht Sicherheit mit den Methoden der „harten Naturwissenschaft“. Doch in der Wissenschaft des Lebendigen, in den Lebenswissenschaften, ist etwas selten ganz schwarz oder weiß – oder in Begriffen der binären Logik: null oder eins. Deshalb sind statistische Verfahren meist unverzichtbar. Diese sollte man besser verstehen, wenn man sie anwendet und ihre Ergebnisse verbreitet.
Der im Untertitel genannte „Statistik-Papst“ bin natürlich nicht ich, sondern der (inzwischen emeritierte) Psychologieprofessor und frühere Max-Planck-Direktor Gerd Gigerenzer (Jg. 1947). Er plädiert nicht nur für mehr theoretische Kenntnisse in seinem Fachgebiet, sondern beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit häufigen Missverständnissen statistischen Wissens. Hier im Blog ging es schon früher um seine „Unstatistik des Monats“, zum Beispiel bei der Übertreibung von Risiken des Alkoholkonsums.
Beispiel Mammografie
Für einen neuen Aufsatz hat er sich die Kommunikation von Krankheitsrisiken bei Krebsuntersuchungen genauer angeschaut. Und das folgende Beispiel hat er, auf der Grundlage echter Daten, auch in der medizinischen Fortbildung erprobt. Wenn Sie nicht gleich die richtige Antwort wissen, ist das nicht der Weltuntergang: Die meisten Gynäkologinnen und Gynäkologen kamen vor Gigerenzers Kurs auch nicht auf die richtige Antwort.
Schauen wir uns das konkrete Beispiel an:
- Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau Brustkrebs hat, beträgt 1 Prozent. (Das nennt man auch „Prävalenz“.)
- Wenn eine Frau Brustkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests 90 Prozent. (Sensitivität des Tests)
- Wenn eine Frau keinen Brustkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests 9 Prozent. (Falsch-Positiv-Rate des Tests)
Jetzt die Frage: Frau F bekommt nach einer Untersuchung beim Gynäkologen ein positives Mammografie-Ergebnis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich Brustkrebs hat? (Auflösung unten)
- 90 Prozent
- 81 Prozent
- 9 Prozent
- 1 Prozent
Bedingte Wahrscheinlichkeiten
Der häufigste Fallstrick dürfte die Sache mit der Sensitivität des Tests sein, also mit der hier genannten Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Tatsächlich wählten in einem (allerdings nicht repräsentativen) Versuch Gigerenzers mit 160 Gynäkologen und Gynäkologinnen knapp die Hälfte diese – falsche – Alternative. Auf die Alternativen 2, 3 und 4 entfielen 13, 21 und 19 Prozent der Stimmen.
Aber warum ist Alternative 1 falsch? Dafür sollte man sich keine Prozente anschauen, sondern konkrete Zahlen: Stellen wir uns 1000 Frauen vor, die eine Mammografie vornehmen lassen. Laut der Prävalenz haben 1 Prozent beziehungsweise 10 von ihnen Brustkrebs. Wegen der Sensitivität von 90 Prozent bekommen neun von ihnen ein korrekt-positives und die verbleibende zehnte ein falsch-negatives Ergebnis.
Jetzt wissen wir aber auch, dass von den Frauen ohne Brustkrebs 9 Prozent, also in diesem Beispiel 89, ein falsch-positives Ergebnis bekommen. Von den 1000 Frauen haben wir also 9 + 89 = 98 mit einem positiven Mammografie-Ergebnis. Doch von denen stimmt das nur bei 9 von 98 und ist es falsch bei den restlichen 89.
Bei Frau F wissen wir ja nicht, ob sie wirklich Brustkrebs hat oder nicht. Darüber sollte die Mammografie gerade Aufschluss geben. Mit dem positiven Test wissen wir aber nur, dass sie in die Gruppe der 98 fällt. Da von denen „nur“ 9 wirklich Brustkrebs haben, ist das richtige Ergebnis auf die Frage: 9:98 = 9,2 Prozent, also (gerundet) Alternative 3.
Finanzielle Interessen
Gigerenzer geht in seinem Artikel noch etwas weiter: Er verweist darauf, dass die Fortbildung für die Ärztinnen und Ärzte oft von biomedizinischen Firmen organisiert wird – in Luxushotels an Luxusorten. Damit hätten sie Kontrolle darüber, was diese Fachleute lernen. Das Folgende sagt, wohlgemerkt, kein Verschwörungsdenker, sondern einer der angesehensten Psychologen und Wissenschaftler Deutschlands:
„Innerhalb von zwei Jahren schulte ich insgesamt etwa 1.000 Ärzte. Dabei erfuhr ich, dass der Großteil der ärztlichen Fortbildung von der Industrie finanziert und organisiert wird. Einige Ärzteorganisationen bieten zwar eigene Kurse an, können aber mit den Vorteilen großer Pharmaunternehmen nicht mithalten, die Ärzte und manchmal sogar deren Partner in Luxushotels an attraktiven Reisezielen einfliegen lassen – alle Kosten inklusive. Diese Investition lohnt sich: Millionen von Ärzten wissen das, was die Industrie will, dass sie wissen.“ (Gigerenzer, 2026, S. 367)
Ein Schelm, wer hierin ein Geschäftsmodell sieht: Gerade verunsicherten Patientinnen und Patienten wird somit vielleicht vermittelt, dass sie für ein längeres und gesünderes Leben immer mehr und immer früher testen lassen müssen. Vergessen wir nicht, dass es auf dem Gesundheitsmarkt Jahr für Jahr um viele Milliarden geht!
Eine andere Auswertung von Krebsuntersuchungen in Gigerenzers Artikel deutet aber darauf hin, dass eine frühere Diagnose oft nicht das Leben verlängert. Am ehesten scheinen noch Darmkrebsuntersuchungen mit der Sigmoidoskopie (einer direkten Untersuchung des Dickdarms) zu nützen – doch selbst dann geht es um eine Lebensverlängerung von im Mittel nur 100 Tagen.
Fazit
Das Thema ist natürlich komplexer, als ich es hier in einem kurzen Blogartikel beleuchten kann. Die gute Nachricht ist immerhin, dass durch die Tests niemand früher stirbt. Aber die Patientinnen und Patienten bezahlen dann mitunter einen psychologischen Preis: durch Unsicherheit, Angst und eventuell unangenehmen Untersuchungen. Zum Beispiel ist bekannt, dass der Antigen-Test auf Prostatakrebs in der Praxis oft irrelevant ist. Denn die Betroffenen alten Männer sterben oft an einer anderen Ursache, bevor ihre Prostata ernsthafte Probleme bereitet. Der Profit bestimmter Akteure auf der anderen Seite ist dahingegen sicher.
Ich nehme mitnichten den Standpunkt ein, nicht mehr zum Arzt zu gehen oder sich nicht mehr genauer untersuchen zu lassen! Aber mit dem richtigen Verständnis, an das uns Gerd Gigerenzer mit seiner Forschung seit Jahrzehnten immer wieder erinnert, wird der Gesundheitskult unserer Zeit doch etwas relativiert. Selbst ein positives Testergebnis kann – wie im genannten Beispiel – sogar in der Mehrheit der Fälle negativ sein, also auf keine Krankheit hindeuten. Wenn man das richtig kommuniziert, kann man vielen Patientinnen und Patienten potenziell helfen.
Eine auch für Laien einfach zu merkende Schlussfolgerung ist zudem: Man sollte sich von relativen Angaben (z.B. 50 Prozent mehr, Verdopplung) nicht in die Irre führen lassen. Eine Angabe der konkreten Zahlen ist oft viel aussagekräftiger. Auch im Beispiel hier muss man keine Statistikkenntnisse haben, um zu verstehen, dass bei 1000 getesteten Frauen und 98 positiven Ergebnissen nur 9 dieser 98 wirklich Brustkrebs haben. Und auch im Wissenschafts- und Medizinjournalismus kann man sich das hinter die Ohren schreiben, sowie nicht zuletzt in der medizinischen Ausbildung.
Quellen:
- Gigerenzer, G. (2026, im Erscheinen). Risk communication: Truth and trickery about cancer screening. In T. Reimer, L. van Swol, & A. Florack (Eds.), The Routledge handbook of communication and social cognition (pp. 367-387).
- Eine ähnliche, doch ältere Arbeit: Krämer, W., & Gigerenzer, G. (2005). How to confuse with statistics or: The use and misuse of conditional probabilities. Statistical Science, 223-230.
Der Artikel wurde zuerst auf dem Blog „Menschen-Bilder“ des Autors veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Perspektiven aus der Depressions-Epidemie. Was Depressionen sind und wie man sie behandelt“.
Ähnliche Beiträge:
- Frauen haben ein deutlich höheres Sterberisiko, wenn sie von einem Mann operiert werden
- Warum wird ADHS immer häufiger und auch bei Frauen diagnostiziert?
- Die weiße Pest ist wenig lukrativ
- Krankheit als transformative Erfahrung
- Das Gespenst der Cannabis-induzierten Psychosen und Schizophrenien geht um



wenn ich zum Arzt gehe, und einen entsprechenden positiven Befund bekomme, dann ist das ganze für mich kein statistisches Problem mehr, sondern ein höchst individuelles, sehr konkretes. Ab da habe ich mich dem Befund zu stellen, unabhängig von einem möglicherweise falsch positiven Befund. Auch die statistische Überlebenszeit ist ab einem echt positiven Befund irrelevant, sondern hängt vom konkreten Krankheitsbild ab, Statistik hin oder her. Dagegen ist die Statistik allerdings für den Mediziner relevant.
Wenn statistisch validiert ein Test das Leben nachweislich NICHT verlängert, dann mag man dazu neigen solche Tests nicht zu bezahlen oder gar zu verbieten. Es könnte jedoch sein, dass ein Patient eine Mutter hatte, die an Krebs verstarb und daher jedes ihrer Kinder genetisch eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzt ebenfalls an Krebs zu versterben. Macht ein Kind einen solchen Test mit positivem Ausgang und folgt der Schnippel-Empfehlung, so könnte sich seine Lebenserwartung an die nicht genetisch Vorbelasteter annähern.
Damit ist das Testen dann sinnvoll wenn bei Vorbelastung eine Lebensverlängerung durch die befolgte Behandlung nachgewiesen ist.
Ist doch logisch!
Bin ich individuell betroffen ist mir die Statistik wurscht. Dennoch weist Herr Schleim völlig zu Recht auf statistische Fallstricke hin. Fallstricke die es in nahezu jeder mit statistischen Methoden arbeitenden Wissenschaft gibt. Ich erinnere mich an eine Statistik aus den 70er Jahren des 19 Jhh. bei denen 2 französische Wissenschaftler in Paris die Grössen von kolonial zusammengerafften Schädeln vermessen hatten und mit europäischen Schädelgrössen verglichen hatten. Das Ergebnis bildete dann eine zentrale Grundlage der faschistischen Rassenlehre und war der Hintergrund des obsessiven Schädelvermessens im deutschen Faschismus. Allerdings stammten die aus Afrika kommenden Schädel vorangig von Kindern, schlecht ernährten Menschen und jung gestorbenen Frauen. Die zum Vergleich herangezogenen europäischen Schädel stammten dagegen von gut ernährten alten Männern mit grissem Schädeldurchmesser. Die Statistik war somit von Anfang an methodisch falsch durchgeführt und die Schlussfolgerungen unwissenschaftlich und falsch. Allerdings mit politisch katastrophalen Folgen.
Sie weisen zu recht darauf hin, dass der Mensch ein Individuum mit seiner eigenen Erfahrung ist, und kein statistischer Mittelwert in einer Gleichung.
Aber bei den HIV-Tests ist das ja auch ähnlich: Der erste Test hat zwar eine hohe Sensitivität, finde also die meisten mit der Infektion. Weil die Krankheit (zum Glück) sehr selten ist, 1:1000?, sind viele positive Ergebnisse aber falsch-positiv.
So etwas sollte man schon wissen. Das ist dann nicht „nur Statistik“, sondern sehr lebensrelevant. Es wird dann ja ein weiterer Test gemacht. Es gab aber schon Fälle von Personen, die sich nach so einem ersten positiven Test das Leben nahmen.
Zumindest der Arzt sollte es wissen ubd dieses Wissen dem Betroffenen kommunizieren. Das ein Betroffener einen positiven Befund vom Spezialiszen weiter abklären muss, sollte Standard sein.
Es kann aber so auch mehr Schaden angerichtet werden. Beispiel aus meinem Umfeld mit hoffentlich der richtigen Krebsart: Befund Nierenkrebs. Biopsie führte zur Streuung, ein paar Wochen spätee war sie tot. die sofortige Entfernung wäre besser, weil sicherer gewesen. Heisst, die Statistik hilft da nicht weiter
Zu dem ersten Punkt: Deshalb macht Gigerenzer das ja seit Jahrzehnten.
Um Ärztinnen und Ärzten die Denkweise näher zu bringen, bräuchte man aber keinen „Statistik-Papst“ wie ihn. Dass dass trotzdem nicht gemacht wird, verrät schon auch etwas über das System. Aber gut, die müssen im Studium schon so viel aus so vielen verschiedenen Gebieten lernen…
Eigentlich ist das, was der Herr Schleim berichtet, ein uralter Hut.
Auch das Suizid-Beispiel ist nicht an den Haaren herbeigezogen.
Sie können ja mal versuchen, sich vorzustellen, was ein solcher falsch positiver Befund mit ihnen macht (immerhin knapp 10%). D.h., wenn ein solcher Test obligatorisch ist, werden neun von hundert auf einen unnötigen Höllentrip geschickt. Selbst wenn dann der „Spezialist“ nichts findet, müssen Sie schon hartgesotten sein, wenn Sie sich dann sagen können, okay, war einfach nur Fehlalarm.
Umso schlimmer, daß vielen Ärzten das nicht bewußt ist.
Ärzte sind letztendlich Glücksache. Und sofern sie nicht in der Forschung arbeiten, sind Ärzte eben keine Wissenschaftler. Sie arbeiten mit wissenschaftlich generierten Erkenntnisen, sind aber in der Regel gar nicht in der Lage, wissenschaftliche Studien selbst zu bewerten. Wenn es irgendwo in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird, gilt es als wahr.
Die böse, böse Pharmaindustrie – da verkauft sie doch tatsächlich Tests, bei den denen von 1000 Testpersonen nur 9,2 erfahren, dass sie eine Krankheit haben, von der sie vorher nichts wußten. So wenig? Und Außerdem die ganze Testerei beunruhigt die Leute auch noch und wer weiß, ob und wie viele von den neun Personen wirklich gerettet werden? Da muss der Staat aber unbedingt einschreiten – weg damit, raus aus dem Leistungsverzeichnis der Krankenkassen! Darmspiegelung: raus aus dem Leistungsverzeichnis, vaginaler Ultraschall: raus (ach nein – der wurde ja schon gestrichen), Sicherlich gibt es noch einiges mehr, mit dem man der bösen Pharmaindustrie den Gewinn schmälern könnte.
Liebe Leute lernt es endlich: Wenn wir den Leistungskatalog der Krankenkassen kürzen, schränken wir nicht die Dienstleistungen für unsere sauer verdienten Krankenkassenbeiträge ein, nein: wir zeigen der Pharmaindustrie, wo der Hammer hängt!
Ist schwierig nachzuvollziehen, eine Grafik wäre hilfreich gewesen.
Das ist pure Demagogie im Rahmen der im Westen laufenden eugenischen Kampagne zur Opferung / fahrlässiger oder vorsätzlicher Tötung von „Alten, Schwachen, Kranken“.
Die Aussage der Prävalenz: 100 von 1000 Frauen entwickeln im Laufe ihres Lebens einen bösartigen Tumor im Brustgewebe.
Die Angabe zur Sensitivität der Mammographie ist erklärungsbedürftig. Ich habe keine Lust, das anstelle von Herrn Schleim zu recherchieren und zu wägen, der die verdammte Pflicht gehabt hätte, das zu tun, nenne also nur die mir bekannten Parameter.
– Die Physik der Röntgenologie garantiert die Erkennung eines bösartigen Tumors ab einer bestimmten Größe.
– Sie garantiert aber nicht Differentialdiagnose zu gutartigen Tumoren und anderen Wucherungen, v.a. Zysten. (obwohl sie in vielen Fällen gute Hinweise dazu gibt)
– Für die Differentialdiagnose gibt es die Biopsie.
Zwischenergebnis: Der diagnostische Wert eines mammographischen Screenings unabhängig von Tastbefunden ist folglich gegeben in der Quote radiologisch unerkannter bösartiger Tumore in diesem Stadium, gewichtet mit der jeweiligen statistischen Metastasierung der verschiedenen Tumorarten in demselben.
Der diagnostische Wert ist freilich nur die halbe Miete, die andere Hälfte ist die Erfolgsquote von Heilbehandlungen. Die liegt offiziell jetzt zwischen 80 und 90%. Ein vollständiges statistisches Bild erhält folglich nur, wer die Zahl der Tumore, die ohne Screening unerkannt geblieben wären, mit der therapeutischen Erfolgsquote der zugehörigen Stadien gewichtet.
Bei dem illustrativ erwähnten PSA – Test liegen die Verhältnisse völlig anders, weil der überhaupt keine Kenngröße eines bösartigen Tumors liefert. Er liefert eine Kenngröße über eine verbreitete Begleiterscheinung raumgreifender Vorgänge in der Prostata, und das nicht einmal ausschließlich.
Wenn man schon 1% mit 10% verwechselt – kann man dann noch ernst genommen werden?
Das hier ist übrigens kein medizinisches Fachjournal. Es ging um das Verständnis von Statistik bei solchen Tests. Dass es in der Praxis komplexer sein kann, ist klar. Schreiben Sie doch einen gynäkologischen Text darüber, wenn Sie wollen. Für Interessierte findet sich am Ende des Texts eine Quellenangabe mit ausführlicheren Informationen.
„… ab einer bestimmten Größe.“
Da sagen Sie es ja selbst: Unter bestimmten Voraussetzungen, die im hier beschriebenen Beispiel (Mammografie) gar nicht vorliegen.
Ich frage mich ernsthaft, warum @Quana eigentlich nicht SÄMTLICHE Artikel zu ALLEN Themen verfasst.
Dann müsste er auch keine Kommentare mehr schreiben.
Mein Posting ist konzeptionell daneben, ich war in Gedanken woanders.
Das Argument steht trotzdem da, und Du hast es anscheinend verstanden, Stephan Schleim:
Wenn der Nutzen von Mammographien evaluiert sein soll, ist die Prävalenz des Brustkrebses keine Bezugsgröße, sondern die Rate der erkannten bösartigen Tumore zu unerkannten, gewichtet mit den Behandlungserfolgen bei Früherkennung im Vergleich mit deren Entfall. Nimmt man die Prävalenz des Krebses zur Bezugsgröße, ist nicht der Nutzen der Früherkennung evaluiert, sondern ein gesamtgesellschaftlicher Nutzen ihres Aufwandes, der sich bekanntlich in Euronen bemißt und den Volkskörper zum Gegenstand hat.
Die Demagogie liegt darin, daß jeder Leser, der sich die Subsummierung seines Leibes unter den Volkskörper einleuchen und gefallen läßt, sich umgehend gegen die Kostenlast der Kranken mobilisieren läßt, die im Falle der Früherkennungsaufwände umso höher ist, je geringer die Prävalenz.
Ich war heute übrigens in dieser Sache unterwegs: Ich habe um jedes MRT zur Beobachtung meines Prostatatumors zu kämpfen und habe heute entschieden, das vorerst zu lassen, weil mein PSA – Wert seit einem halben Jahr stabil ist. Ein aufgenötigtes Vabanquespiel.
@Schleim
Ich verstehe ihre Rechnerei nicht.
Bei mir kommt 100%-9%=91% heraus.
1. Die Prävalenz sagt mir rein gar nichts über die konkrete Patientin und welchen Befund sie heute hat. Die Prävalenz kann man also für die gestellte Aufgabe schlicht vergessen.
2. Die Sensitivität sagt mir wie oft ein vorhandener Brustkrebs bei der Monographie nicht entdeckt wird. Auch das ist hier völlig Wurst weil es ja ein „positives“ Ergebnis gibt.
3. Es liegt ein „positives“ Ergebnis vor und deshalb genügt es, die Rate falscher Ergebnisse zu kennen um zu berechnen, in wie viel Prozent der Fälle das Ergebnis korrekt ist. Wenn in 9% der Fälle die Mammografie falsch positiv ist, dann ist sie in 91% der Fälle richtig.
Was anderes ist es zu berechnen, wie Nützlich eine Vorsorgeuntersuchung wie die Mamographie ist. Um das zu berechnen bräuchte man tatsächlich alle drei Kenngrößen.
Rechne das mal spaßeshalber statt mit Mammographie mit einen Test für Hodenkrebs, der bei Frauen (den Quatsch mit Trans lassen wir mal weg) ein Prävalenz von 0 hat, durch.
Danke @Trux fuer deine Richtigstelllug. Wenn ich mir die ganzen restlichen Kommentare hier ansehe: Niemand ausser dir schien in der Lage, den Rechenfehler von @Schleim zu entlarven. Tja, was soll ich davon halten. Fast nur Rumsalbaderei, ne Meinung rausposaunen. Was sagt das wohl ueber unsere Gesellchaft aus?
Haben Sie das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit wirklich verstanden?
Mir scheint, dass Sie beim Ziegenproblem genauso scheitern würden, wie viele andere auch.
Ich moechte mich fuer meine Posts hier entschuldigen. Der Denkfehler von mir – und warhrscheinlcih auch von @Trux – war, dass alleinig aus der false positive Rate auf die true positive Rate rueckgeschlossen werden koennte. Und, Ihre Vermutung, dass ich grosse Muehe habe die Ursache fuer das Paradoxum des Ziegenproblems zu erkennen, ist richtig.
@ Markus:
Daß „Wechseln“ beim Ziegenproblem die bessere Strategie ist, läßt sich vielleicht so am besten verstehen:
angenommen, Sie entscheiden sich bereits vor Durchführung des Spiels, nicht zu wechseln. Dann ändert das Öffnen einer Tür mit Ziege genau gar nichts, Sie gewinnen genau dann, wenn Sie auf die „Gewinntür“ getippt hatten, und die Wahrscheinlichkeit dafür betrug 1/3.
Also: nichtwechseln bedeutet P(Gewinn) = 1/3
Wenn Sie sich aber entschieden haben zu wechseln, dann ist die Situation folgendermaßen: mit Wahrscheinlichkeit 2/3 hatten Sie zunächst eine Ziege erwischt, aber durch das Wechseln landen Sie jetzt mit Sicherheit beim Gewinn.
Sprich: Wechseln erzeugt P(Gewinn) = 2/3
Alles klar!?
Ich denke, dass der Knackpunkt darin besteht, dass die zuerst geoeffnete Tuer nur eine Ziegentuer sein darf und auch gilt, dass die vom Spieler gewaelte Tuer dabei perse von Oeffnung ausgeschlossen ist.. Und dies bedeutet damit, dass sich beim ersten Oeffnen die Gewinnwahrscheinlichkeiten nur zuwischen den zwei nichtgewaehlten Tueren verschieben koennen. Weil die geoeffnete Ziegentuer P(Gewinn) = 0 hat und sich die Gewinnwahrscheinlichkeit der urspruenglich gewaehlten Tuer P(Gewinn) = 1/3 nicht aendern konnte, kann daraus geschlussfolgert werden, dass die verbleibende, nichtgewaehlte Tuer P(Gewinn) = 2/3 haben muss.
Das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeit ist so kontraintuitiv, dass Herr Gigerenzer empfohlen hat, absolute Häufigkeiten zu verwenden.
Was heißt bedingte Wahrscheinlichkeit in diesem Fall?
Wenn die getestete Person Brustkrebs hat, dann und nur dann wird das in 90 % zu einem positiven Ergebnis führen. Diese Sensitivität ermittelt man an Gruppen, von den sicher bekannt ist, dass sie erkrankt sind. Die Prävalenz ist in dieser Gruppe gleich 1.
Wenn die getestete Person nicht an Brustkrebs erkrankt ist, wird der Test trotzdem in 9 % der Fälle zu einem positiven Ergebnis führen. Diese Spezifität ermittelt man an Menschen, von denen man sicher weiß, dass sie nicht erkrankt sind. Die Prävalenz in dieser Gruppe ist gleich 0.
Wird jetzt aber eine Person untersucht, von der man nicht weiß, ob sie zu der einen oder der anderen Gruppe gehört, muss man die wirkliche Prävalenz hinzuziehen. Man kann nun die Formel von Bayes heranziehen. Dieses Konzept verstehen aber nur wenige Menschen. Deshalb empfiehlt Herr Gigerenzer die absoluten Häufigkeiten. In diesem Beitrag hat er es an einem Flussdiagramm verdeutlicht.
https://pure.mpg.de/rest/items/item_2099832/component/file_2099831/content
Probieren Sie es selbst aus, indem Sie die Zahlen variieren.
@ Trux:
Ja, aber richtig negativ!
Nochmal: Spezifität = 91% bedeutet, daß von den gesunden Probandinnen 91% richtig(erweise) negativ getestet werden. Aber um die geht es nicht, unsere Bedingung ist nicht „Probandin gesund“, sondern „Test positiv“. Und unter der ist die Wahrscheinlichkeit für „Probandin erkrankt“ sehr wohl eine Funktion der Prävalenz und beträgt, wie Herr Schleim völlig korrekt dargelegt hat, in diesem Fall nicht 91%, sondern rund 9%.
Und dieses Ergebnis ist entgegen anderslautenden Behauptungen keine Demagogie, sondern folgt aus der Anwendung eines Satzes der Stochastik, nämlich dem von Bayes.
@Trux & Markus: Rechenfehler
Nein, Sie irren sich beide. Die Prävalenz ist entscheidend, um die Zahl der falsch-positiven Fälle zu errechnen. Man hat am Ende der Untersuchung bei der hypothetischen „Frau F“ nur ein positives Testergebnis, ohne zu wissen, ob es richtig- oder falsch-positiv ist. Darum geht es ja gerade.
Hier noch einmal: Bei 1000 Frauen haben 1% Brustkrebs, also 10. Es werden aber nur 9 richtig erkannt (Sensitivität 90%).
Dann bleiben 990 ohne Brustkrebs. Von denen bekommen 9%, also 89, ein falsch-positives Ergebnis. Rechnen Sie es nach, wenn Sie mir nicht glauben.
Man hat also 9 + 89 = 98 positive Tests. Bei „Frau F“ mit positivem Test weiß man (ohne weitere Untersuchungen) nicht, in welche Gruppe sie fällt. Da von den 98 Frauen 9 ein richtig-positives Ergebnis haben, ist die Wahrscheinlichkeit 9:98 = 9,2%.
Kann man sich in solchen Fragen nicht erst einmal verständigen, ohne dem anderen zu unterstellen, keine Ahnung zu haben?
Ich moechte mich bei Dir, lieber Stephan, entschuldigen. Es ist leider so, dass mir in letzter Zeit immer haeufiger Texte zu Augen kommen, bei denen ich – zum Teil sehr versteckte – Propagandatechniken wahr nehme. Auch bei Ihrem Artikel vermutete ich so etwas. Im Nachhinein kann ich mich nur bei Ihnen entschuldigen. Von Herzen.
Kein Problem. Ich bin bei Statistikaufgaben auch oft „falsch abgebogen“.
Sorry Herr Schleim.
Ich habe es jetzt verstanden.
Ich danke ihnen!
Mein Missverständnis war, dass ich hiervon ausgegangen bin:
„Die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven-Test beträgt 9%“
Gegeben war aber dies:
„Wenn eine Frau keinen Brustkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests 9%.“
Ich habe falsch-positiv anders verstanden als es tatsächlich definiert ist.
Daraus ergibt sich m.A. nach eine Frage:
Wieso definiert man die Falsch-Positiv-Rate nicht einfach so, dass man auch sofort verstehen kann was sie bedeutet?
(Natürlich Prävalenz mit einbezogen, denn niemand kann vorher wissen zu welcher Gruppe ein Patient gehört. Die Aussage bezöge sich dann auf die ganz normale Testsituation)
Ein positiver Mammographiebefund ist zu 90,8% falsch.
Nach meiner Definition wäre dann die Falsch-Positivrate mit 90,8% anzugeben und damit wäre allen geholfen, außer denen die Mammografie betreiben um damit ein Geschäft zu machen.
Das leidige bei solchen statistischen „Knobelproblemen“ ist, daß die Intuition trügerisch sein kann, man immer wieder durcheinander kommt und am Ende den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
„Mein Missverständnis war, dass ich hiervon ausgegangen bin:
„Die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven-Test beträgt 9%“
Gegeben war aber dies:
„Wenn eine Frau keinen Brustkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests 9%.“
Ich habe falsch-positiv anders verstanden als es tatsächlich definiert ist.“
Beide Aussagen sind identisch und Sie hatten diesen Punkt ursprünglich richtig verstanden. Denn falsch-positiv kann ein Test nur sein, wenn kein Brustkrebs vorliegt. Dagegen ist diese Aussage falsch:
„Ein positiver Mamographiebefund ist zu 90,8% falsch.“
s. Text: „Wenn eine Frau Brustkrebs hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests 90 Prozent.“
Das bedeutet, daß bei 10 Fällen von Brustkrebs in einem Fall der Test falsch-negativ ist. (Sensitivität)
Hierbei handelt es sich um Untererfassung durch den Test.
Die falsch-positiv Rate ist ähnlich (9%).
Da aber Frauen überwiegend keinen Brustkrebs haben, produziert der Test, sofern anlaßlos durchgeführt, wesentlich mehr falsch-positive als falsch-negative Ergebnisse. Und die Rate der falsch-positiven Tests ist annähernd zehnmal so hoch wie die Rate der Treffer.
Vermute, daß Sie entweder mit den Katgorien oder durch die absöluten Zahlen (im Beispiel wird ja von tausend Tests ausgegangen) durcheinander gekommen sind.
Oh mein Gott …
Nein, diese Aussage ist richtig!
(von minimalen Rundungsfehlern jetzt mal abgesehen)
Diese Behauptung können Sie nicht durch Fettdruck erklären, Sie müssen Worte benutzen.
Frau hat Krebs, Test sagt nein: 10% (bei 90% der Tests ist das Ergebnis korrekt).
Frau hat keinen Krebs, Test sagt doch: 10% (bei 90% der Tests ist das Ergebnis korrekt).
Nun sagen Sie bitte, was daran nicht stimmt.
Was Sie dort geschrieben haben stimmt ja!
Aber es widerspricht nicht der Aussage, 90% aller positiven Testergebnisse seien falsch!
Die 10% falsch positiven beziehen sich auf die fast 100 mal größere Gruppe der gesunden Frauen, und das sind absolut gesehen viel mehr als die 90% der sehr viel kleineren Gruppe der erkrankten Frauen.
10% falsch positive Tests bei 990 Gesunden sind 99,
90% korrekt positive Tests bei 10 Kranken sind 9.
Sprich: von insgesamt 108 positiven Tests sind 99, also gut 90% falsch positiv!
… Jetzt habe ich wenigstens was zum Nachdenken. Danke!
Im Schleimschen Artikel stand
‚Jetzt die Frage: Frau F bekommt nach einer Untersuchung beim Gynäkologen ein positives Mammografie-Ergebnis. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich Brustkrebs hat?‘ Antwort dazu im Text ein paar Zeilen darunter
‚9:98 = 9,2 Prozent‘
Dann wird bei DIESER Population die Fehlerhäufigkeit des Tests das Komplement zu 100% also 90,8% sein –
und jetzt reicht mir – kauft euch doch mal ein Statistikbuch!!!
Ein Statistikbuch ist gewiss zielführender als ihr pöbelnder Tonfall. Ich meine aber nicht, dass man zu allem, womit man sich beschäftigt, erst Fachbücher rezipieren muss (oder überhaupt kann), und ich glaube Ihnen auch nicht, dass Sie das tun.
stimmt !
Stimmt bedingt, sorry.
Wobei mich der Begriff Mammographiebefund etwas irritiert.
Aber die Aussage ist mißverständlich, da Trux daraus folgert, die Falsch-Positiv-Rate sei eigentlich 90,8%, was wiederum falsch ist.
Ergänze: Technisch oder praktisch gesehen verändert sich ja die Trefferquote, wenn man die Stichprobe verändert, z.B. durch Altersbeschränkungen, insofern wären nun 90,8% auch nicht unbedingt „intuitiver“, sondern dann irgendein anderer Wert relevant.
Letztendlich ist es ein ethisches Problem, wieviele Fehldiagnosen und deren Folgen nimmt man in Kauf, um eine richtige frühzeitig zu treffen.
Ja, wenn man dadurch eine Gruppe mit höherer Prävalenz erzeugt, wird der Test aussagekräftiger!
… oder zunächst mal ein kommunikatives, was sich aber lösen lässt, indem man den Betroffenen erklärt, was das Ergebnis genau bedeutet. Wie Herr Schleim das hier gemacht hat.
Weil zwei elementare Begriffe zur Charakterisierung eines solchen Testverfahrens „Sensitivität“ (Empfindlichkeit) und „Spezifität“ heißen und man sie so definiert hat, daß 100% jeweils das Optimum darstellen.
Eine Sensitivität von 100% bedeutet in diesem Fall: 100% der getesteten Krebserkrankten werden auch als solche identifiziert, es gibt also keine fälschlicherweise negativen Ergebnisse.
Eine Spezifität von 100% liegt entsprechend dann vor, wenn 100% der Gesunden korrekt identifiziert werden, der Test also keine falsch positiven Ergebnisse liefert.
Und Ihr ursprünglicher Fehler war, daß Sie von 9% falsch positiven Ergebnissen auf 91% korrekt positive geschlossen haben, was unzulässig ist: die Gruppe, die überhaupt falsch positive Testergebnisse erhalten kann, ist die der Gesunden, und wenn dort 9% falsch positiv getestet werden, dann erhalten die übrigen 91% nicht „korrekt positive“ Ergebnisse, sondern „korrekt negative“.
Ok jetzt?
Was mich mal erstaunt hat: bei wirklich sehr seltenen Krankheiten ist ein Mensch mit positivem Befund höchstwahrscheinlich gesund. Unter 100.000 sind vielleicht 5 krank, die mit obiger Wahrscheinlichkeit zu 90 Prozent erkannt werden. Aber 10.000 werden falsch positiv bewertet.
Was der Autor sagen will: da wird systematisch die Hypochondrie gefördert. Ergänzt durch die Apothekenrundschau, die stets neue Krankheiten vorstellt. Wobei der Leser dann meint, genau an dieser Stelle ein Zwicken zu verspüren. Und dann ist da gleich der Tausenderpack in der Werbung, der das bekämpft.
Als Linker weiß man, dass hier Konsumterror am Werke ist. Aber es sind nicht alle links. Oder verkehrt links. Das ist das Drama unserer Tage.
So funktionierte der PCR-Test.
Wie der PCR-Test funktionierte hängt davon ab, wie hoch die Prävalenz von Corona wirklich war ;-). Mit Ansetzung von unterschiedlichen Werten der Prävalenz (in den Grenzen zwischen 0% und 100%) gibt es da einen riesen Spielraum. Dumm nur, dass die Prävalenz zu den jeweiligen Zeiträumen, egal ob mit oder ohne Einschränkung der Grundgesamtheit, nicht bekannt sind ;-). So kann sich jeder raussuchen was er/sie/es möchte.
ps. Aber dann ist auch Würfeln ein anerkanntes mathematisch-statistisches Verfahren…
Ich las kürzlich, daß es eine Studie gibt, die belegt, daß nur jedem 7. positiven PCR-„Test“ überhaupt eine Infektion mit Sars-Cov2 zugrunde lag. Da war die betreffende Person auch noch lange nicht an Corona erkrankt. Starb sie aber, etwa nach einem Autounfall im Krankenhaus, wo man den Test bei der Aufnahme machte, war sie ganz offiziell ein „Coronatoter“.
Ist nicht ganz richtig: War die Person „geimpft“, wurde akribisch unterschieden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch den ct – Wert!! Also wie oft die polymerase chain reaction gefahren/wiederholt wird, welche sich exponentiell vervielfältigen! Übrigens wurden 2020 ct-Werte von >30-42 gefahren…
Ja, das ist der springende Punkt.
Wenn die Falsch-positiv-Rate viel größer ist als die Prävalenz – hier um den Faktor 9 –, dann kriegt man überwiegend falsch-positive Resultate. So aufgeschrieben, ist das eigentlich äußerst trivial. Aber in der Praxis ist da doch oft „der Wurm drin“.
Wer es etwas ausführlicher nachlesen möchte, kann dies in dem Buch „Risiko“ von Gerd Gigerenzer tun. Alternativ bietet sich der Download des Artikels „Glaub keiner Statistik, die du nicht verstanden hast“ vom gleichen Autoren an.
https://pure.mpg.de/rest/items/item_2099832/component/file_2099831/content
Darin erklärt er ausführlich was Prävalenz bedeutet und geht auf den den Unterschied zwischen relativem und absoluten Risiko ein. In der noch nicht aufgearbeiteten Pandemie wäre dieses Wissen übrigens sehr wichtig gewesen, um die 95%ige Wirksamkeit der Impfung besser einordnen zu können. In dem Beitrag „Der Impfstoff ist „zu 90 Prozent wirksam““ auf Unstatistik vom 02.12.2020 wird das näher erläutert.
https://www.rwi-essen.de/en/presse/wissenschaftskommunikation/unstatistik/archiv/2020/detail/der-impfstoff-ist-zu-90-prozent-wirksam
Wer den Begriff der Prävalenz richtig versteht, für den ist sofort klar, dass während verschiedener Zeitpunkte der Pandemie ein positives Testergebnis ganz unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten dafür lieferte, wirklich mit Covid-19 infiziert zu sein, obwohl an dem Test nichts verändert worden ist. Deshalb haben wirkliche Fachleute auch davor gewarnt, anlasslos zu testen, weil die Zahl der falsch-positiven dadurch in die Höhe getrieben wird. Es hätte nur bei Vorliegen von Symptomen oder anderen Hinweisen getan werden dürfen.
Ebenso verhält es sich mit den Reihenuntersuchungen auf Krebs oder anderen Krankheiten. Wenn man keiner Risikogruppe angehört (erblich bedingt, Alter) sollte man damit zurückhaltender sein. Ein verantwortungsbewusster Arzt wird das wissen und entsprechend beraten. Viele dieser als „Vorsorgeuntersuchungen“ (besser Früherkennung) bezeichneten Prozeduren bergen ein wenn auch geringes Risiko von schweren Nebenwirkungen (Darmperforation bei der Darmspiegelung, Infektionen oder Blutungen bei Prostatabiopsie, Schäden durch zu häufiges Röntgen).
Ich wundere mich, wie viele Leserinnen und Leser hier noch mit der Pandemie beschäftigt sind.
Ich hatte übrigens durchaus in meinem Blog (der damals unter Florian Rötzers Redaktion noch bei Telepolis erschien), schon im März und April 2020 auf solche Zahlenspiele hingewiesen, z.B. in:
Zahlen und Logik der Corona-Krise
Bei den PCR-Tests kam neben der Falsch-positiv-Rate noch hinzu, dass sie bei richtig-positivem Ergebnis nur Kontakt mit dem Virus und keine Erkrankung nachwiesen.
Tja, die Mainstream-Medien schockierten die Leserinnen und Leser tagtäglich mit neuen Horrormeldungen – und viele Leute waren schockiert, anstatt kritische Fragen zu stellen.
„Ich wundere mich, wie viele Leserinnen und Leser hier noch mit der Pandemie beschäftigt sind.“
Bei mir liegt es daran das immer noch die große Anzahl linker Kräfte, die ich durchaus für ihre theoretische und geistige Arbeit schätze, überzeugt sind 2020 hätte eine Gesundheitskrise stattgefunden…
Dankeschön für Ihre Arbeit und den obigen Text!
„Ich wundere mich, wie viele Leserinnen und Leser hier noch mit der Pandemie beschäftigt sind.“
Sind Sie im Ernst der Meinung, dass dieses Thema abgeschlossen ist? Ich möchte, dass wirkliche Konsequenzen gezogen werden. Dazu gehört vor allem die Verbreitung von Wissen. Prof. Gigerenzer hat auf die Problematik schon lange vor der Pandemie hingewiesen. Als Wissenschaftler bin ich überzeugt, dass der Verlauf ein anderer gewesen wäre, wenn in der Ärzteschaft, bei den Politikern, den Journalisten und nicht zuletzt in der Bevölkerung ein anderes Problembewusstsein vorhanden gewesen wäre. Daran können wir gemeinsam arbeiten.
Sie schreiben in Ihrem oben angeführten Beitrag:
„Wie ich hier darlegte, schuldet uns die regierende Politik jetzt Antworten auf brennende Fragen zur tatsächlichen Gefährlichkeit des Coronavirus. Die Medien, auch gemessen an ihrem eigenen Pressekodex, sollten die tagtägliche Dramatisierung mit irreführenden Berichten endlich unterlassen.“
Soll es das gewesen sein? Mich erinnert das an einen DDR-Witz:
»Bei nebligem Wetter irrt ein japanischer Tourist auf der Prager Straße umher. Er sucht den Weg zum Hauptbahnhof, der nur wenige Meter entfernt ist. Plötzlich trifft er auf zwei Polizisten, die er auf Englisch nach dem Weg fragt. Die beiden Polizisten zucken mit den Schultern. Der Japaner versucht es auf Französisch. Wieder nur Schulterzucken. Als er auch auf Japanisch nur Schulterzucken erhält, dreht er sich um und verschwindet im Nebel. Da sagt der eine Polizist zum anderen: „Mensch, der konnte drei Fremdsprachen.“ Der andere antwortet: „Und, hat’s ihm was genützt?“«
Wir haben immer noch nicht die richtigen Methoden, um hilfreiches Wissen breit zu vermitteln. Wir sind noch nicht einmal in der Lage, das Problembewusstsein dafür herzustellen. Wollen wir uns damit zufrieden geben?
Danke übrigens dafür, dass Sie sich an der Diskussion unter Ihrem Beitrag beteiligen. Das ist nicht selbstverständlich.
Erst einmal finde ich, dass Sie hier gute Diskussionsarbeit leisten und einen wichtigen Beitrag leisten.
„Und, hat’s genützt?“, könnte ich hier aber auch in den Raum stellen: Es gab ja einige kritische Stimmen, die teils nicht weiter beachtet wurden (wie bei mir) und teils massiv bekämpft wurden.
Letzteres führte aber auch dazu, dass bestimmte, eher am Rande stehende politische Bewegungen großen Zulauf erhielten. Wir haben, denke ich, beide noch eine Bundesrepublik miterlebt, in der drei, vier Parteien das im Parlament unter sich ausmachten. Heute sind es haarscharf fünf – wenn es dabei bleibt; in den Niederlanden übrigens SECHZEHN (da keine Wahlhürde).
Was ich damit sagen will: Ich kann meinen eigenen, kleinen Beitrag leisten; aber es nutzt nichts, immer als Einzelner gegen Windmühlen zu kämpfen. Ich konzentriere mich auf die Themen und Dinge, auf die ich einen Einfluss habe.
Apropos Alkohol: da läuft seit einigen Jahren eine Desinformationskampagne über die Bande der WHO, hinter der u.a. die Guttempler-Sekte steckt. Die hatten schon bei der Einführung der Prohibition in der USA ihre Finger im Spiel, sind aber, wie bei Religiösen Eiferern üblich, nicht lernfähig bzw. -willig.
Warum über die WHO-Bande? Die leiden unter chronischer Geldnot und sind daher käuflich. Und Kohle ist bei vielen US-Sekten das kleinste Problem. Gleichzeitig gelten Aussagen solcher Institutionen wie der WHO quasi als Beweis qua Autorität, insbesondere, weil die meisten Journalisten weder Intellekt noch Rückgrat haben, sowas zu hinterfragen. Es ist bequemer, den Bullshit der Obrigkeit nachzuplappern.
wen Details interessieren: die Stichworte Guttempler und WHO liefern ausreichend Einstiegslinks bei Google.
Was wäre der Mensch ohne Drogen… 😉
Beim Alkohol kann ich Schleim nicht folgen. Naturwissenschaftlich kann ich Kausalitäten bestimmen. Also Mechanismen wie Alkohol im Körper wirkt. Das wäre ein direkter Nachweis.
Statistisch kann ich höchstens die Wahrscheinlichkeiten bestimmter Korrelationen bestimmen. Das stellt aber KEINE Aussage über die Wirkung von Alkohol dar. Diese kann individuell durchaus sehr unterschiedlich ausfallen. Statistik beschreibt nie Kausalitäten.
Richtig! Und das ist auch so ziemlich das Erste, was in einer Statistikvorlesung vermittelt wird!
Strenggenommen nicht: in der Wahrnehmung der Natur wird eine Regelmäßigkeit entdeckt (in jedem unserer Experimente galt: „wenn A, dann B“), davon motiviert ein Naturgestz formuliert „immer wenn A, dann B“, und das dann zum Anlass genommen, die Kausalität „A verursacht B“ zu formulieren.
Das Problem ist der Schluß von „in unseren Experimenten“ auf „immer“, dessen Korrektheit letztlich nicht beweisbar ist.
Aber gut, das beherzige ich im Alltag auch nur selten …
Ich sehe eher fanatische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Werk, die Aufmerksamkeit und Geld brauchen, und darum immer extremere Empfehlungen aufstellen (jetzt: Jeder Tropfen Alkohol ist einer zu viel!). Inwiefern die WHO hier Instrument ist oder (Mit-) Täter, kann ich nicht beurteilen. Das ist an Absurdität kaum zu übertreffen, weil der Alkoholkonsum seit Jahrzehnten SINKT.
Also je weniger wir trinken, desto größer ist das Alkoholproblem?
P.S. An den anderen Leser: Dass Korrelation keine Kausalität belegt, ist eine Binsenweisheit. Wo hätte ich etwas anderes behauptet?!
Lesen sie mal ein paar der Links, die Google auswirft, die erklären, wer die Guttempler sind, wie sie versuchen, unter dem Deckmantel der Wissenschaft ihre Religion zu verbreiten, wie sie das tun und warum die WHO ein geeignetes Vehikel dazu ist.
Das „The Lancet“ die WHO bereits aufgefordert hat, zur Wissenschaftlichkeit zurückzukehren zeigt, dass die wiss. Gemeinde noch nicht verloren ist, im Gegensatz zu 95% der Schreiberlinge und Marktschreier…
Nochn Tip: Felix Bomdmanns Blog Blindlug #122 und 146
in einem früheren Beitrag zu diesem Thema hatten Sie versucht einer gezeigte Kausalität mit dem Verweis auf eine statistische Korrelation zu widerlegen. Darauf bezog ich mich, nicht auf den Artikel, der ja auch auf dem schmalen Grad zwischen beiden wandelt. (Realer Befund vs. statistischer Einordnung.)
Ansomsten wäre ich vorsichtig beim Begriff „fanatisch“ Wissenschaftler und Wissenschaftlerinben arbeiten immer interessengeleitet. Egal ob das Interesse intrinsisch durch Erkenntnis, Empathie, Egoismus etc. bedingt ist oder extern durch z.B. wirtschaftliche Anforderungen oder Ideologien (z.B. Negieren des CO2-Klimaeinflusses) hervorgerufen wird.
Korrelation ist kein Beleg von Kausalität, geschenkt.
Umgekehrt wird aber schon ein Schuh daraus: Wo keine Korrelation, da (wahrscheinlich) keine Kausalität. Wahrscheinlich ging es in dem Artikel, den Sie meinen, um den Anstieg der „Antidepressiva“, der nicht mit der Zahl der Suizide korreliert.
Theoretisch ist auch das kein 100-Prozent-Beweis, da es komplexere Zusammenhänge gibt. Aber zumindest als vorläufige Schlussfolgerung sollte man es aber doch anerkennen können.
Mhh. Die im Nachgang an die Herleitung folgenden Schlußfolgerungen kann man auch nur bringen, wenn man bar jeder Kenntnis über Handlungsabläufe in der Medizin ist. Aber: jeder darf sich outen. Das ist o.k.! Und die Politik freut sich über jeden, der freiwillig ein sozialsystemschonendes Frühableben wählt.
Nett! Ich liebe Stochastik. Easy berechenbar mit dem Modell der bedingten Wahrscheinlichkeit, der auf dem Multiplikationssatz beruht.
P(K) = Wahrscheinlichkeit Krebs = 0,01
P(G) = Wahrscheinlichkeit kein Krebs = 0,9
P(K * T) + P(G * T) = P (T) was der Gesamtwahrscheinlichkeit für ein positives Ergebnis unabhängig ob Krebs oder nicht entspricht.
Pt(K) = Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau, mit positivem Testen tatsächlich Krebs hat. Berechnung:
Pt(K) = P(K) * P(T)/P(K * T) + P(G * T)
= 0,01*0,9/0,01 *0,9 + 0,99* 0,09 =
10/109 = 0,09174311927 also 9.17%
Das die wenigsten Menschen das raffen ist mir ein Rätsel. Bin ich gut oder bin ich sogar besser als gut?
Ja, da hast du warhrcheinlich recht. Ich gehoere auch zu Jenen, die deine Rechnung nicht raffen. Ich dachte einfach, dass sich jede positiv getestete Frau mit 91% iger Wahrscheinlichkeit auf ihr Testrgebnis verlassen kann, da die Falschrate bei jeder positiv getesteten Frau nur 9% betraegt.
Herr Gigerenzer hat den Praxistest gemacht. In „Glaub keiner Statistik, die du nicht verstanden hast“ schrieb er dazu folgendes:
https://pure.mpg.de/rest/items/item_2099832/component/file_2099831/content
„a) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit positivem Mammografiebefund Brustkrebs hat, beträgt 81 Prozent.
b) Von 10 Frauen mit positivem Mammografiebefund haben etwa 9 Brustkrebs.
c) Von 10 Frauen mit positivem Mammografiebefund hat etwa eine Brustkrebs.
d) Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit positivem Mammografiebefund Brustkrebs hat, beträgt etwa 1 Prozent.
Die Gynäkologen durften die Antwort von den drei Informationen ableiten oder sich auf vorhandenes Wissen stützen. In jedem Fall ist c die beste Antwort: Nur etwa eine von 10 Frauen mit einer positiven Mammografie hat tatsächlich Brustkrebs. Für die übrigen 9 bedeutet dies: falscher Alarm. Vor dem Lehrgang beantworteten 60 Prozent der Gynäkologen die Frage mit a oder b und überschätzten somit die Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung stark. Nur 21 Prozent der Ärzte wussten die richtige Antwort!
Viele Mediziner können die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung demnach nicht vom Testergebnis ableiten, ebenso wenig kennen sie die Bedeutung von bedingten Wahrscheinlichkeiten wie der Sensitivität eines Tests oder der
Falsch-positiv-Rate (siehe rechts). Ärzte hätten es leichter, die korrekten Wahrscheinlichkeiten abzuleiten, wenn sie von natürlichen Häufigkeiten ausgehen würden, beispielsweise:
1. 10 von 1000 Frauen haben Brustkrebs.
2. Von diesen 10 Frauen mit Brustkrebs werden 9 positiv getestet.
3. Von den übrigen 990 ohne Brustkrebs werden dennoch etwa 89 positiv getestet.
Demnach ist das Testergebnis von 98 unter 1000 Frauen positiv, jedoch sind nur 9 dieser Frauen tatsächlich erkrankt (siehe Grafik rechts oben). Nachdem die Gynäkologen gelernt hatten, bedingte Wahrscheinlichkeiten in natürliche
Häufigkeiten umzurechnen, verstanden 87 Prozent von ihnen, wie die korrekte Antwort lautete.“
Was denken Sie, wie vielen Ärzten Sie mit der Formel von Bayes helfen würden, auf das richtige Ergebnis zu kommen?
Ehrlich gesagt bin ich – bei allem Respekt vor Medizinern – nicht wirklich von einer übermäßig hohen mathematischen Versiertheit bei letzteren überzeugt. Ich selbst bin Biologe und habe früher oft Studenten der Humanmedizin und auch Studenten der Veterinärmedizim Nachhilfe in Chemie und Physik gegeben. Mathematik ist ja leider bei Medizinern kein Pflichtfach (meines Wissens weder in der Vorklinik noch im Hauptstudium) Es gibt sicher einige Fachärzt/innen sowie sicher viele Mediziner, die in der Forschung tätig sind, die stochatische Methoden sowie Methoden der deskriptiven und analytischen Statistik sehr gut beherrschen, aber für die Regel halte ich das eher nicht. Mein Hausarzt hat jedenfalls weder von Stochastik noch von Statistik wirklich viel Ahnung. Es sei denn man würde ihm ein paar (möglichst bunte) Tortendiagrsmme oder Histogramme zeigen. Mein Hausarzt ist eine Seele von einem Menschen und ich hasse es eigentlich ihn zu kritisieren aber es ist leider so.
100 – 1 = 99, nicht 90.
Ihr Ergebnis stimmt fast – aber nicht ganz.
9/98 = 0,09183673469
Ich komme sowohl mittels Baumdiagramm und Anwendung von Bayes‘ Multiplikationssatz, als auch mittels 4-feldertafel auf 10/109. Bei einer 4-feldertafel kommt man auf eine WS für ein positives Ergebnis von 9,81% bei allen untersuchten Frauen. Die Schnittwahrscheinlichkei P(T geschnitten mit K) beträgt 0,9%. Der daraus resultierende Bruchteil ist 0,9/9,81 = 10/109. Ich kann mich zwar auch irren (erreichen humanen erst) glaube aber nicht wirklich, dass dies der Fall ist. Ich bin zwar kein Mathematiker sondern Biochemiker und Biologe haben aber früher sehr oft mit Stochastik zu tun gehabt.
Komisch. Ich komme sowohl mittels Baumdiagramm bzw inversem Baumdiagramm, als auch mittels 4-Feldertafel und Anwendung des Multiplikationssatzes von Bayes auf 10/109.
Nachtrag zur vorangegangenen Antwort: Wenn Sie eine 4-Feldertafel anlegen, werden Sie sehen, dass die gesamte Wahrscheinlichkeit für ein positives Testergebnis (also die Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebige Frau aus dem gesamten Kollektiv aller getesteten Frauen, sowohl die Kranken, als auch die Gesunden, 9,81% beträgt (dezimal 0,0981). Gemäß der Pfadregeln bei Laplace-Wahrscheinlichkeiten ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sowohl der Test positiv ist als auch ein Mammakarzinom vorliegt 0,01 * 0,9 = 0,009. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test negativ ist und die Frau einen Tumor hat ist 0,99 * 0,09 = 0,0891. Hieraus kommt man auf die oben genannte Gesamtzahl von 0,0981. Durch diese Zahl muss man die 0,009 teilen. Man erhält also einen Bruch 0,009/0,0981 der gekürzt 10/109. Ergibt.
So als Mathematiker:
Sowohl 9 als auch 98 sind (absolute) Zahlen,die sich auf das Beispiel mit 1000 (absolute Zahl) Probanden beziehen.
Also allermöglichtgrößte Vorsicht bei der Veröffentlichung von Zahlen mit 10+ Nachkommastellen.
Bei 1234 statt 1000 Probanden könnte es eventuell unter Umständen vielleicht ETWAS anders aussehen als 0,09183673469.
Der korrekte Ansatz wäre also, mit x Probanden zu rechnen.
x sollte sich am Ende rauskürzen. um eine Prozentzahl, unabhängig von der Anzahl der Probanden, als Ergebnis zu bekommen.
@Wolfgang Seidel-Guyenot ist da schion auf der richtigen Spur.
@all: Mir hat jemand per E-Mail den Unterschied erklärt, danke:
In meiner Berechnung gehe ich von n = 89 Frauen in der Gruppe der Falsch-Positiven aus, während es (rein rechnerisch) 89,1 sind.
Ob man für praktische Zwecke von 89 oder 89,1 Frauen ausgeht, wird schon sehr philosophisch. Ich bleibe für meinen Teil bei meinem Rechenweg. Gigerenzer berechnete das übrigens auch mit ganzen Zahlen.
Ich habe 43 Jahre Pflegeberuf auf dem Buckel. Ich gehöre zu den wenigen Fachkräften, die zwei Berufsausbildungen haben, ich bin sowohl Kranken- als auch Altenpfleger und habe etliche zusätzliche Qualifikationen erworben.
Das sind zwei völlig verschiedene Berufe, die zwar Schnittmengen haben, aber vom Ansatz her unterschiedlich sind.
In der Krankenpflege wird man, sehr verkürzt gesagt, als Helfer des Arztes ausgebildet, die Grundlage ist dort, genau wie bei Medizinern, das biomedizinische Modell, das besagt, grob gesprochen, das Gesundheit frei sein von Krankheit bedeutet. Die Gesundheit steht im Vordergrund, das Heilen von Krankheiten, Prävention ist immer noch ein Stiefkind; nach langen Berufsjahren habe ich den Eindruck gewonnen, das Prävention eher ein Kind der Kostendämpfung ist, als ein Kind der Krankheitsverhinderung. Der Mediziner beschäftigt sich mit dem Menschen, wenn er krank ist, die Krankenpflege entsprechend.
Die Altenpflege hat einen vollkommen anderen Ansatz, dieser ist ganzheitlich und legt die Einheit von Körper, Geist und Seele zu Grunde, im Fokus steht die Lebensqualität, also nicht die Lebensdauer. Es geht nicht darum Krankheiten zu heilen, außer natürlich bei heilbaren Akutzuständen, sondern wie trotz vorhandener chronischer Defizite ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität erzielt wird! Grob gesagt ist die Krankenpflege und mit ihr die Schulmedizin Defizitorientiert, die Altenpflege Ressourcenorientiert.
In der Krankenpflege werden die Anweisungen des Arztes umgesetzt und bilden die Richtschnur, in der Altenpflege wird die Pflege geplant im Hinblick auf die Förderung der Ressourcen des Menschen, zwar unter Berücksichtigung der Defizite, aber mit dem Ziel möglichst viel Lebensqualität möglichst lange zu erhalten.
Das hat die Schulmedizin, ausser z.T. im palliativen Bereich vom Grundsätzlichen her nicht zu bieten!!
Kurzer Exkurs:
Die erfolgte Generalisierung des Pflegeberufes geschah gegen den Rat der Experten und beide Berufsgruppen lehnten dies ab. Die Politik wusste es wie immer besser, da sie sich eine Erhöhung der Fachkraftquote versprach, die natürlich nicht eintrat und nach mittlerweile 5 Jahren haben wir mit den Pflegefachfrauen und -männern eine Berufsgruppe, die zur Hälfte das eine und zur Hälfte das andere sind. Dabei war das Problem natürlich auch hausgemacht, denn im Zuge der „Reform“ der Pflegeausbildung 2006, wurde die Einstellung von Pflegeschülern den Trägern überantwortet und den Schulen weg genommen. Die Träger stellten natürlich nur nach ihrem Bedarf ein und in NRW bspw. schlossen die Hälfte aller Schulen die Pforten. Als das Geschrei dann groß wurde, versprach man sich von der Generalisierung Abhilfe und erreichte lediglich, das die fachliche Qualität in beiden Berufen an Niveau verlor.
Natürlich ist unser überteuertes und trotzdem mangelhaftes Gesundheitssystem als Maschine zum Gelddrucken umgebaut worden, die jüngste Krankenhaus“reform“ ist ja das beste Beispiel.
Mein Onkel ist Internist und führte eine Praxis. Er zeigte mir mal einen Katalog, den die Pharmaindustrie für praktische Ärzte und nur für diese auflegte und verschickte. Darin war aufgelistet, welche Zuwendungen winkten, wenn bestimmte Tätigkeiten für Bigpharma durchgeführt würden. Nicht nur Reisen gab es da, sondern auch z.B. Boote bis hin zu Ferienhäusern wurden dort angeboten.
Während meiner Zeit im Krankenhaus habe ich selbst erlebt, wie Doppelblindversuche mit neuen Medikamenten an Patienten durchgeführt wurden, ohne Wissen der Patienten oder Angehörigen.
Dann gibt es den Trick mit der Veränderung von Grenzwerten, die gesenkt werden, damit Erkrankungen, die vorher keine waren, plötzlich welche sind und damit eine Indikation für zu verordnende Medikamente sind, z.B. bei Lipidsenkern, in dem man den Grenzwert für Cholesterin herabsetzt.
Also, die Schulmedizin will und soll Krankheiten heilen, wenn also veränderte Grenzwerte plötzlich Krankheiten erschaffen, die keine waren, wird Geld gedruckt, für den Herrn Doktor, der neue Präparate vom Pharmavertreter verschreibt und dafür natürlich die eine oder andere Zuwendung erwarten darf.
Warum wohl werden nirgendwo in Europa soviele künstliche Hüften und Kniegelenke eingesetzt wie in Deutschland? Wenn ihr ein gewisses Alter habt, liebe Mitforenten und Schmerzen im Knie habt, könnt ihr eher damit rechnen, das man Euch ein neues Gelenk reinnageln will, als Euch Physiotherapie verordnet wird.
Vorsichtig! Viele Hausärzte sind mit Fachärzten und Krankenhäusern vernetzt und kriegen unter der Hand Prämien!
Weiß ich von meinem Onkel!
Ergänzend dazu sollte man wissen, das die Pharmaindustrie in den letzten 25 Jahren drei neue Wirkstoffe entwickelt hat, die anderen „neuen“ Präparate sind Kombipräparate aus längst entwickelten Wirkstoffen. Soviel zum Gejammer der Pharmaindustrie über die hohen Kosten für Forschung und Entwicklung.
Es geht noch weiter!
Jedes Jahr sterben in Deutschland an nosokomialen Infektionen, also an Infektionen die in medizinischen Einrichtungen zugezogen werden, gerade auch Krankenhäusern, über 10.000 Menschen. Die Ursache sind multiresistente Keime, die auf Antibiotika nicht ansprechen, auch auf die Reserveantibiotika nicht mehr, die normale Ärzte nicht verschreiben können.
MRSA ( Multiresistenter Staphylokkus Aureus ) ist der bekannteste, werden viele von Euch kennen. Die Ursachen liegen zum einen in der industriellen Landwirtschaft, wodurch Antibiotika in die Nahrungskette gelangen, aber auch an den Hausärzten, die bei ansonsten gesunden Menschen schon bei Erkältungen Antibiotika verschreiben, die da gar nicht wirken können, da die Erreger Viren sind. Die Verschreibung ist allenfalls gerechtfertigt, wenn der Patient chronisch krank ist, z.B. COPD hat, um eine bakterielle Superinfektion zu
verhindern.
Nun ist es ja nicht so, das es nicht möglich wäre, da etwas gegen zu unternehmen.
In punkto Landwirtschaft wisst ihr alle, was da zu tun wäre. Ich will auf etwas anderes hinaus.
Die Pharmaindustrie könnte natürlich neue, wirksame Antibiotika entwickeln, technisch kein Problem, Entwicklung und Forschung dauern ungefähr zehn Jahre.
MRSA könnte also längst aus der Welt sein. Die machen das nicht, weil es sich kommerziell nicht lohnt! Antibiotika gibt man i.a.R. nur 14 Tage, da kann man nur wenig von absetzen.
Bei Lipidsenkern oder Antihypertensiva gegen hohen Blutdruck kann man riesige Mengen absetzen, da diese dauerhaft gegeben werden, täglich!
Daher die Schaffung immer „neuer“ Medikamente in diesem Bereich.
Ich könnte hier noch viele andere Beispiele bringen, Analgetika, gerade Opioide und Psychopharmaka sind auch solche Bereiche!
Ich vertraue zunächst grundsätzlich keinem Arzt, schon lange nicht mehr.
Ich habe aber den Vorteil, kein medizinischer Laie zu sein. Ich drücke mich beim Arzt grundsätzlich fachsprachlich aus, sodass die sofort vorsichtig sind und mir kein X für ein U vormachen. Ich habe einen guten Arzt, korrekt und ehrlich, wo ich auch schon mal trotz Termin länger warten muss. Das ist aber i.a.R. ein gutes Zeichen, zeigt es doch, das er sich Zeit für die Patienten nimmt. Ich brauchte aber über zwei Jahre, bis ich den gefunden hatte.
Der Artikel ist nicht schlecht!
Er rundet mein Bild, obwohl ich Verständnisprobleme habe, da ich so gut wie nichts von Empirik verstehe.
Wenn dem einen oder anderen hier mein Post ein bisschen was nützt, würde ich mich freuen. Dann war das lange Tippen nicht umsonst!
Ich habe den Beitrag mit Interesse gelesen, danke.
Deine Kommentare sind stets lesenswert. Danke.
Danke, ja , sehe ich genauso.
Was Versuche an Patienten angeht: In psychiatrischen Anstalten wahrscheinlich an der Tagesordnung….
Was Sie abwertend als Schulmedizin bezeichnen, ist nicht vollkommen. Prof. Antes hat sich große Verdienste erworben, die evidenzbasierte Medizin, so sollte man es respektvollerweise nennen, in Deutschland auf den Weg zu bringen. Dazu gehören auch doppelt blinde Tests, die jedoch häufig nicht richtig konzipiert werden, absichtlich oder wegen mangelnden Kenntnissen. Der Umgang mit der Pandemie hat allerdings bewirkt, dass sein Lebenswerk einen schweren Rückschlag erlitten hat.
Ihre Bemerkung „Ich vertraue zunächst grundsätzlich keinem Arzt, schon lange nicht mehr.“ zeugt davon. Es geht hier auch nicht um reine Empirie, sondern um den korrekten Umgang mit Statistik. Prof. Gigerenzer sprach in diesem Zusammenhang auch von Innumeraten*. Als selbständig denkender Mensch sollte man besser nach dem Motto „Glaub keiner Statistik, die du nicht verstanden hast“ handeln.
* Zahlenanalphabetismus (engl. innumeracy) bezeichnet rechnerisches Unvermögen und somit die Schwäche, Sachverhalte in Zahlen oder Wahrscheinlichkeiten darzustellen, beziehungsweise zahlenmäßig dargestellte Sachverhalte zu verstehen. Manchmal werden Personen, die Zahlenanalphabeten sind, als Innumeraten bezeichnet.
Dank für Ihren Kommentar!
Mein Arzt macht keine Corona-Impfungen, andere schon, er ist kein genereller Impfgegner!
Wenn man ihn auf die Coronapolitik oder das Gesundheitssystem anspricht, kann er ausfällig werden!
Obwohl ich 66 Jahre alt bin, habe ich bei ihm noch neue Schimpfworte gelernt!
ab 2026 haben Ärzte Impfquoten zu erfüllen die im Lauf des Jahres gesteigert werden, sonst haben sie wirtschaftliche Einbußen.
https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/impfquote-und-praemien-wie-in-der-ddr-berliner-aerztin-warnt-vor-kollaps-ider-versorgung-li.10015220
mWn werden die ganzen Impfungen wo es möglich ist auf modRNA umgestellt.
Der Ausdruck „Schulmedizin“ empfinde ich nicht als abwertend und meine ich auch nicht so, nur als Bezeichnung, im Gegensatz zu z.B. alternativer Medizin, also nicht wertend.
Danke für die Zusammenfassung, ich sehe das genauso.
Ich hatte vor einiger Zeit das zweifelhafte Vergnügen nach einem iatrogenen (nur beim Arzt!) Bluthochdruck (es war die Erst-Untersuchung bei einer neuen sehr harsch auftretenden Ärztin) eine 24 Stunden-Blutdruckmessung gemacht zu haben, seitdem frage ich mich, wie viele Patienten auf Bluthochdruck behandelt werden, die gar keinen haben. Ein Gerät, dass jede Viertelstunde pumpt und einen nicht schlafen lässt, erzeugt doch hohen Blutdruck, mal abgesehen davon dass ich fast allergisch auf ein Gerät reagiert habe, von dem ich wusste, dass es schon zig schwitzende Menschen am Körper getragen haben haben, bevor es an meinen Köoper angebracht wurde.
Natürlich kam der Alarmanruf der Kardiologin, die vorher mein sehr gesundes Herz festgestellt hatte.
Meine eigenen Messungen ergeben einen normalen Blutdruck zwischen 120 und 140 herum und meine Lebensweise und Ernährung lassen auch nichts anderes erwarten.
Also, wieder Ärztin(Naturheilkunde) gewechselt und nun immer Hinweis, dass nach dieser Erfahrung bei mir in der Arztpraxis Blutdruck zu messen, nur Frust erzeugt.
Es gibt die sogenannte Praxis- oder Weißkittelhypertonie, das ist ein feststehender Begriff.
Dieser besagt, das der Patient, wissend, das die Blutdruckkontrolle bevor steht, durch schon leichte Aufregung erhöhte Werte zeigt.
Hinzu kommt, das der Blutdruck im Sitzen und nach 15minütiger Ruhe gemessen werden muss und dies am linken Arm.
Wenn man täglich kontrolliert, dann immer genauso und zur selben Uhrzeit.
Allerdings ist der diastolische Wert, also der untere, der wichtigere, da er die Entspannung des arteriellen Systems ausdrückt, Arterien sind nämlich Muskelschläuche, die kontrahieren können. Der Wert sollte möglichst die 90 nicht überschreiten!
Ihren Post glaube ich Ihnen unbesehen sofort!
Ja, danke, Wallenstein, ich weiß das, das war mir nur gerade etwas zuviel Detail.
Das Wegsparen von Pflegeleistungen ist das eigentliche Drama.
Die Trennung von Altenpflege und Krankenpflege in der AUSBILDUNG dagegen ist nicht unbedingt notwendig.
Im Zivildienst gab es für unsereins bereits die zwei Tätigkeiten:
1) Operationsvorbereitung, Patientenverlegung, Urin-Controlle und kleinere Heilanwendungen wie Rotlichtbestrahlungen.
2) sonstige Pflege wie Gespräche, Dekubitusvorbeuge, Spaziergang im Gang (manchmal im Park).
der alte Mensch braucht jedenfalls eher 2).
Unsere Ausbildung war on the Job. Meine Paienten waren gotseidank robust.
Das ist ja das, was Ganzheitlichkeit ausmacht! Die Psyche und seelische Befindlichkeit hat nicht den Stellenwert, den sie verdient!
Placebos müssen vom Arzt verordnet werden, da diese tatsächlich wirken.
Die allermeisten Wirkstoffe stellt der Körper selbst her. Gibt man ein Medikament ohne Wirkstoff und der Patient glaubt daran, dann wird meist auch eine Wirkung stattfinden!
Habe ich oft erlebt!
Ein unterschätztes Feld!
Placebos kann man aber nicht patentieren. Ganz schlecht!
Danke für die Ausführungen
Einer der plausibelsten und besten Kommentare, die ich in letzter Zeit zu diesem Thema gelesen habe. Danke.
Hypertonie wäre ein eigenes Thema, über das ich schon gründlich recherchiert habe. Früher hieß es 100 plus Lebensalter als systolischer Grenzwert. In dem Bestseller „Bittere Pillen“ (von weltweit renommierten Fachärzten unterstützt) von 1985 wird der Blutdruckgrenzwert auf 165 zu 90 festgelegt. Heute haben wir die US-Sprintstudie mit 120/80 und in der Pharmaindustrie flogen die Sektkorken. 100/70 wird bereits diskutiert. Demnächst ider jeder Mensch auf der Welt Hypertoniker.
Ich habe langsam die Huetchenspielertricks der Politik satt. Wie z.B solche Artikel hier. Jedem vernuenftig denkenden Menschen muesste doch eigentlich klar sein, dass eine false positive Rate von 9% bedeutet, dass sich der Artzt sicher sein kann, dass bei einem positiven Ergebnis demnach mit 91% iger Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnis bei diesem getesteten Patienten richtig ist. Der Fluss ist durchscnittlich nen halben Meter tief, trotzdem ist die Kuh ersoffen 😉
„Jedem vernuenftig denkenden Menschen muesste doch eigentlich klar sein, dass eine false positive Rate von 9% bedeutet, …“
Bitte lesen Sie auch sich noch Mal den Kommentar von Herrn Schleim von heute 08:46 Uhr durch.
Sie testen 1000 Menschen und bekommen ca. 100 positive Ergebnisse, von denen aber nur 9 Menschen erkrankt sind (einer fällt sogar durchs Raster, weil der nicht erkannt wird).
Das besprochene Problem ist ja zu sagen, wie viele der gefundenen Fälle wirklich erkrankt sind. Oder, muss man die Flinte sofort ins Korn werfen, wenn man einen positiven Befund bekommt?
Das ist in meinem Augen im Artikel gut hergeleitet (den Kommentar fand ich sogar noch klarer)
Im Prinzip fehlt mir nur der Hinweis am Ende: Positiver Befund heißt, keine Panik, weitere Untersuchungen sind notwendig.
Ob die Ersttests aus Gründen der Ökonomie notwendig sind, ist eine andere Frage.
Chlorkalk und Pferdeentwurmer heilt jede Krankheit.
Du,
meinst bestimmt flüssige „Chlorbleiche“ so wie eine mRNA Impfung gleichzeitig gegen Dummheit ist!
Gelle
Ich verstehe die ganze Diskussion hier nicht!
Eine Mammographie erkennt einen größeren Tumor, aber auch schon einen noch „verkapselten Tumor“. Darauf folgt die Biopsie, die die Diagnose sichert, darauf die Behandlung. Gut das es die Mammographie gibt, sie hat Leben gerettet.
Bei euch Männern ist der PSA-Test ungenauer, führt aber ebenso zur Biospie. Dann erfolgt die Entscheidung ob und wie behandelt wird. Männer neigen aber zum therapeutischen Nihilismus und gehen nicht zur Vorsorge aus Angst, der Urologe könne etwas finden.
Eine Behandlung von Prostata-CA führt oft zu Inkontinenz und einer erektilen Dysfunktion. Das aber fürchten die Männer, denn ein Mann ist nur ein Mann……
Wie viele Biopsien müssen gemacht werden, um die falsch-positiven Ergebnisse der Mammographie auszugleichen? Wie viel unnötiges Leid wird dadurch verursacht?
Das spricht jetzt nicht per se gegen Mammographie. Aber wenn die Prävalenz so niedrig ist, spricht es dagegen, jede Frau unabhängig vom Alter und den genetischen Voraussetzungen zu testen. Es ist genau diese Erkenntnis, die dazu führte, dass das Verfahren nicht mehr wahllos eingesetzt wird.
„In Deutschland haben Frauen alle zwei Jahre ab dem 50. bis zum 70. Lebensjahr Anspruch auf Leistungen zur Früherkennung von Brustkrebserkrankungen, was auch eine Mammographie umfasst.“
„Ich verstehe die ganze Diskussion hier nicht!“
Das wundert mich überhaupt nicht.
„Gut das es die Mammographie gibt, sie hat Leben gerettet.“
Genau das ist jedoch nicht allgemein gültig.
Denn statistische senkt Mammographie nicht die Mortalität!
Oder anders formuliert Frauen die nicht zu Mammagraphie gehen haben kein höheres Sterberisiko, als Frauen die Mammographie machen lassen.
Die medizischnen Studien dazu lassen sich leicht im Netz finden.
Und nochwas sage ich euch als DDR-Frau:
Tamara Danz, Leadsängerin bei Silly, ist mit 43 an Brustkrebs verstorben.
Irmtraud Morgner, DDR-Frauenrechtlerin, starb mit 68 kurz nach der Wende an Brustkrebs.
Vielleicht wären sie gerettet worden, hätte es die Vorsorge/Mammographie schon gegeben?
Genau. Aber leider wären dann auch 20 gesunde Frauen völlig unnötig behandelt worden …
Das ist ein Beispiel dafür, wie mit eigentlich gut gemeinten Vorsorgeuntersuchungen ein gewaltiger Schaden durch die falsch-positiven Befunde angerichtet wird.
Und mit bösen Absichten kann man sogar eine reine „Test-Pandemie“ erzeugen, wie bei Corona. Nur durch Tests. Dazu braucht man gar keine Krankheit …
„Aber leider wären dann auch 20 gesunde Frauen völlig unnötig behandelt worden …“
Klar, dass so ein ignoranter Spruch kommen musste. Sie sollten sich bei Herrn Lauterbach als Pressereferent bewerben – oder, alternativ bei Herrn Schleim.
Es sollen also 2 junge Frauen sterben, damit 20 andere die minimalen Unannehmlichkeiten einer Biopsie nicht ertragen müssen?
Wissen Sie lassen Sie uns Frauen doch einfach selbst entscheiden ob wir die Vorsorge in Anspruch nehmen wollen oder nicht und unterlassen Sie bitte unangebrachte Belehrungen….das ist doch typisch deutsch, dumm herumquatschen ohne Ahnung zu haben und andere etwas aufzwingen wollen, wie es vorzugsweise gerne die Grünen tun.
Der Artikel war auch etwas seltsam, kein Wunder, war von einen Mann geschrieben, der von Brustkrebs keine Ahnung hat, er hat ne Prostata und damit genug zu tun…
Habe ich irgendwo geschrieben, dass Sie nicht zur Vorsorge gehen dürfen? Sie müssen sich halt bewusst sein, das ein positiver Test mit etwa 90% Wahrscheinlichkeit falsch ist.
Sie können wohl Ihren eigenen Text nicht lesen:
„Das ist ein Beispiel dafür, wie mit eigentlich gut gemeinten Vorsorgeuntersuchungen ein gewaltiger Schaden durch die falsch-positiven Befunde angerichtet wird.“
H.L.=Hans Lauterbach
Da Sie erst kürzlich die 81-jährige Frau Weber-Herfort als alte weiße Frau abqualifizierten und Frau Morgner, 68-Jährig, bei ihnen als jung gilt, muß der Übergang von jung zu alt also irgendwie dazwischen liegen.
Oder ist man in Ostdeutschland länger jung als in Westdeutschland?
irgendwas fällt immer ein, um den Osten zu diffamieren: Dreckschleuder!
Wenn Sie sich den Schuh anziehen wollen, ihr Problem.
Aber Naomi diffamiert gerne diverse Gruppen, darunter auch Wessis.
Können Sie gerne in ihren Postings nachlesen.
Aber das wollen Sie ja sicher gar nicht.
Lieber Ossi-mimimi.
@Routard, was faellt mir, als Ossi*hust*, zu ihrem Post ein? „Teile und herrsche“ Und Sie bestaeteigen mit Ihrem Post, dass dies wahrscheinlich immer funktioniert. Ich moechte Menschen wie Ihnen da nicht mal einen Vorwurf machen, weil ich davon ausgehe, dass jeder Mensch das tut, was er persoenlich als brauchbar erachtet.
Wie die Wessis alles politisch in den Dreck ziehen ist typisch!
Ich habe lediglich darauf hingewiesen, das zwei bekannte Künstlerinnen aus der DDR viel zu früh an Brustkrebs verstorben sind und sie möglicherweise durch die Vorsorge hätten gerettet werden können. Daraufhin haben die Wessis hier gleich mit dummen Spott reagiert, weil sie die beiden Künslerinnen, mit denen wir aufgewachsen sind, überhaupt nicht kannten. Das war Tamara Danz, für die Ossis zur Eri, für die Wessis um eine Bildungslücke zu schließen eines der Lieblingslieder meiner Jugend, die „Verlorenen Kinder“
https://www.youtube.com/watch?v=gMGGKHzUemA
Erstens bin ich nicht die Wessis (Danke für die erste Bestätigung meiner Aussagen).
Zweitens ist mir Frau Danz durchaus bekannt (Danke für die zweite Bestätigung meiner Aussagen).
Drittens habe ich keinerlei politische Aussage getroffen.
Die routinemäßige Durchführung der Mammographie hat die Sterblichkeit bei Brustkrebs in keiner Weise gesenkt. Der Unterschied ist, daß man es unter Umständen eben ein halbes Jahr früher weiß. Auf das „Outcome“ wirkt sich das nicht aus.
Krebs ist auf dem Vormarsch wegen blinder, übermäßiger Abgabe von Antibiotika, denn der Mensch muß ja möglichst schnell wieder im Büro sitzen, wenn er krank wird. Blinder Standard Reihenimpfungen, ohne mal zu überlegen welcher Mensch in welchem Lebensalter gegen welche Krankheit geimpft werden soll, schlechter Ernährung, schlechter Schlaf und die Nummer 1: permanente Belastungen und Streß. Gerade bei Frauen mit ihrer ständigen 3fach Belastung (was als „Vereinbarkeit“ von Familie und Beruf verkauft wird). In Wirklichkeit ist das ein abartiges Gerenne zwischen Arbeitsstelle, Kinderkrippe und Supermarkt.
Da entarten manchmal die Zellen, denn das Immunsystem wird seiner Fähigkeit beraubt Tumorzellen „wegzuräumen“ wenn es ständig übersteuert wird. Normalerweise kann der menschliche Körper das nämlich ganz alleine.
Aber anstatt mal die Lebensbedingungen grundsätzlich zu hinterfragen und vielleicht mal Reformen anzuregen werden dann „Vorsorgeuntersuchungen“ angeboten. Wenn man Pech hat wird dann bei der Mammographie Gewebe geschädigt oder bei der Darmspiegelung was perforiert. Gut für gewisse „Kreise“ denn dann werden wieder Folgetherapien notwendig.
Danke für diese wichtige Ergänzung.
Ich hätte in meinem Artikel vielleicht noch deutlicher den Unterschied zwischen anlasslosen Vorsorgeuntersuchungen und medizinischer Diagnostik beim Vorliegen eines Problems herausstellen können.
@Stephan Schleim
Man wird übrigens in der Broschüre, die man als Frau mit der „Einladung“ zur Mammographie erhält ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Untersuchung keine Auswirkung auf das hat, was nach einer evtl Diagnose kommt, sprich den Behandlungserfolg oder Nichterfolg.
Lassen Sie doch einfach die Frauen selbst entscheiden ob sie die Vorsorge in Anspruch nehmen oder nicht. Wo ist das Problem?
Entschuldigung, aber ein Einwand kann ja als Entscheidungshilfe dienen, oder? Wer weiß denn, dass solche Tests oft erst das produzieren, was sie angeblich frühzeitig erkennen sollen? Da ist es doch gut, dass man nicht in Panik verfällt. Stellen Sie sich, mal vor, bei einer Einstellung würde vorausgesetzt, dass ein Mensch nicht HIV-positiv ist, und er müsste, ohne dass überhaupt in irgendeiner Weise die Gefahr, diesen Virus eingefangen zu haben, besteht, zwangsweise den Test durchführen lassen. Heißt es dann auch, er kann ja den Test ablehnen? Nein. Denn dann würde er automatisch die Stelle nicht bekommen. Und das wäre dann Diskriminierung! Desgleichen im Übrigen bei Nichtschwangerschaft als Grundvoraussetzung für einen Job. Oder eben keinen Brustkrebs. Weil der arbeitgeber ja ein Interesse daran hat, die Arbeitskraft vollständig auszubeuten. Und der Einwand, dass das rechtlich verboten ist, ist nebensächlich, weil Recht haben und Recht bekommen zweierlei Dinge sind.
@Naomi
Natürlich sollen Frauen das selbst entscheiden. Ich habe ja nicht gesagt: Frauen, lasst es bleiben. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß Vorsorgeuntersuchungen nicht so eine große Rollen spielen wie gemeinhin angenommen.
An Bushaltestellen sehe ich oft Plakate die implizieren daß man zb sehr sicher vor Darmkrebs ist, wenn man nur regelmäßig zur Darmspiegelung geht. Das sehe ich halt anders.
ich würde ohne Voruntersuchung schon nicht mehr leben – daher sehe ich das wohl ganz anders…
Weitere interessante Artikel zu dem Thema:
https://www.infosperber.ch/gesundheit/krebs-screening-eine-schlechte-versorgung-ist-sehr-haeufig/
https://www.infosperber.ch/gesundheit/viele-juengere-krebsopfer-sind-wohl-eher-diagnose-opfer/
und zur Zunahme von Diagnosen allgemein:
https://www.infosperber.ch/gesundheit/jedem-seine-diagnose-ein-irrweg-der-medizin/
Im Übrigen halte ich das hemmungslose Herumstochern (Biopsie) in potenziellen Tumoren für eine durchaus überdenkenswürdige Angelegenheit.
Ein‘ hab‘ ich noch: Wir basteln uns eine PANDEMIE.
Bei einer Falsch-Positiv-Rate von 1% machen wir einen Schwangerschaftstest bei 1000 Männern.
Wegen der Falsch-Positiv-Rate sind von diesen 1000 Männern exakt 10 schwanger. Sagen wir mal „unsymptomatisch schwanger“, das klingt wissenschaftlicher.
Auf 10,000 Männer hochgerechnet hätten wir also 100 „unsymptomatisch schwangere“ Männer – also eine Inzidenz von 100, wie man vor einigen Jahren gesagt hätte!
LOCKDOWN! SOFORT!
Es müssen nur die Medien und die Ärzte mitspielen. Das kriegen wir mit den entsprechenden Anreizen schon hin …
Alternativlos! Modellrechnungen haben nämlich bewiesen, dass andernfalls spätestens in 9 Monaten eine Bevölkerungsexplosion mit KATASTROPHALEN Folgen stattfände! Wer das leugnet, hat die Exponentialfunktion nicht verstanden!
Symptomlos erschwangerte Männer. Das ist ja ganz „neuartig.“
War das Thema Prävalenz und flasch-positiv-Rate nicht gerade noch eine Verschwörungstheorie von Corona-Leugnern?
Allerdings hatte das, glaube ich, sogar Spahn in einem lichten Augenblick kapiert.
Einleuchtend wird es, wenn man das mit einem Schwangerschaftstest durchdenkt, bei dem Männer getest werden:
Angenommen, der Test hat eine Falsch-Positiv-Rate (FPR) von 2%, eine Sensitivität, Richtig-Positiv-Rate, (mal angenommen) von 100% und kein Mann kann schwanger werden (was man heute ja nie so genau weiss), dann ist der
Falsch-Positiv-Anteil (nicht die FPR, die liegt am Test und bleibt soweit gleich):
100%
Würde ein Mann von 100 schwanger werden können (Prävalenz P=0.01):
66.4%
Bei zwei Männern von 100 (P=0.02=):
49.5%
usw..
bei P=0.10, also 10 Männern, läge der Anteil der Falsch-Positiven Tests bei:
15.3%
Nun gut, in der heutigen Zeit darf man wohl kaum noch behaupten, dass „biologische“ Männer nicht schwanger werden. Doch meines Erachtens gibt es noch keine Schwangerschaft bei Menschen ohne Eierstöcke und Placenta. Ganz zu schweigen, wie soll das Kind dann geboren werden? Indem man den Mann aufschneidet? Wenn also irgendein Schwangerschaftstest positiv anzeigt, obwohl real keine Chance besteht, dass dieser positiv sein kann, dann ist der Schwangeschaftstest absolut ungeeignet. Ich stelle mir die Komplikationen vor, wenn eine Frau angeblich schwanger ist, und der Mann unfruchtbar ist. Die Diskussionen kann ich mir bildhaft vorstellen. So ein falsches Ergebnis kann Beziehungen endgültig zerstören.
Neben der Mammografie gibt es ja auch noch die direkte Untersuchung auf Knoten. Oder sehe ich das falsch? Dann kann man ja diese hohe Fehlerwahrscheinlichkeit eingrenzen. Das Gleiche gilt ja auch für andere Untersuchungen. Eines sollte man jedoch bei all der Panikmache bedenken. Oft ist schon das Ergebnis durch die Panikmache produziert.
Eine Episode: Ein Mann steht am Tor einer Stadt. Kommt der Tod vorbei. „Was machst Du hier?“ fragt ihn der Mann. „Ich soll 100 Menschen abholen. Sie werden sterben.“ Der Mann wird panisch, rennt in die Stadt und schreit: „Der Tod steht vor dem Tor.“ Die Menschen werden panisch, 2000 Menschen sterben. Teilweise aus Angst, teilweise, weil sie schlichtweg überrannt werden, in dem Chaos. Der Mann steht wieder am Tor, kommt der Tod raus. „Wieso nimmst Du 2000 Menschen weg? Du wolltest doch nur 100 mitnehmen.“ „Nun ja. Ich wollte ja nur die 100 holen. Du aber hast 1900 auf dem Gewissen mit Deiner Panikmache.“
Sicher keine reale Episode. Aber so in etwa findet das jeden Tag auf der Erde statt.
Ein Beispiel aus der Praxis hat Gerd Gigerenzer in seinem Buch „Risiko“ beschrieben:
„Drehen wir die Uhr zurück auf den Dezember 2001. Stellen Sie sich vor, Sie leben in New York und möchten nach Washington, D. C., reisen. Würden Sie fliegen oder mit dem Auto fahren?
Wir wissen, dass viele Amerikaner nach dem Anschlag nicht mehr flogen. Blieben sie zu Hause oder stiegen sie ins Auto? Um eine Antwort zu finden, habe ich mir die Beförderungsstatistik angesehen. In den Monaten nach dem Anschlag nahmen die im Auto zurückgelegten Kilometer beträchtlich zu. Besonders deutlich war die Zunahme bei den ländlichen Interstate Highways, auf denen der Fernverkehr rollt: bis zu fünf Prozent in den drei Monaten nach dem Anschlag. Zum Vergleich: In den Monaten vor dem Anschlag (Januar bis August) waren die Zahlen für die individuellen Autokilometer pro Monat gegenüber 2000 nur um knapp ein Prozent angestiegen, was der üblichen jährlichen Zunahme entspricht. Diese zusätzliche Autonutzung hielt zwölf Monate an und ging dann wieder auf ihr Normalmaß zurück. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer in den Zwillingstürmen aus der täglichen Medienberichterstattung verschwunden.
Die Zunahme des Straßenverkehrs hatte ernüchternde Konsequenzen. Vor dem Anschlag entsprach die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle weitgehend dem Durchschnitt der vorausgegangenen fünf Jahre. Doch in jedem der zwölf Monate nach dem 11. September lag die Zahl der tödlichen Unfälle über dem Durchschnitt und meist sogar noch höher als alle Werte aus den vorangegangenen fünf Jahren. Alles in allem sind etwa 1600 Amerikaner infolge ihrer Entscheidung, die Risiken des Fliegens zu vermeiden, auf der Straße umgekommen.
Diese Todesrate ist sechsmal so hoch wie die Gesamtzahl der Passagiere (256), die bei den vier Todesflügen starben.“
Erstaunlich wie sehr die Propaganda des medizinindustriellen-pharmazeutischen Komplexes in den Kopfen veranktert ist.
So sehr, dass einige die nüchternen – aber absolut korrekten – Zahlen von Herr Schleim als Bedrohung empfinden oder sogar die große Verschwörung wittern. Keine Wunder, dass Covid-19 so ein großer finazieller Erfolg war. Mit Angst bekommt man die meisten. Und mit Neid.
Die meisten glaub auch immer noch, dass Privatpatienten pauschal immer die bessere Behandlung genießen. Weit gefehlt, weil bei vielen Ärzten rauschen als aller erstes mal die Dollarzeichen durch den Kopf und nicht der hippokratische Eid, wenn ein Privatpatient die Praxis betritt. Als Folge: Überdiagnostik und Übertherapie.
Allgemein kann man jeden auch im Bereich der eigenen Gesundheit nur raten Kant zu befolgen: Kommt heraus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Hört auf die Götter in Weiß anzuhimmeln, informiert euch selbst, hört auf euch selbst.
Und ignoriert Ärzte die versuchen mit Angst zu manipulieren.
Meine Antwort auf deinen guten Kommentar landeten fälschlicherweise hier:
https://overton-magazin.de/top-story/medizinisches-wissen-was-sagt-ein-positives-testergebnis-aus/#comment-347865
Oh man, oh Mann, hier herrscht bei einigen ein nahezu metaphysisches Unwissen!
Eine Mammographie ist ein bildgebendes Verfahren und kein Test. Sieht man hier etwas, dann wird dies mit einer Biopsie abgeklärt. Danach wird entschieden, ob und wie behandelt wird. Die meisten Frauen entscheiden sich dann für eine Behandlung. Wenn man wartet bis man selbst einen Knoten tasten kann ist es meist zu spät.
Was würden die hier versammelten Männer tun, wenn nach mehren PSA-Test hoher Werte festgestellt sind und danach eine Prostatakrebs sicher diagnostiziert ist. Würde ihr euch, wenn ihr Mitte 60 seit, euch behandeln lassen oder einfach abwarten was passiert?
Statistik hin oder her, die meisten wollen leben!
Danke für Ihren Hinweis – aber Sie können sich gerne die epidemiologischen Daten in Gigerenzers Arbeit oder die im neuen ersten Absatz des Artikels verlinkte Studie in JAMA Internal Medicine anschauen: Bei den Mammografien ist der Mehrwert der Früherkennung im Mittelwert genau null – und trotz der immer häufiger und immer früher erkannten Tumore bleibt die Mortalität in etwa gleich.
Im Endeffekt geht es immer um eine Einzelfallabwägung. Da können einen die hier diskutierten Forschungsergebnisse doch zumindest vorläufig beruhigen, bis man, wenn man sich dafür entscheidet, genauere Untersuchungsergebnisse hat.
„… wenn nach mehren PSA-Test hoher Werte festgestellt sind und danach eine Prostatakrebs sicher diagnostiziert ist. Würde ihr euch, wenn ihr Mitte 60 seit, euch behandeln lassen oder einfach abwarten was passiert?“
Also erst einmal fiel mir auf, dass ich bei einer deutschen Suche nach „PSA test spezifizität“ gar kein brauchbares Ergebnis fand. Das ist doch schon sehr merkwürdig. Auf englisch kam immerhin: Spezifizität von 9 bis 33 Prozent und eine Falsch-positiv-Rate von bis zu 91%. Wunderbar!
Eine abklärende Biopsie kann auch Schaden verursachen – in einem sehr intimen Bereich und mitunter mit schweren Folgen. Welche Entscheidung man trifft, hängt auch damit zusammen, wie viele Lebensjahre man noch erwartet. Und ob man sich vorstellen kann, mit den möglichen aber irreversiblen Folgen so einer Operation zu leben.
Untersuchungen richten immer Schaden an. Durch die Mammographie wird die Brust radioaktiver Strahlung ausgesetzt und das Stechen durch die Biopsie ist bei Frau und Mann nicht schön. Aber anders kann man Krebs nicht sicher diagnostizieren. Alles hat seine Preis, ist Frage der Abwägung.
Beim PSA-Test hängt es von Test ab, ab welchen Wert etwas nicht stimmt. Aber so bei 5 bis 8 über mehrere Test muß man eine Biospie überlegen. Radfahren, Sex und Harmwegsinfekt erhöhen den PSA-Wert, aber das weiß der Urologe. Bei älteren Herren käme auch das „watschfull waiting“ in Frage
@telepolisForumsExilant
Wer die florierenden Geschäftsmodelle „unseres“ schönen Gesundheitsmarktes mit Gesundheitsvorsorge oder gar Krankheitsverhütung verwechselt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Abhilfe könnte dieser, ausgerechnet „öffentlich-rechtlich produzierte“ Beitrag leisten, der offenlegt wie – nicht erst seit der letzten großen Pandemiesimulation – mit Angstmache und Statistiklügen gearbeitet wird.
Ganz besonders beim Prostatakrebs und seinen angeblich wichtigsten „Krebs-Früherkennungs-Indikator“, dem erhöhten PSA-Wert, bei den allermeisten über 60jährigen Männern.
Ungewöhnlich gut vorbereitete und engagierte Redaktion:
Krank durch Früherkennung
https://www.planet-wissen.de/video-krank-durch-frueherkennung-102.html