
Ein Essay über die abstrakte und emergente Machtstruktur unserer Zeit – und warum wir neue Begriffe brauchen, um sie zu erkennen.
Wer über Politik spricht, denkt meist an Parlamente, Gesetze, Parteien und Wahlen. Wir halten an der Vorstellung fest, dass Staaten die zentralen Akteure der Weltordnung sind, die Gesetze erlassen, Grenzen ziehen, Steuern erheben und Bürger schützen. Doch während diese sichtbare Ordnung weiter funktioniert, wächst im Hintergrund eine andere Machtstruktur heran, die sich in keine unserer gewohnten Kategorien einfügen lässt. Es ist eine Macht, die weder an geografische Grenzen gebunden noch demokratisch legitimiert ist. Eine Macht, die privatwirtschaftlich organisiert ist und zugleich staatliche Züge trägt. Eine Macht, für die uns bislang die Worte fehlten – die jedoch immer tiefer in unser Leben eingreift.
Die Begriffe Fiatstaat und Kontraktokratie versuchen, diesem Phänomen einen Namen zu geben. Sie mögen sperrig klingen, doch sie benennen etwas, das unser Verständnis von Politik und Demokratie grundlegend betrifft. Denn die entscheidende Frage lautet: Wer setzt heute eigentlich die Regeln fest, nach denen wir leben? Und wo werden diese Regeln verhandelt?
Der Staat, der keiner ist
Fiatstaaten entstehen nicht aus Territorien, Bevölkerungen oder klassischem Regierungshandeln. Sie sind geprägt von Strukturen, die ursprünglich aus der Welt der Unternehmen stammen. Ihre „Bevölkerung“ bilden keine Bürger im staatsrechtlichen Sinn, sondern Angestellte, Mitglieder oder Teilhaber. Ihre Hierarchien ähneln Konzernstrukturen: Vorstände, Aufsichtsräte oder interne Compliance-Abteilungen legen Regeln und Entscheidungswege fest, die einer Verfassung von Territorialstaaten ähneln.
Das „Territorium“ eines Fiatstaats besteht nicht aus Landesgrenzen, sondern aus der Reichweite seiner wirtschaftlichen Aktivitäten, Kapitalströme und Absatzmärkte. Ein Gebilde erreicht erst dann die Qualität eines Fiatstaats, wenn es über seine eigenen Belange hinaus Einfluss auf Staaten, Märkte oder Institutionen nimmt. Diese Macht zeigt sich darin, politische Prozesse zu steuern, gesetzliche Regelungen vorwegzunehmen oder Staaten durch Verträge und wirtschaftlichen Druck zu Disziplinarmaßnahmen zu zwingen. Damit überschreitet der Fiatstaat die Sphäre bloßer Unternehmensaktivität und wird zu einem Akteur eigener staatlicher Qualität – allerdings ohne die klassischen Merkmale eines Staatswesens wie Staatsvolk, Territorium oder Gewaltmonopol. Er operiert vor allem auf der Ebene von Verträgen und Rechtsfiktionen, deren Inhalte oft außerhalb des Zugriffs nationaler Parlamente liegen.
Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft oder BlackRock sind Beispiele solcher Fiatstaaten. Sie verkaufen nicht einfach Produkte. Sie haben sich in Räume vorgedrängt, die früher ausschließlich staatlichen Institutionen vorbehalten waren. Ihre Entscheidungen wirken oft unmittelbarer auf das Leben von Milliarden Menschen ein, als die Gesetzgebung eines nationalen Parlaments. Doch nicht nur große Technologiekonzerne oder Finanzriesen gehören in diese Kategorie. Auch supranationale Organisationen, bestimmte NGOs oder internationale Verbände können Elemente eines Fiatstaats aufweisen, wenn sie über Verträge, Sonderrechte oder symbolische Autorisierung Einfluss auf Staaten und Gesellschaften ausüben.
Die unsichtbare Architektur der Macht
Um die Entwicklung der Machtstrukturen zu begreifen, braucht es jedoch noch einen zweiten Begriff: Kontraktokratie. Er beschreibt eine Welt, in der Verträge immer häufiger Gesetze ersetzen. Diese Verträge bilden das Betriebssystem der Fiatstaaten. Sie schaffen parallele Rechtsräume, in denen klassische staatliche Hoheitsrechte ausgehöhlt oder umgangen werden.
Während Gesetze öffentlich debattiert und verabschiedet werden, bleiben viele Vertragswerke unsichtbar. Selbst Parlamente erfahren oft spät oder gar nicht, welche Verpflichtungen ihre Regierungen eingegangen sind. In diesen Vereinbarungen wird ausgehandelt, wer wo Steuern zahlt, wer Entschädigungen bekommt, wenn ein Staat Gesetze ändert, oder welche Bedingungen für Investitionen gelten. So entstehen Sonderbereiche, in denen nationale Rechtsprinzipien nicht mehr greifen.
Man denke an Fälle, in denen Staaten von Konzernen auf Schadensersatz verklagt werden, weil neue Gesetze angeblich erwartete Gewinne schmälern. Solche Klagen landen nicht vor ordentlichen Gerichten, sondern vor privaten Schiedsgerichten, deren Verfahren meist vertraulich bleiben. Hier steht der Staat nicht länger als souveräner Gesetzgeber da, sondern lediglich als eine Vertragspartei unter vielen.
Ähnlich ist es bei den komplexen Steuerkonstruktionen multinationaler Konzerne. Sie verschieben Gewinne durch Netzwerke von Holdings, Briefkastenfirmen und Trusts in Steueroasen. Diese Strukturen beruhen fast immer auf eigens geschaffenen ertraglichen Regeln. So verlieren Territorialstaaten, die formal souverän bleiben, faktisch die Kontrolle über zentrale Bereiche ihrer Politik.
Wenn Unternehmen zu Staaten werden
Besonders sichtbar wird die Macht der Fiatstaaten im digitalen Raum. Plattformen wie Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), Alphabet (Google, YouTube), ByteDance (TikTok) oder Amazon setzen eigene Regeln, die für Milliarden Menschen faktisch Gesetzeskraft besitzen. Sie entscheiden, welche Inhalte sichtbar sind, welche Nutzer ausgesperrt werden oder welche Produkte verkauft werden dürfen. Ihre Regeln – oft in Form von AGBs – wirken stärker als viele nationale Gesetze.
Für viele Menschen ist heute entscheidender, ob ein Beitrag gelöscht wird oder ob ein Parlament ein Gesetz verabschiedet. Plattformen handeln nicht nur wirtschaftlich, sondern normsetzend. Doch anders als Staaten müssen sie sich keinen Wahlen stellen. Ihre Entscheidungsprozesse bleiben intransparent. Und sie können ihre Regeln jederzeit ändern, ohne dass die Gesellschaft mitbestimmen könnte.
Das alles wäre weniger problematisch, wenn es sich lediglich um ersetzbare Privatunternehmen handeln würde. Doch diese Plattformen haben eine Infrastruktur geschaffen, die für viele Menschen so unverzichtbar geworden ist wie Strom oder Wasser. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Staatlichkeit und Privatwirtschaft.
Die stille Erosion der Souveränität
Das Zusammenspiel von Fiatstaaten und Kontraktokratie führt dazu, dass klassische Staaten zunehmend in die Defensive geraten. Sie bleiben sichtbar, sie halten Wahlen ab, sie unterhalten Parlamente und Gerichte. Doch ihre Handlungsspielräume werden zunehmend an anderen Orten definiert.
Konzerne können Volkswirtschaften unter Druck setzen, indem sie Investitionen abziehen. Internationale Schiedsgerichte entscheiden darüber, ob Umwelt- oder Gesundheitsgesetze zulässig sind. Plattformen setzen eigene Normen durch, unabhängig von nationalem Recht. Die eigentliche Gefahr liegt in der Unsichtbarkeit dieser Prozesse. Es gibt keine Panzer, keine Revolutionen, keine spektakulären Machtübernahmen. Stattdessen bröckelt staatliche Souveränität leise – durch Verträge, AGBs und komplexe Firmengeflechte. Die Öffentlichkeit nimmt viele dieser Vorgänge als Einzelfälle wahr. Doch sie sind Ausdruck einer neuen Ordnung.
Ein Beispiel liefert die deutsche Energiepolitik. Nach dem Kohleausstieg forderte RWE Entschädigungen in Milliardenhöhe, gestützt auf internationale Investitionsschutzabkommen. Hier ging es nicht nur um wirtschaftliche Interessen, sondern um die Frage, wer die Regeln setzt: das Parlament eines demokratischen Staates oder private Akteure, die sich auf die Kontraktokratie berufen. Selbst wenn Staaten Gesetze erlassen, sehen sie sich Forderungen gegenüber, die außerhalb ihrer eigenen Gerichtsbarkeit verhandelt werden. Demokratische Entscheidungen bleiben bestehen – doch sie bekommen einen Preis, der nicht im Parlament debattiert, sondern im Schatten privater Schiedsverfahren festgelegt wird.
Auch die Finanzmärkte liefern ein Beispiel. Ratingagenturen wie Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch sind private Unternehmen mit enormer Macht. Ihre Bewertungen bestimmen, wie teuer es für Staaten wird, sich Geld zu leihen. Eine Herabstufung des Ratings kann zusätzliche Zinskosten in Milliardenhöhe bedeuten. Staaten geraten so unter indirekten Zwang, bestimmte wirtschaftliche oder sozialpolitische Maßnahmen zu vermeiden, um keine schlechtere Bewertung zu riskieren. Hier wird ein staatliches Kernrecht – die Gestaltung der eigenen Haushaltspolitik – faktisch von privaten Akteuren beeinflusst, die keinerlei demokratischer Kontrolle unterliegen.
Warum die Sprache entscheidend ist
Solange uns präzise Begriffe fehlen, bleiben diese Entwicklungen schwer greifbar. Worte wie Globalisierung, Marktmacht oder Lobbyismus erfassen die Dimension dieser Veränderungen nicht. Sie bleiben zu abstrakt, zu harmlos. Sie benennen nicht die besondere Qualität dieser neuen Macht.
Fiatstaat und Kontraktokratie hingegen helfen, diese Strukturen sichtbar zu machen. Sie zeigen, dass es heute Akteure gibt, die keine Staaten im klassischen Sinn sind, sich aber wie Staaten verhalten. Die ihre Macht nicht durch Gewalt, sondern durch Verträge und symbolische Autorisierung entfalten und die zunehmend Regeln setzen, die einst demokratisch ausgehandelt wurden.
Es ist kein Zufall, dass es bisher keine gängigen Begriffe für diese Phänomene gibt. Denn solange wir nicht benennen können, was geschieht, bleibt es politisch kaum angreifbar. Was keinen Namen hat, existiert im öffentlichen Bewusstsein kaum. Und was nicht existiert, muss auch nicht kontrolliert werden.
Ein unbemerkter Umbruch
Vielleicht wird man in ein paar Jahrzehnten auf unsere Zeit zurückblicken und sagen: „Hier begann eine stille Revolution. Eine Revolution, die keine Aufstände brauchte, sondern Vertragsklauseln, Firmengeflechte und digitale Plattformen. Eine Revolution, die die Grundlagen der Demokratie verschob, weil sie veränderte, wer die Regeln unseres Zusammenlebens tatsächlich bestimmt.“
Fiatstaaten und Kontraktokratie sind kein Werk gezielter Absichten einzelner Akteure. Sie entstehen aus Strukturen, die sich zwangsläufig in einer Welt herausbilden, die Effizienz, Geschwindigkeit und Kapitalmobilität höher bewertet als eine demokratische Werteordnung.
Genau deshalb müssen wir darüber sprechen. Denn solange wir nicht verstehen, was diese Begriffe beschreiben, laufen wir Gefahr, in einer Demokratie zu leben, deren Fassaden noch stehen, während ihr Fundament längst erodiert.


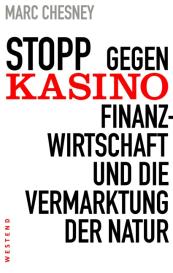
Hm, welchen Sinn haben solche knuffigen Begriffsneubildungen, wenn man genausogut die alte Einsicht wiederholen könnte, dass der moderne westliche Staat im Kapitalismus nur dazu dient, die Machtverhältnisse zu sichern und oberflächlich zu legitimieren, die sich aus der Verteilung von Vermögen und Einkommen ergeben?
Merke: damit etwas, wie hier Demokratie, ausgehölt werden kann, muss es davor in einem substanziellen Sinn existiert haben.
Ich denke das klassische Begriffs- und Theorieinventar ist grundsätzlich ausreichend.
Alles was wir da beobachten ist ist mit den Klassikern, spätestens mit Marx -Lenin grundsätzlich erklärt.
Die grundlegenden Dynamiken werden durch die moderne Technologie modifiziert, sind aber grundsätzlich die Gleichen wie früher.
Neue Begrifflichkeiten für Symptome sind eher verwirrend als erhellend.
Das sehe ich anders, entscheidend ist dabei dieser Satz:
„Solange uns präzise Begriffe fehlen, bleiben diese Entwicklungen schwer greifbar.“
Natürlich ist alles kapitalorientiert, aber wenn sie das im Alltag zum Ende argumentieren wollen, landen Sie bei dem Punkt der unterstellten Verschwörungstheorie, ein Begriff, mit dem alles diskreditiert werden kann.
Fiatstaat und Kontraktokratie sind Begriffe, mit denen sich die „Verschwörung“ im Sinne des Kapitals formal benennen und beschreiben läßt.
Das sehe ich anders, entscheidend ist dabei dieser Satz:
„Solange uns präzise Begriffe fehlen, bleiben diese Entwicklungen schwer greifbar.“
Natürlich ist alles kapitalorientiert, aber wenn Sie das im Alltag zum Ende argumentieren wollen, landen Sie bei dem Punkt der unterstellten Verschwörungstheorie, ein Begriff, mit dem alles diskreditiert werden kann.
Fiatstaat und Kontraktokratie sind Begriffe, mit denen sich die „Verschwörung“ des Großkapitals formal benennen und beschreiben läßt.
Der liberale Kapitalismus entwickelt sich zurück zum Feudal-System. Die Lenker von Google, BlackRock & Co sind die neuen Feudalherren. Staaten mit ihren Institutionen sind für sie nur Werkzeuge zu ihrer Macht- und Kapital-Anhäufung.
Die Macht dieser Akteure, ihre Interessen durchzusetzen beruht sehr wohl auf staatlicher Gewalt, die die Einhaltung besagter Verträge sicherstellt. Der Gegensatz „Fiat-Staaten“ und „eigentlichen Staaten“ löst sich auf, wenn man den vom Autor beschriebenen Vorgang als ein Abstreifen der von der herrschenden Klasse selbstauferlegten pseudodemokratischen Fesseln interpretiert.
Nichtdestotrotz favorisieren diese Akteure eine eigene, nichtstaatliche Gerichtsbarkeit, die über der staatlichen steht. Mangels eigener politischer Durchsetzungskraft instrumentalisieren sie für die Durchsetzung ihrer Interessen den mächtigsten Staat. Das ist es was wir derzeit mit den USA erleben.
Ja, richtig. Ich hab‘ den Eindruck, dass die Akteure eine Änderung geltenden Rechts im Rahmen der bestehenden Ordnung für zu aufwendig halten und anstelle dessen ein möglichst unsichtbares extralegales Parallel“recht“ installieren, mit tatkräftiger Unterstützung „demokratisch“ gewählter Inhaber politischer Macht. Was den Vorteil hat, dass die Geschichte vom Rechtsstaat mit auf demokratischer Entscheidungsfindung beruhenden Regeln aufrechterhalten werden kann, was wiederum die nötige Zustimmung zu dem ganzen Scheiß erzeugt …
Fällt der Fall hier in diese Kategorie?
Trump sanktioniert Khan -> Microsoft verweigert Emailzugang für ICC-Chefankläger.
Welche Macht hat Microsoft weltweit?
Bleibt noch die Frage offen: im Rahmen welcher Institution wäre hier Widerstand erforderlich?
Die Antwort darauf lautet: nur auf nationalstaatlicher Ebene (oder sogar nur unterhalb) ist Widerstand gegen diese Entwicklung zumindest theoretisch noch denkbar; nicht aber oberhalb auf EU-Ebene, mit einem sog. „Parlament“, das nicht einmal ein Initiativrecht zur Einbringung eigener Gesetzesvorschläge besitzt.
Nationale Parlamente können die Unterschriften ihrer Regierungen unterminieren, indem sie die Verträge nicht ratifizieren.
„Bleibt noch die Frage offen: im Rahmen welcher Institution wäre hier Widerstand erforderlich?“
Bleibt noch die Frage offen: im Rahmen welcher Institution wäre hier überhaupt Widerstend möglich?
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/trump-droht-eu-google-100.html
Kapitalismus halt.
Der kapitalistische Verwertungsprozess generiert deratige Geschäftsmodelle.
Nicht mehr die Staaten haben das Sagen, sondern die Lobbyisten der großen Unternehmen schreiben die Gesetze.
Google und Facebook sind die Feinde!
Religiöse, Pfaffen und sonstige Sektenprediger egal welcher Religion wie bpws. Scientologen, sind sowieso raus!
Wer Masken getragen hat ist raus!
Ausnahmen sind Kinder und echt alte Leute.
Andererseits sind Masken wegen des Sheddings natürlich erlaubt.
Wer die Giftspritze genommen hat ist raus!
Wer glaubt, das aus Geld mehr Geld zumachen richtig ist, ist ebenso raus!
Wer Aktien/Fonds hat, oder mit der Hochfinanz kungelt ist raus!
Wer mehr Eigentum hat als er selbst bewohnen kann ist raus!
Wer eine E‑Karre oder gar ein versmartetes KFZ besitzt, das einen auch noch abhört und alles nach Hause schickt oder ein E‑Bike fährt ist raus.
Wer E10 tankt ist raus!
Wer ein Smartphone nutzt ist raus!
Wer jetzt noch mit Windows surft ist raus!
Wer beim Bund, bei den Bullen oder ansonsten in irgendeiner Form systemimmanent gearbeitet hat ist raus!
Wer gendert, oder LGBTUI+* oder ähnliches fördert ist raus.
Wer sich durch sein Äußeres mit zu viel Schmuck (Goldkettchen) Mode oder Parfüm, Piercings oder gar Tattoos oder sonstigen Entstellungen, meint sich darstellen zu müssen ist auch raus!
Wer meint, dass Heiraten und Kinder bekommen zu seinem Glück gehört ist raus!
Wer Fußball oder Schlager gut findet ist auch raus.
Banker, Steuer, Pharma und Versicherungsfuzzies und alle weiteren Schlipsträger sind auch alle raus.
Mit Veganern (keine Ledergürtel) und so genannten Tierfreunden (Ich mach kein Führerschein, weil ich kein Kaninchen totfahren möchte, Betreuung am Stauende) und neuerdings Klimaschützern und Klebern, hab ich es versucht, aber seitdem die uns auch noch das Fleisch wegnehmen wollen, trotz einiger Bemühungen, bin ich gänzlich davon abgekommen die zu unterstützen.
Alle, alle raus!
Das, oder ewiges Siechtum!
Your choice
Bleibt noch Jemand übrig? ♫
Wo sind die raus?
Das sind genau diese Leute, die durch ihre fortgeschrittene Entfremdung und/oder Gesinnung, kein Gewissen mehr haben und denen ein humanitäres natürliches Zusammenleben am Arsch vorbei geht.
Diese Leute meide ich seit (dem Frühjahr2020 im Besonderen ganz explizit) ™1974 wie oben beschrieben.
Macht nix. Die bringen uns ja sowieso um.
Davon ab ist Deine persönliche in-out-liste auch nur das.
Generell muss man schon schauen, was man abnickt oder nicht. Man kann natürlich alle seine Daten Google ausliefern. Macht auch fast jeder.
Daneben gibt es noch diese internationalen Abkommen, die alle nach Vogelfutter klingen. Auch nicht fein, aber andere Geschichte.
Die Machthaber wollen es so. Notfalls schicken sie Prügelpolizei. War schon immer so.
Hoëcker, Sie sind raus!
Fiatstaat und Kontraktokratie beschreiben die Herrschaft der Globokonzerne in exakter Weise. Das sind die Begriffe die zur Erfassung des Spätkapitalismus gefehlt haben.
„Die Grenze deiner Sprache bedeutet die Grenze deiner Welt“.
Zitat Wittgenstein
In der Regel ist doch die Idee lange vor dem Begriff da. Wäre es anders, müsste man nicht nach Begriffen suchen um etwas auszudrücken.
Aber um den Begriff zu erklären, musst du auf die vorhandenen zurückgreifen …
lesetip: gottlob Frege, Funktion, Begriff, Bedeutung.
Frege ist in meinen Augen der bedeutendste Denker In unserem Lsnd. Ist aber schwer zu lesen. Nach Lektüre erkläre. sich viele wissenschsftliche Missverständnisse des 20 . Jahrhunderts wie von selbst
Für mich ist die Bezeichnung „gekaufter/privatisierter Staat“ oder kurz „Privatstaat“ treffender.
Das Konzept „Private-Public-Partnership“ besagt das deutlich. Beispiel: Die neue Weltregierung namens „WHO“ unter Federführung des mit „Thank you for your leadership“ gemeinten Hansels.
Rischtisch…👍
Sehe ich auch so. Die meisten neuen Begriffe verwässern eher statt Klarheit zu bringen ..
„die Grundlagen der Demokratie verschob, weil sie veränderte, wer die Regeln unseres Zusammenlebens tatsächlich bestimmt.“
Soll mir bloss jemand hier auf dumme Gedanken kommen und versuchen, mir das Internet für eine halbe Stunde abzuschalten, dann gibt es aber richtig Rambazamba auf der Strasse und Guerillakrieg gegen alle BSW-Spassverderber!
Wird bei dir nicht passieren. Typen wie Du werden gebraucht 😀
Anstatt sich eine eigene sprachliche Parallelwelt zu basteln, wäre es zweckdienlicher von Feudalismus zu sprechen. Neue Begriffe für eigentlich Altbekanntes stiften Verwirrung und lassen – zumindest bei mir – immer Zweifel am Urheber aufkommen.
der hat ja nichtmal „demokratie“ begrifflich eingeordnet.
„Man denke an Fälle, in denen Staaten von Konzernen auf Schadensersatz verklagt werden, weil neue Gesetze angeblich erwartete Gewinne schmälern.“
Auch das gibt es nur exclusiv in der sozialen Marktwirschaft aka Social Economy.
In einen Kapitalismus der ein Kapitalismus ist kann der/die Geschäftstreibende(n) gegen das Gesetz klagen und eventuell wenn das Gesetz gekippt wird eine Verdienstausfallentschädigung bekommen.
Es wird aber kein Gewinn imaginiert den man sich dann so ohne Gegenleistung in die Tasche steckt.
In gewisser Weise gab es das früher auch teilweise, man denke nur an den Vatikan, die Habsburger, das Spanische Reich oder die West Indian Company usw.
Herkömmliche Staaten waren dann auf die Dauer doch stabiler.
Der Staat, das Geld /Kapital ist angeblich im Umbruch…
Das steht in der Geschichte unserer Menschheit geschrieben, in allen Kontinenten, in allen Systemen der Herrschaft oder sonstigen Nihilismus als Ideologien deklariert wird der Mensch betrogen. Das betrügen liegt einzig allein im menschlichen selbst. Das ist die fortwährende Indoktrination durch Ideologien.
Bis heute existieren indigene Völker, die versuchen ihre Repression durch das Kapital zu verhindern, leider stehen ihre Möglichkeiten nicht zum besten…
Wer erinnert sich an den Gockel sitzend auf der Kirche?
Was hatte dieser Gockel der ‚Kirche oder dem Mensch‘ verkündet?
Ja eben, das ist die Zeit vom auslöschen diverser natürlichen Ereignisse.
In der Kristallnacht öffentlich durchzogen, haben Zionisten gutgläubigen Juden den Krieg erklärt…
Die Frage die sich stellt, warum tun solche Menschen was diese tun…?
All unser angebliches Wissen ist hervorgebracht durch die Natur, wohl deshalb krähte der Gockel vom höchsten Turm der dieser vorfand inform der Kirche…
Nicht die Kirche war sein Ziel, sondern der höchste Stand für den Gockel war ausschlaggebend.
Da waren ja noch diese „Freihandelsabkommen“, beginnend mit MAI in den 90-ern. Hier waren private Schiedsgerichte vorgesehen, die die „Investitionen schützen“ sollten. Die Unternehmen hätten dann jede Umweltgesetzgebung verklagen können. Aber auch bei TTIP waren solche vorgesehen. Inzwischen sind solche Verträge vom Tisch. Immerhin.
Fiatstaaten können durchaus ein Staatsgebiet haben. Hier war Honduras vorgesehen, der ganz große Befürworter war Markus Krall. Honduras deswegen, weil es dort schon einmal eine Privatstadt gab. Sie wurde komplett von der United Fruit Company verwaltet. Von daher kommt der Ausdruck Bananenrepublik. Er het keinen guten Klang, denn genau so ging es aus.
Wenn ich da als Linker hinkomme, verhaften sie mich vermutlich. Den Anwalt muss ich dann selbst brzahlen und überhaupt, werde ich mich nach Art des Hauses freikaufen müssen. Kann ich nicht wirklich gut finden.
Buch zum Thema von Andread Kemper:
https://www.amazon.de/Privatst%C3%A4dte-Labore-einen-neuen-Manchesterkapitalismus/dp/3897711753
Offen gestanden, kann ich mit den Begriffen wenig anfangen. Die Verflechtungen von Staaten und Kapital sind ja nichts aufregend Neues. Ganz gut fand ich den Artikel von Frank Deppe in der JW: https://www.jungewelt.de/artikel/507416.staatstheorie-der-leviathan-lebt.html
Autor: „Fiatstaat und Kontraktokratie hingegen helfen, diese Strukturen sichtbar zu machen.“
Ich bezweifle, dass mit neuen Begriffen Strukturen sichtbarer werden. Das halte ich für eine Illusion. Da gehört schon mehr dazu.
Stimmt auch wieder…
Was nützen andere Begriffe, wenn das System als solches schon nicht verstanden wird.
Alle diese Wortschöpfungen verharmlosen das wahre Wesen dieser Missbildungen.
Es sind kriminelle Organisationen. Vergleichbar der Mafia, Ndrangheta, Camora usw.
Die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Schäden sind schon seit langer Zeit
ein Aufruf, um gegen diese Krankheiten vorzugehen.
Leider gibt es genug Profiteure und viele, die hoffen mal selbst zu profitieren und daher immer weiter
mitmachen.
Daher zieht der Zug der Lemminge immer schneller Richtung Abgrund
Der kommende Krieg wird nur die erste, aber unumkehrbare Schneise ins Gefüge reißen
Krieg den globalen Fiatstaaten, Friede dem …ähm, deutschen Mittelstand vielleicht?
Top Artikel, deckt sich auch mit meiner Berufserfahrung. Es wird Zeit für eine deutsche Boston Tea Party! (Den Leuten geht’s in den Fiat-Strukturen allerdings noch zu gut…)
Wer sich näher für das Thema interessiert, sollte das Buch von von Claire Provost und Matt Kennard lesen: „Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy“
Dieses Buch sollte jeder lesen dem Freiheit und Demokratie am Herzen liegen. Wir hören oft kleine Neuigkeiten, ignorieren aber das Ausmaß der Dominanz und Kontrolle durch globale Konzerne. Dieses Buch hilft, die Zusammenhänge zu verstehen und das große Ganze zu erkennen.
Die beiden Autoren zeigen sehr bedeutsame und weitgehend unbekannte Wege auf, wie die globalen Konzerne die Demokratie gestürzt haben.Während viele Menschen den Kommunismus als Bedrohung für die Demokratie vermuten, zeigt dieses Buch zweifelsfrei, dass der Unternehmenskapitalismus der größte Feind der Freiheit der Menschen, unserer Demokratie und unseres Wohlstandes ist.
„Silent Coup“ ist nicht nur ein Mittel, um Menschen in Arbeitsgruppen zu organisieren, sondern zeigt, wie Konzerne zu einer Waffe umfunktioniert wurden, um die Reichen auf Kosten aller anderen zu mästen und ihnen Macht zu verleihen.
Vor allem aber geschah dies im Verborgenen und verwandelte die ganze Welt still und leise in eine technokratische Diktatur. Das Buch beschreibt, wie globale Konzerne durch ein weltweites Netzwerk aus Handelsabkommen und internationalen Investor-Staat-Schiedsgerichten (ISDS) erhebliche Macht über Staaten erlangt haben. Und es zeigt auch die Anfänge und die historischen Schritte wie dieses Unrecht zu Recht legalisiert wurde.
Diese privaten Schiedsgerichte ermöglichen es Unternehmen, Staaten zu verklagen, wenn diese Regulierungen oder Gesetze erlassen, die den Profit der Unternehmen beeinträchtigen. Dadurch werden nationale Gerichte umgangen, und eine Schattenjustiz etabliert, die hinter verschlossenen Türen agiert.
Das Ergebnis: Umweltauflagen, Arbeitnehmerrechte und öffentliche Gesundheitsregelungen können von Konzernen erfolgreich angefochten werden, was faktisch dazu führt, dass Unrecht zu Recht wird. Staaten drohen hohe Schadenersatzzahlungen, was sie davon abhält, strengere Gesetze zu erlassen. Diese Praxis hebt die staatliche Souveränität auf und transformiert die Demokratie heimlich in ein System, das die Interessen von Konzernen über das Gemeinwohl stellt.
Das Buch beschreibt dies als „stillen Staatsstreich“ (Silent Coup), bei dem Konzerne die Regeln der Demokratie aushöhlen, indem sie die Gesetze privatisieren und so ihre Macht absichern. Es wird auch aufgezeigt, wie diese Systeme mit Steuerparadiesen, Sonderwirtschaftszonen und privaten Militärfirmen verknüpft sind. Diese Mechanismen legalisieren systematisch eine Umverteilung von Macht und Ressourcen vom öffentlichen Raum in die Hände von Großunternehmen und Reichen.
Um eine Vorstellung der Größenordnung dieser Umverteilung zu bekommen, hilft eine Rand Studie von 2020, wie sie Rainer Mausfeld in seinem neuen Buch beschrieben hat. (1)
Die entscheidende Zahl aus der RAND-Studie ist, dass im Zeitraum 1975 bis 2018 in den USA über 47 Billionen US-Dollar an Wert durch „parasitäre Wertabschöpfung“ von den untersten 90% der Bevölkerung zu den obersten 1% umverteilt wurden. Diese Summe entspricht einem Betrag, der den unteren 90% vorenthalten wurde, während das reichste Prozent ihren Anteil massiv steigern konnte. Alleine durch gezielte Änderungen kapitalistischer Steuerungsregeln wurde also in diesem Zeitraum eine Summe von 47.000 Milliarden von unten abgeschöpft. Ermöglicht durch Jahrzehnte gezielter politischer Entscheidungen, die nach dem Prinzip der Sperrklinke funktionieren und immer nur in ein- und dieselbe Richtung vorangetrieben wurden, nämlich in Richtung einer Umverteilung von unten nach oben.
Konkret bedeutet das:
– Die untersten 90% hätten im Jahr 2018 im Schnitt $2.500 mehr pro Monat zur Verfügung gehabt, wenn die Einkommensverteilung wie 1975 geblieben wäre.
– Die Studie zeigt eine systematische Umverteilung enorme Größenordnung vom produktiven Teil der Bevölkerung hin zur kleinen Elite.
Diese Zahlen belegen sehr deutlich die extreme Zunahme sozialer und ökonomischer Ungleichheiten durch politische und wirtschaftliche Umgestaltung der letzten Jahrzehnte.
Laut der originalen RAND-Studie „Trends in Income From 1975 to 2018“ (2) wird die massive Wertabschöpfung für die obersten 1% vor allem von drei zentralen Sektoren vorangetrieben:
– Finanzsektor: Deregulierung, spekulative Märkte und verschärfte Eigentumsrechte begünstigen hier eine enorme Umverteilung zugunsten von Spitzenverdienern und Kapitaleignern.
– Gesundheitssektor: Überproportionale Preissteigerungen, sinkende Löhne für Fachkräfte und Konzentration von Gewinnanteilen bei großen Konzernen (Versicherungen, Pharma, Krankenhausketten) führen zu einer Wertabschöpfung von unten nach oben.
-Technologie-/Digitalsektor: Insbesondere nach der Jahrtausendwende haben die Digitalisierung, Plattform-Ökonomie und Konzentration von Datenbesitz (Big Tech) die Einkommens- und Vermögensschere weiter geöffnet.
Die Studie macht zudem deutlich, dass politische Rahmenbedingungen – etwa die Steuersenkungen für Spitzenverdiener, die Schwächung von Gewerkschaften sowie die Deregulierung der Märkte – diese Effekte weiter verschärfen. Diese drei Sektoren tragen somit maßgeblich dazu bei, dass über 47 Billionen Dollar im genannten Zeitraum umverteilt wurden und die Wohlstandslücke drastisch angewachsen ist
(1)https://www.rand.org/pubs/working_papers/WRA516-1.html
(2) Rainer Mausfeld: Hybris und Nemesis: Wie uns die Entzivilisierung von Macht in den Abgrund führt – Einsichten aus 5000 Jahren; S.359ff
Good to know!
Das hätte gut ein eigenständiger Artikel sein können. 👍
Fazit: die soziale Marktwirtschaft wird nicht von links (sozialistische Planwirtschaft) bedroht, sondern von rechts (kapitalistisch-feudalistische Oligarchien).
Nur so am Rande: früher oder später wird daraus eine kapitalistische Planwirtschaft werden, was angesichts künftiger Ressourcen-Knappheiten noch die „gute“ Nachricht ist.
Was ist am Wort „Konzerne“ schlecht?
Ich mag das Jammerige nicht, die USA, bzw. ihr Militär und Geheimdienste usw, schieben zig Milliarden in ihre StartUps, dort wird geklotzt, nicht mit Subventionen um die Ansiedlung eines ausländischen Konzerns gebettelt, man baut sich eigene auf, mit bahnbrechender Technik und… am Gängelband, alle haben sie Hintertüren für NSA und Co eingebaut, alle sammeln sie Daten, alle dienen sie letztendlich dem hochkorrupten amerikanischen Staat und seinen Weltmachtambitionen. Die DARPA (natürlich eine Militärbehörde) sucht nach vielversprechenden Ideen und StartUps und fördert sie, warum haben wir sowas nicht (muss ja nicht militärisch sein)?
Es gibt Länder mit Selbstbewusstsein und Behauptungswillen, die machen was eigenes, die Russen natürlich, die Chinesen sowieso. Und wir? Wir jammern mal wieder, analysieren, wollen von der EU gerettet werden, wollen internationale Lösungen oder gleich einen neuen Sozialismusversuch, aber auf die Reihe bekommen wir offensichtlich nichts, kein eigenes Betriebssystem, keine unabhängige Hardware, kaum nennenswerte KI und (natürlich) keine internationalen Abkommen! Welcher Platzhirsch lässt sich von Verlierern sagen, was er tun und lassen soll? Noch dazu Verlierer, die zunehmend autoritärer, zensurfreudiger und undemokratischer werden? Das Beste was sie tun können, ist uns zu ignorieren, wir haben eh keine Wahl, weil wir schlapp und dumm sind und ohne Behauptungswillen.
Allein letztes Jahr haben m.W. 270k Deutsche das Land verlassen, sehr wahrscheinlich gut qualifizierte, die anderswo mehr verdienen können, weniger Steuern zahlen und dort arbeiten, wo das Wetter erträglicher ist, der Amtsschimmel nicht so laut wiehert und sie nicht wahllose Zuwanderung „tolerieren“ und bezahlen müssen.
Die Unis sind korrupt und zum großen Teil mit Pfeiffen besetzt (habe ich selbst erlebt), didaktische Nullen mit seltsamen Ideen, Quotenfrauen usw. die sich nie für irgendwas rechtfertigen müssen, verbeamtet auf Lebenszeit, die an den Arbeiten ihrer studentischen Hilfskräfte schmarotzen. Hauptsache der akademische Nachwuchs gendert brav und wenn jemand ausschert und zu frei denkt oder den falschen Dozenten einlädt, bekommt er es mit linksradikalen Fachschaften zu tun. Und die US-Geheimdienste hocken auch mit drin (das hat Danisch gut genug belegt, er ist ein Opfer des US-Cryptokrieges, was ihm passiert ist, ist kafkaesk und zieht sich sogar durch unsere Gerichte, bis zum Bundesverfassungsgericht, alle Professoren haben das Maul gehalten, trotz der Schweineren, die „Gesellschaft für Informatik“ usw. ebenso und die Mainstreammedien haben ihn ignoriert). So läuft das schon Jahrzehnte!
https://www.danisch.de/Adele.pdf
Wir sind ein Vasallenstaat, einer der sich selbst hasst, der jeden niedermacht, der versucht dem Land wieder auf die Beine zu helfen, noch dazu einer, in dem Leistung verpöhnt ist und große Teile der Bevölkerung glauben, in einer Planwirtschaft würde es sich besser leben. Zu allem Überfluss fehlt jede demokratische Kultur, die Kartellparteien und ihre zwangsbezahlen Lügenmedien machen jede Alternative nieder, damit sie nicht mit an den Trog kommt. Regiert von Schulabbrechern und Studienversagern, die weder Familie noch Arbeitserfahrung haben, aber unglaubliche Arroganz und Sendungsbewusstsein. Sie wollen (typisch deutsch) die Welt retten, sind aber zu ungebildet, zu verbohrt und manche schlicht zu dumm dazu, sie stolpern über ihre eigenen Füße, wenn sie nur vor die Tür treten. Und der teuerste öffentliche Rundfunk der Welt, vertuscht, relativiert und treibt die Parteien noch stärker in die dümmstmöglichen Richtungen, während er seine Kernaufgaben vollkommen aufgegeben hat.
Der Zug ist abgefahren. Ich sehe nicht, wie wir da rauskommen wollen, Reeducation und Dummenkult haben ganze Arbeit geleistet! Unsere Wirtschaft schrumpft, die aller anderen wächst. Die anderen bauen was auf, verstehen was gespielt wird, wir hingegen finanzieren den Krieg in Staaten, mit denen wir gar nichts zu schaffen haben (und der uns mehrfach schadet), lassen wahllos Leute in unseren Sozialstaat migrieren und verwalten ansonsten nur noch den (zwangsweise erfolgenden) schleichenden Niedergang.
Die Deutschen werden jedem die Füße küssen, der sie knechtet. Wer keinen Stolz hat, keine Kinder und keinen Behauptungswillen, geht unter, das ist ganz einfach ausgedrückt: Evolution…
Ich auch nicht, vor allem dann nicht, wenn Diejenigen, die das beklagen, gleich danach selber in eine Jammerorgie verfallen – egal wie richtig der ein oder andere angesprochene Punkt auch sein mag.
sieht es ein
Baerbock ist das Schlauester Wesen auf diesen Planeten und ihr könnt dummerweise nichts dagegen machen.
Der Forent @Ohein hat es ja schon angesprochen. Es gibt bereits eine Bezeichnung für diese Verhältnisse, die da lautet PPP = private public partnership, soll heißen : Gewinne privatisieren, Verluste/Ausgaben sozialisieren. Oder noch kürzer: unbegrenzter Zugriff auf die Steuergelder der Staaten.
Genau dieses Prinzip konnte man während der Koronakrise beobachten, kann man in der Klimakrise und im derzeitigen Kriegsgeheul sehen.
Leute, wenn man Euch erzählt, man müßte Kühe töten und Insekten essen um nicht wg. CO2 Ausstoß in Kürze zu verbrennen – im gleichen Atemzug aber Waffen ohne Ende gegen Putin schmiedet und obendrauf noch Krieg unterstützt, Leute, dann müßt Ihr schon sehr dumm sein um die dreiste Verarsche nicht zu durchschauen. Da geht´s nur um die Umverteilung Eurer sauer verdienten Steuergelder – aber nicht in Eure Taschen und nicht zu Eurem Wohl !
Danke dafür, diese schädigenden Entwicklungen wieder mal in den Fokus geschoben zu haben. Wir haben damals gegen TTIP demonstriert, Investitionsschutz- und Freihandelsabkommen binden die Staaten – und damit den Souverän demokratischer Staaten – mit juristischen Fesseln. Inzwischen ist man schon viel, viel weiter. Einzig zum Wohle der Finanzmacht.
Über Begriffe mag man streiten. Ich wünschte mir statt „Fiatstaat“ und „Kontraktokratie“ etwas bildhafteres, griffigeres. Und außerdem scheint mir das dahinter liegende Handeln KONKRETER MENSCHEN so unterbelichtet zu werden.