
Wie das Geldsystem Wirtschaft und Politik verschlingt.
Das Finanzsystem ist unbegrenzt. Es steht unter dem Zwang, sich auszudehnen und dann drängt es in die Realität, um sich abzusichern, sich zu vermehren, zu persönlichem Gewinn. Die Geldvermehrung geschieht durch Schulden der anderen, besonders durch Staatsschulden. Doch Geld ist auf allen materiellen Ebenen der höchste Wert und Maßstab für Entscheidungen. So treibt uns das Finanzsystem vor sich her, in die unbegrenzte Expansion und in den Krieg.
Geld als höchster Wert der westlichen Welt
Gesellschaften und Staaten werden oft von abstrakten Ideen beherrscht. Das kann Religion sein oder Ideologie oder gleich mehrere, sogar zahlreiche, solcher geistigen Mächte, wie es in Indien der Fall ist. Wir leben hier in der sogenannten westlichen Werte-Welt. Was uns eint, ist ein gemeinsames oder sehr ähnliches Finanzsystem.
Dieses Finanzsystem wird gestützt durch den festen Glauben daran, dass Geld der entscheidende Maßstab für alles Handeln ist. Daran glauben nicht nur Finanzleute, sondern fast alle, die wenig oder zu wenig Geld haben und das ist die große Mehrheit von 90% bis 99% aller Menschen.
Wie das Finanzsystem aber funktioniert, wie Geld erschaffen wird, das ist fast allen unbekannt. Seine Menge und seine Macht sind in den letzten 50 Jahren enorm gewachsen. In Deutschland gipfelt die Finanzmacht in der Person von Friedrich Merz, der als Bundeskanzler voll und ganz die Interessen der Finanzwelt vertritt, so als sei er von einer Finanzinstitution in das Kanzleramt entsandt worden.
Die Grenzenlosigkeit von Geld und Schulden
Die Geldmenge steigt rasant und hat kein Limit. Gleichzeitig steigen Schulden so weit, dass alle Schulden längst nicht mehr beglichen werden können. Zinszahlungen überwältigen Staaten, Firmen und viele Privatleute.
Die Grenzenlosigkeit ist aber keine Glaubenssache, wie die Allmacht Gottes in früheren Zeiten, sie ist ein Systemfehler, der mathematisch begründet und mathematisch zu erkennen ist.
Während früher Geld häufig von Regierungen erzeugt, also gedruckt wurde, entsteht es heute zu etwa 90%, durch Kreditvergabe: Banken geben Kredite über Geld das sie nicht besitzen. Das nennt man girale Geldschöpfung. Dies ist ein Recht, das Banken sich einfach genommen haben. Niemand hat es verboten, es ist Gewohnheitsrecht oder Feudalrecht.
Es gibt keine Kontrolle und keine Begrenzung der Geldmenge. Gelegentlich kann eine Bank zusammenbrechen, wenn sie zu viele ungedeckte Gutschriften gemacht hat. Das gilt aber nur für den Einzelfall, die Expansion des Gesamtsystems wird dadurch nicht gestoppt, sondern nur auf andere Institute verlagert. Wenn ein Staat so eine Bank rettet, ist das ein Geldgeschenk im Namen der Allgemeinheit an die Finanzbesitzer.
Zinsen verlangen Expansion
Zum Feudalrecht der Banken, Geld zu erschaffen, gehört ein zweites Axiom der Finanzwirtschaft. Die Banken erheben Zinsen für dieses Geld, das sie nie besessen haben. Wie hoch die Zinsen sind, ist sekundär. Primär gibt es ein anderes Problem: Wo soll das Geld für die Zinsen herkommen? Es soll ja mehr zurückgezahlt werden, als erschaffen wurde. Im diesem System fehlt es immer an Geld für alle Zinsen.
Der einzelne Schuldner einer Bank kann versuchen, durch besondere Anstrengungen, sich das Geld für Zinsen zu beschaffen oder vom Munde ab zu sparen. Aber insgesamt können alle Schulden nicht beglichen werden. Es geht nur, wenn irgendwo sonst weiteres Geld per Gutschrift erzeugt wird, wodurch wieder mehr Schulden entstehen und mehr Zinsen aufkommen. Viele Schulden können nur durch weitere Schulden beglichen werden. Das nennt man Umschuldung. Es ist aber nur eine Verschiebung in einem sogenannten Teufelskreis: Das ist die Schuldenfalle.
Durch die Zinsforderung wird die Finanzwirtschaft genötigt, weitere Kredite zu vergeben und so die Geld- und Schuldenmenge zu steigern, das heißt, sie dehnt sich immer weiter aus. Unser Finanzsystem ist also nicht nur unbegrenzt, sondern auch expansiv.
Geld ist eine Zahl, die unbegrenzt wächst
Rüstungsgüter sind zur Zeit der große Renner am Aktienmarkt und so treibt uns die Finanzmacht in die Hochrüstung und in Kriege. Donald Trump hat erkannt, dass für sein Land unterm Strich nichts dabei heraus kommt. Er will den Krieg beenden, sonst hätte er sich nicht mit Wladimir Putin getroffen. Da steht aber eine Mehrheit in beiden Parteien gegen ihn, all diejenigen, die von der Dollarflut, der Rüstung, den Börsengeschäften, den Waffenexporten und von den Kriegen profitieren.
Auf dieser neokonservativen Linie liegt auch das Verhalten der Mächtigen in Europa: Merz, Starmer, Macron und von der Leyen, sie alle gebärden sich wie Angestellte der Finanzmacht: Unbegrenzte Rüstung, jetzt sogar gekoppelt an die Leistung der Volkswirtschaft. Das Treffen in Alaska hat ihnen das für die Rüstung nötige Feindbild genommen, weil Trump dem nicht mehr folgt, doch sie marschieren unbeirrt weiter. Da ist ein tiefer Widerspruch zwischen der absurden Logik der Finanzmacht und der globalen Machtpolitik, die Trump und Putin ansteuern.
Die Finanzwirtschaft hat sich schon lange von der Realität gelöst. Im Finanzsystem ist Unbegrenztheit und Expansion in Denken und Handeln immer möglich, weil Geld nur eine Zahl ist. Es vermehrt sich nicht in der realen Welt wie ein Pilz, auch nicht wie ein Krebsgeschwür oder wie eine Population von Insekten. Es vermehrt sich ohne direkte Zuführung irgendwelcher Substanzen rein mathematisch, losgelöst und völlig abstrakt. Und wenn Geld benutzt wird, nutzt es sich nicht ab, wie ein Werkzeug oder eine Maschine, es wird nicht verbraucht wie Energie, es wandert nur weiter und arbeitet völlig reibungslos. Deshalb ist Geld auch viel zu leicht verfügbar, für Banken und für die Politik.
Grenzenlosigkeit und Größenwahn
Die Grenzenlosigkeit und ständige Expansion des Geldsystems wirkt direkt auf diejenigen, die sich mit dem Geldsystem identifizieren. Sie tun dies, weil ihnen das Geld gehört oder weil sie über das Geld anderer verfügen, da ist es nur logisch, dass sie sich dieser Grenzenlosigkeit der Finanzen mental anpassen. Sie sehen ihre Finanzmittel und die eigene Macht ständig steigen, sehen, dass sie anderen überlegen sind, weil die anderen Geld mit Leistungen verdienen müssen.
Diese Situation, der ständigen Steigerung von Macht, ohne menschliche Anstrengung, treibt einige erfolgreiche Akteure in den Größenwahn. Der Größenwahn steckt im System, weil der oberste Maßstab für den Erfolg, das Geld, sich ständig vermehrt. Personen als Beispiele finden wir leicht: Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Besos und immer wieder Billy Gates.
Politiker sind davon nicht ausgenommen, sobald sie zu Milliarden oder zu hunderten Milliarden greifen können. Auch in der Politik wachsen die Zahlen, die bewegt werden, sehr schnell. Man vergleiche nur die Zahlen, die Olaf Scholz und Friedrich Merz bewegt haben.
Geld neu bewerten, mit oder ohne Zwang
Logisch wäre es, Geld erst einmal im Bewusstsein abzuwerten; denn die ständige Expansion der Menge muss den Wert gegenüber allen realen Dingen verringern. Alle anderen Güter sind begrenzt, ganz besonders die natürlichen Ressourcen auf diesem endlichen Planeten, aber auch die Leistung, der Wille zur Leistung und die Kraft der Menschen. Schulden sind schnell gemacht, die Rückzahlung plus Zinsen belastet Kinder und Enkel über Jahrzehnte hinaus.
Es herrscht die Illusion, dass mit Wirtschaftswachstum, besonders in der Informationstechnik, Schulden getilgt werden können. Aber die Glanzleistung der Künstlichen Intelligenz bringt nur wenigen Insidern einen Gewinn. Diese Technik macht Informationen noch leichter zugänglich, doch Information hat nur dann einen Sinn, wenn sie von Menschen wahrgenommen und angewandt wird. Die Datenmenge ist wie die Geldmenge technisch kaum begrenzt, beides nutzt uns aber nur, wenn wir sie verarbeiten, uns daran erfreuen und uns dabei körperlich und geistig wohl fühlen.
Wer sich dem Irrsinn, der im Finanzsystem steckt, entziehen will und selber nicht die Macht über Milliarden hat, muss sich den Dingen zuwenden, die wenig oder gar nicht mit Geld kontaminiert sind. Man findet sie überall, in der Natur, bei frei lebenden Wildtieren und Pflanzen, im eigenen Körper, in der Liebe und in der freien Kommunikation, ohne Rundfunk und ohne Fernsehen. Wir können Maß halten und meditieren. Ein gebrauchtes Fahrrad statt ein neues Auto. Frisches Gemüse, Beeren und Früchte statt Filet-Steak. Sprudelwasser statt Champagner. Energie sparen statt Tesla fahren.
Das System reduziert sich nicht freiwillig, weil es dem Größenwahn verfallen ist. Es wartet auf Katastrophen und es ist auch bereit, diese selber anzuzetteln. Rüstung und Krieg sind aktuell das Feld, wo der Wahnsinn sich unbegrenzt austobt.
An dieser Stelle muss unnbedingt eine Vollbremsung erfolgen. Man hört es schon krachen und quietschen. Aber die Größenwahnsinnigen in Europa haben es nicht gehört.
Rob Kenius betreibt die systemkritische Webseite https://kritlit.de und hat entsprechende Bücher veröffentlicht, darunter mehrere Bücher über das Finanzsystem.
Ähnliche Beiträge:
- Rüstungswahn gegen Medien-Tiger für die Finanzmacht
- Amerikas Finanzfeudalismus im Abstieg
- Ausbeutung Europas durch die USA als Ausgleich für die Emanzipation Chinas
- Absturz mit viel Geld in der Hand
- Selbstvernichtung auf dem Altar der Finanzen



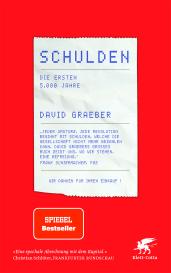
Wieviel Geld bleibt eigentlich übrig, wenn alle Schulden bezahlt sind?
a) alles
b) keines
c) irgendwas dazwischen
Diese Frage wirkt trivialer als sie ist. Henry Ford hatte seinen berühmten Satz nicht einfach so rausgehauen: „Wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir Revolution vor morgen früh“.
Was Geld ist und wie es entsteht übersteigt zum Glück für die „Eliten“ den Horizont oder die Willenskraft des Verstehens bei der Masse der Bevölkerung. Obwohl Geld offenkundig keinen eigenen ihm innewohnenden Nutzwert hat, halten die Menschen eisern den Glauben, es gegen eine Leistung eintauschen zu können, für einen eigenen Wert.
Es ist gar nicht möglich alle Schulden zu bezahlen!
Du hast es nicht kapiert.
Mag sein, dass man nicht alle Geldschulden durch vorhandenes Geld bezahlen kann. Allerdings bliebe dann noch die Möglichkeit der Aushändigung von Gegenständen, also Streichung der Schulden durch Übergabe des Hauses oder Verpfändung der Arbeitskraft.
Genau darauf baut der Kapitalimus auf
Akkumuklation des Kapitals und letztendlich aller irdischen Güter bei ein paar Wenigen.
Akkumulation des Kapitals hat doch nichts mit der Geldmenge zu tun!
Die Menge an Geld (Bargeld und Fiatgeld) und Schulden ist identisch! Die Geldmenge steigt durch Kredite, die größtenteils von Staaten aufgenommen werden und in kleineren Teilen von Unternehmen und in noch kleineren Teilen von der normalen Bevölkerung. Ein Großteil dieser Kredite wandert wieder in die Wirtschaft in Form von Investitionen, die Rendite abwerfen sollen. Durch Investitionen entsteht Wirtschaftswachstum.
Dass sich Vermögen und Vermögenswerte bei einigen Wenigen ansammeln, liegt schlicht und ergreifend daran, dass Kapitalisten Zugriff auf Einkommen haben, die den meisten Menschen verwehrt bleiben: Mieten, Zinsen, Kapitalerträge und Gewinne. Das sind exponentielle Möglichkeiten der Besitzvermehrung. Wer also mehr besitzt, bekommt mehr dazu. Wer wenig oder nichts besitzt, bekommt kaum etwas dazu. Hinzu kommen dann noch Erbschaften, die sich aus diesen Einkommen speisen konnten. Mit Lohnarbeit alleine zieht man keine Wurst vom Teller.
Das ist ganz simple Mathematik. Es ist in Wirklichlichkeit gar nicht so kompliziert!!
Aber die Linken diskutieren sich mal wieder den Mund fusselig, während um sie herum die Welt in Flammen aufgeht…
Und genau deshalb werden wir VERLIEREN!
Makroökonomisch betrachtet sind Schulden und Vermögen 1:1.
Vermögen besteht nicht nur aus Geld. Selbst Geldvermögen nicht.
Kommt drauf an was man vermag.😉
Diese Art, etwas zu vermögen, ist damit aber nicht gemeint.
Es geht aber wohl darum zu wissen, dass sehr reiche Leute oft nicht Geld als Vermögen besitzen, sondern Geldvermögen anderer Sorten wie Finanzanlagen, Aktien, etc.
Und womit werden Aktien und Anlagevermögen bezahlt? 😉
Mit Schuldgeld, das zuvor als Kredit geschaffen werden musste.
Nicht nur. Aktienoptionen haben vor allem einen Elon Musk reich gemacht.
Aber das ist nicht die zentrale Frage. Die zentrale Frage ist die zunehmende Verelendung im Niedriglohn- und Rentner-Bereich, welche die ökonomische Statik dieser Gesellschaft zerstören wird, wenn nicht entscheidend dagegen interveniert wird.
Wer von „unserem“ Wohlstand spricht, sollte deren „Wohlstand‘ am eigenen Leibe und in ausreichender Weise nachhaltig erfahren.
„Wer von „unserem“ Wohlstand spricht, sollte deren „Wohlstand‘ am eigenen Leibe und in ausreichender Weise nachhaltig erfahren.“
Das wird wohl eher nicht passieren, zumindest bei denen, die nicht nur davon sprechen, sondern maßgeblich verantwortlich sind für diese Zustände.
Was bleibt denn dann noch?
es werde Licht….
Man erzeugt Schulden um Geld zu generieren.😉
So ist es. Früher musste man immer Gold oder Silber beschaffen, was dazu führte, dass Geld immer knapp war und viele Investitionen nicht erfolgten.
Der Artikel fängt gut, wird in der Kritik dann aber zu holzschnittartig. Die UDSSR ist in den letzten Jahrzehnten auch deswegen hinter die USA zurückgefallen, weil sie keinen Zugriff auf einen weitläufigen Kapitalmarkt hatte.
Ausreichend Geld ist grundsätzlich eine gute Sache. Das gilt für Staaten, für Firmen – die früher diejenigen waren, die den Geldkreislauf über Schulden in Gang hielten – und natürlich für Privatleute, die tatsächlich besser darauf achten sollten, dass sie nicht in eine Situation geraten, dass die Schulden unbezahlbar werden.
Staaten sind nur deswegen in die Position gerutscht, dass sie zum Hauptermöglicher des Geldkreislaufs werden, weil die Großfirmen und ihre Aktionäre durch immer mehr Steuergeschenke heute immer mehr Geld ansammeln und es dadurch dem Geldkreislauf der Realwirtschaft entziehen. Wenn die Realwirtschaft weiterhin funktionieren soll, braucht sie aber Geld.
Das Geld vermehrt in die Kriegswirtschaft zu stecken, ist natürlich mit das Dümmste, was man machen kann. Kriege sind heute kaum noch gewinnbar, also wird es auch keine klingende Kriegsbeute geben. Die Investitionen in die Hardware sind Investitionen ohne Nutzen.
👍
T.h.omas
Henry Ford meinte, dass es sich beim Geldsystem nicht um eine intermediäre Funktion handeln, wie es die Lehrmeinungen und Gesetzgebungen vorgeben. LUG und TRUG!
Einfach, solange sie wahrnehmen, wie es die Lehrmeinung und Politik modelliert, Sie würden Ihr Geld den Banken und dem Staat überlassen, dann sind Sie vom Geldsystem-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der staatlich verordneten Bildungsverwahrlosung belastet, was Sie meinen oder sagen, kann nicht stimmen.
Rob Kenius ist auch mit dem Geldsystem-Alzheimer-Symptom belastet, weil er auch meint er sei Steuer- und Sozialzahler beides ist unmöglich.
Wenn alle Schulden getilgt sind verbleibt die Geldmenge, welche die Banken zur Abdeckung ihrer Eigengeschäfte, verbucht haben!
„Wenn alle Schulden getilgt sind verbleibt die Geldmenge, welche die Banken zur Abdeckung ihrer Eigengeschäfte, verbucht haben!“
Unsinn.
Unser Geldsystem besteht aus Schuldgeld, etwas anderes gibt es nicht.
Geld entsteht immer in Form von Buchgeld, wenn Kredite aufgenommen werden. Dabei entsteht gleichzeitig eine Verbindlichkeit in Höhe des Kredits.
Eine Bank kann sich nicht einfach Geld buchen…
Sie denken Unsinn!
Frage: Aus was besteht die Pseudoliquidität der Geschäftsbanken?
Richtig, aus dem Gegenwert der Eigengeschäfte der Zentralbanken mit Kunden der Geschäftsbanken!
Auch die Geschäftsbanken tätigen tagtäglich Eigengeschäfte, müsste systembedingt verboten sein!
Das Geldvolumen besteht aus Buchungsziffern, das Schuld- und Verzinsungskonstrukt sowie die Nutzung als eigenes Gewerbe ist Satanswerk!
Es handelt sich bei der Bereitstellung und Administration des Geldsystems um eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf der einen Seite der Medaille der Beschaffungsgrund und auf der anderen Seite der Leistungsgegenwert in gleicher Höhe!
Mit jedem Buchungsvorgang wird das Leistungsaustausch-Geldvolumen entweder erhöht (neue Beschaffung), gesenkt (Beschaffung Abschreibung/Schuldenreduktion), deaktiviert (Ertrag, Bildung Pseudo Eigenkapital = Reduktion der Kundenguthaben), aktiviert (Geschäftsaufwand, Reduktion Pseudoeigenkapital = Erhöhung Kundenguthaben, oder das Ergebnis des Leistungsaustausches (Umlage) wird auf der Seite des Leistungsgegenwertes hin- und her gebucht. Die sog. Pseudoliquidität der Geschäftsbanken, wird ausnahmslos mittels Eigengeschäften der Zentralbank (nicht durchlässig) modelliert, kann demnach nicht im Einklang mit Wirtschaftsunternehmen stehen, welche die Liquidität für sich verwenden kann!
Darum ist es doch erstaunlich, wie die Politik von den Banken eine höhere Liquidität und Eigenkapital verlangen kann, ohne jedoch das Geldsystem, kognitiv korrekt verkraften zu können. Die Bildungsverwahrlosung (Axiom = Staatszwang) als zugrundliegende Ursache?
Die klare Trennung zwischen Geldquelle (Bankensystem als Gemeinschaftsaufgabe = keine wirtschaftliche Leistung) und Wirtschaft (Finanz-Realwirtschaft-Unternehmungen) ist rechtlich und ökonomisch alternativlos.
Ziemlich konfus, was Sie da schreiben…
Wie DasNarf bereits sagte: 1 zu 1.
Jedermanns Forderung ist jemandes anderem Verbindlichkeit und umgekehrt.
Sowohl eine Ein-Euro-Münze als auch eine Fünf-Euro-Banknote sind Schuldscheine des Staates, die ihn verpflichten, meine Steuerschuld um den entsprechenden Betrag zu reduzieren, sobald ich sie überreiche.
Sind alle Schulden bezahlt (und Münzen und Banknoten wären dabei gleich als erstes alle, sprich: beim Staat), dann bliebe folgendes übrig:
– Land (darauf womöglich ein Häuschen, eine Wiese, eine Fabrik, Wälder, Bergwerke, Sandstrand,…)
– materielle Güter (Auto, Goldbarren, Öl im Tank, Konservenbüchsen mit Essen darin, etc.)
– immaterielle Güter (die Idee in meinem Kopf, die verfilmt bestimmt mal ein Blockbuster wird; die Liebe meiner Frau zu mir (unbezahlbar!); etc.)
Fertig.
Hab ich was vergessen?
Meines Erachtes ist das korrekt so.
Aber immaterielle Güter sind etwas anderes. Dazu zählen z.B. erwerbsfähige Dienstleistungen, die getätigt wurden.
Ideen, sofern sie noch nicht gegen Geld getauscht wurden, sind keine Güter im engeren wirtschaftlichen Sinne.
In unserem System zählt nur ENTLOHNTE Arbeit. Im nominellen BIP sind nur abgeschlossene Transaktionen enthalten, das ist ja das Problem. PRODUZIERT wurde nämlich deutlich mehr, das wird aber alles nicht erfasst. Genauso wenig wie ehrenamtliche Arbeit oder Care-Arbeit.
Die Leute arbeiten wie bekloppt, entlohnt wird nur ein Teil davon, und es reicht alles immer noch nicht!
Ein Apfel, der zwar geerntet und angeboten, aber nicht gekauft und verzehrt wurde, landet auf dem Müll, aber nicht im BIP. Ein Riesenschwindel.
Der wahre Mangel im Kapitalismus besteht nicht auf Seiten der Produktion, sondern auf Seiten der mit Kaufkraft ausgestatteten Bedürfnisse! Dieser Mangel hängt mit den 4 Einkommensarten zusammen, das habe ich vor ein paar Tagen hier erklärt.
Na gut, dann füge ich eben noch hinzu: „die Verwertungsrechte eines Musik-Verlages an einem modernen (jünger als 75 (?) Jahre alten) Musikstück“.
Den rein wirtschaftlichen Rahmen hatte ich allerdings absichtlich sprengen wollen. 😉
Geldvermögen, das nicht aus Geld besteht, aber durch die Nutzung von Arbeitskraft entsteht.
Das ist die umfangreichste volkswirtschaftliche Aktiva.
„Wieviel Geld bleibt eigentlich übrig, wenn alle Schulden bezahlt sind?
a) alles
b) keines
c) irgendwas dazwischen “
Da von den Linksextremisten bisher keine Antwort auf diese hypothetische, jedoch konkrete Frage kam, versuche ich mal eine Antwort: Ich tippe auf b)
Die Fragestellung bedient die Utopie, wie wenn das Schuldengeldsystem als Liquidität für den Leistungsaustausch, ökonomisch und rechtlich korrekt umgesetzt wird! Natürlich nicht, denn es handelt sich um ein geniales Kunstprodukt zur Ermöglichung der Wirtschaft! Es handelt sich korrekt verstanden um eine Gemeinschaftsfunktion!
Eine Schuld kann nur vereinzelt getilgt werden, denn die Tilgung kann nur mit dem anteiligen Geldvolumen erfolgen, welches nicht für den Lebensunterhalt gebraucht wird. Andernfalls die Wirtschaft nicht existent wäre!
Eigentlich geht es beim Geldsystem, korrekt verstanden und organisiert um die Bereitstellung der Liquidität zur Abdeckung der Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse sind zu definieren! Wir sind keine Zahler, sondern unsere Leistung wird bewertet und das Geld wird als Gegenwert meiner Leistung gegen eine andere Leistung ausgetauscht!
Der Overton-Artikel über „Grenzenlosigkeit und Größenwahn“ beschreibt präzise, was am Geldsystem falsch läuft: endlose Geldschöpfung, Schuldenlawinen, wachsender Kontrollverlust. Alles richtig erkannt – und trotzdem bleibt das Ganze unbefriedigend. Denn auch dieser Text reiht sich ein in die endlose Serie von Artikeln, die Probleme beschreiben, ohne auch nur eine Idee anzubieten, wie man es anders machen könnte.
Und genau das ist das eigentliche Problem: Diese Autoren machen sich groß darin, das System anzuklagen, aber sie scheuen davor zurück, über Alternativen nachzudenken. Sie lassen es so aussehen, als wäre das alles gottgegeben, als könne man es nur hinnehmen und beklagen. Damit bleiben sie genau in dem Rahmen, den das System selbst vorgibt.
Es gibt seit 2009 den Beweis, dass man Geld auch anders gestalten kann. Ob man Bitcoin mag oder nicht, ist dabei egal – es zeigt, dass man Regeln festschreiben, Knappheit definieren und Geldschöpfung begrenzen kann. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Wer dieses Beispiel nicht einmal erwähnt, tut so, als gäbe es schlicht keinen anderen Weg. Das macht die Analyse schwächer, nicht stärker.
Das große Dilemma dieser Texte ist ihre Selbstbeschränkung. Man kritisiert die Symptome – Blasen, Zinsen, Schulden, Eskalation –, aber weigert sich, die Architektur selbst infrage zu stellen. Man fordert „weniger Größenwahn“, als wäre das eine Frage von Moral oder Politik. Dabei liegt das Problem tiefer: Die Logik des Systems zwingt zum Größenwahn. Ohne Wachstum bricht es zusammen.
Das wäre genau der Punkt, an dem man neue Modelle diskutieren müsste. Nicht Werbung für Bitcoin, nicht Krypto-Hype, sondern die nüchterne Frage: Kann man Geld auch so gestalten, dass es nicht ständig explodieren muss? Kann man Regeln entwerfen, die Manipulation verhindern? Kann man Macht über Geld verteilen, statt sie zu zentralisieren? Diese Diskussion findet hier nicht statt.
Stattdessen bleibt man in einer Endlosschleife aus Empörung und Ohnmacht. „Alles läuft falsch“, „wir brauchen Wandel“, „das System ist krank“. Schön und gut – aber wenn der nächste Schritt fehlt, sind das nur Worte. Man kann Probleme endlos beschreiben, aber wenn man keine Szenarien durchspielt, wie es anders laufen könnte, ist das nur eine intellektuelle Beschäftigungstherapie.
Das Ironische ist: Diese Verweigerung, Alternativen auch nur anzudenken, stärkt genau die Strukturen, die man kritisieren will. Man hält die Empörung am Kochen, ohne je die Machtfrage zu stellen. Wer über Geldflüsse redet, aber die Regeln der Geldschöpfung nicht anfasst, liefert unfreiwillig den Beweis, dass der Diskurs selbst Teil des Systems ist.
Natürlich ist Bitcoin nicht die Antwort auf alles. Aber es ist ein Beispiel, dass es Antworten geben könnte. Wer das ausblendet, schreibt die nächste Abhandlung über Systemversagen, ohne jemals darüber zu sprechen, dass Systeme veränderbar sind. Das ist bequem für die Autoren, aber nutzlos für alle, die tatsächlich Lösungen suchen.
Was wir brauchen, ist nicht noch ein Text, der uns erzählt, wie schlimm alles ist. Wir wissen das. Wir leben darin. Was wir brauchen, ist Mut zur offenen Debatte: über Alternativen, über andere Designs, über echte Experimente. Das kann Bitcoin sein, muss es aber nicht. Aber so zu tun, als gäbe es keinen anderen Weg, während man gleichzeitig die Katastrophe beschreibt, ist intellektuelle Bankrotterklärung.
Das Problem ist nicht, dass Overton diesen Größenwahn analysiert. Das Problem ist, dass die Debatte dort endet, wo sie beginnen müsste. Solange niemand über Alternativen sprechen will, drehen wir uns im Kreis. Und genau das ist das eigentliche Drama: Nicht das System zerstört uns, sondern die Weigerung, über einen Ausstieg nachzudenken.
@ Miri
Danke sehr!
Ohne die Beseitigung des Systems und seiner Adlaten gibt es keinen Ausstieg!
Sehr schöner Text, danke. Leider sind die Menschen, die ich kenne, für solche Debatten nicht bereit.
Der einzige Weg, der da bleibt, ist nach Menschen zu suchen, die es sind.
Grüße
@Miri: Sehr schön auf den Punkt gebracht!
@all: Weder halte ich goldgedeckte Währungen für einen Weg, das Problem zu lösen, noch vermag ich Bitcoin als Lösung zu erkennen. Gibt es hier Anhänger der Modern Money Theory, die erläutern wollen, warum die das angeblich leisten könne?
Die MMT liefert nur die Beschreibung der derzeitigen Techniken.
Die bewusste Inanspruchnahme dieses Instruments, um die Gesellschaft besser hin zu mehr allgemeinem Wohlstand zu gestalten, braucht aber die Analyse von dessen Notwendigkeit.
Und hierbei fehlt es, wenn ich meine Beiträge hierzu außer Acht lasse.
Die MMT ist nur eine Leiter, um das Hindernis einer Mauer überqueren zu können. Eine.solche Leiter kann auch zu kurz sein, wenn man keine administrativen Flankierungen trifft.
Aber zuerst geht es darum, überhaupt eine Mauer wahrzunehmen. Und daran scheitert es. Gerade und vor allem bei Wissenschaftlern, für die Ökonomie eine Religion darstellt und deswegen bestimmte Axiome nicht hinterfragt werden dürfen.
@Luck: Danke für die Rückmeldung.
An welche Axiome denken sie dabei? An die der Angebotsorientierten Ökonomen (Trickle-Down-Zeugs), oder an solche der Nachfrageorientierten, wie Flassbeck, den Sie ja weiter unten kritisieren (und den ich durchaus schätze)?
Warum sind Volkswirtschaften streng an Gleichungssysteme gebunden? Ohne ein Aufweichen solcher gibt es auch keine Umsetzung von MMT-Maßnahmen.
Warum bemisst sich Wohlstand in abstrakten Geldeinheiten und nicht mit den realen Sorgen von Menschen, die sich ins System einbringen, aber dennoch nicht ausreichend alimentiiert werden?
Warum ist es Usus, dass man nur dann seinen Arsch hoch bekommt, wenn man selbst unmittelbarer Nutznießer ist?
Ich werde als Ausnahme als „zu gut für diese Welt“ angesehen, profitiere aber auf andere Weise von dieser Einstellung. Wenn also Selbstlosigkeit zum Vorwurf wird, kann etwas nicht (mehr) stimmen.
@ Luck alias Gott
„… zu gut für diese Welt“
Jetzt hast du dir aber mehr als genug auf die eigene Schulter geklopft: Wow, welch geradezu überirdischer Typ du doch bist! Ein Wahnsinn! Darf man dich mal berühren; zumindest mal imaginär? Ob ich jetzt wohl eine schlaflose Nacht vor lauter Ehrfurcht und Bewunderung haben werde?
Ganz sicher nicht! Aber du wirst deine Jünger schon finden…
Ersetzen Sie Gott mit Arschloch oder Depp. Dann kommen Sie der Realität wesentlich näher…
@Alex_R: Genau da liegt doch der Knackpunkt. Der Overton-Artikel kritisiert ja gerade die grenzenlose Geldschöpfung und die damit verbundene Wachstumslogik. MMT würde diese Dynamik aber nicht begrenzen – im Gegenteil, sie macht sie zum Prinzip: Staaten sollen noch mehr Geld schaffen, weil sie angeblich nie pleitegehen können. Damit verstärkt MMT genau das Problem, das der Artikel anprangert.
Und zu Bitcoin: Es geht nicht darum, ob das „die Lösung“ ist oder nicht. Aber Bitcoin zeigt seit 2009, dass man Geld auch anders denken kann – mit festen Regeln, ohne endlose Ausweitung. Ob man das Modell gut findet oder nicht, ist zweitrangig. Es ist der Beweis, dass Alternativen technisch möglich sind.
Wenn wir MMT ernsthaft diskutieren, dann bitte im Kontext: Will man wirklich das gleiche System, das gerade kritisiert wird, nur noch extremer fahren? Oder reden wir endlich darüber, wie man das Fundament des Geldsystems überhaupt neu gestalten könnte?
Miri,
selbst minimalstes volkswirtschaftliches Grundwissen sollte ausreichen, um ihre Gedanken als das zu klassifizieren, was sie sind: …….
Wir hätten sofort eine wirtschaftliche Katastrophe, wenn Bitcoin die Funktion des gesetzlichen Zahlungsmittels übernehmen müsste.
Ist die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre völlig an ihnen vorbei gerauscht, ohne diese wahrgenommen zu haben?
Die Schaffung von Kaufkraft ohne Verschuldungszwang eines Staates ist also von schlechten Eltern? Welcher Religionsgemeinschaft gehören sie an, welche dieses predigt und was sie anscheinend unreflektiert übernommen haben?
Analyse geht eben anders und gerade nicht dadurch, Anal-Produkte in die Welt zu setzen.
@Luck: Dein Kommentar enthält mehr Polemik als Analyse. Anstatt sachlich zu argumentieren, diskreditierst du Positionen durch persönliche Angriffe und rhetorische Fragen. Begriffe wie „Religionsgemeinschaft“ oder „Anal-Produkte“ sind keine Argumente, sondern Ablenkungen vom eigentlichen Thema.
Der Verweis auf die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre greift zudem ins Leere. Diese Krise war das Ergebnis eines deflationären Schuldensystems und politischer Fehlentscheidungen, nicht einfach ein Beweis dafür, dass Alternativen wie Bitcoin automatisch scheitern müssten. Hier stellst du einen Vergleich her, der historisch und ökonomisch nicht trägt.
Statt die Funktionsprinzipien von Bitcoin oder anderen Modellen zu prüfen, verteidigst du das bestehende System, ohne seine strukturellen Probleme – Verschuldungszwang, Umverteilung und Inflationsabhängigkeit – überhaupt zu adressieren. Wenn man technische und ökonomische Fragen auf die Ebene von Angriffen und Unterstellungen zieht, ersetzt man Analyse durch Emotion.
@ Luck alias Gott
„Ist die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre völlig an ihnen vorbei gerauscht, ohne diese wahrgenommen zu haben?“
Das fragst du gottgleiches Fabelwesen die Miri als eine gewöhnliche Sterbliche fast 100 Jahre später?
Denke, du aufgeblasene Wurst must noch lange an deiner Legende stricken… Meinst nicht auch?
Warum ist Willy nicht willens, in der Sache was beizusteuern?
Kann er es nicht oder will er es nicht?
Wären Sie in meiner Nähe, wäre der Prozess kurz. Nur, um das mal klar auf den Punkt zu bringen!
Ein anderes, neues System muß aber auch alltagstauglich
sein. Und das für große und kleine „Geschäfte“. Ich muß damit
überal, bei jedem Bäcker ein Brötchen kaufen und auch mir
ein Haus z.B. über einen Makler kaufen können. Ein Zahlungsmittel
muß eine Wertgrundlage haben. Gold bietet sich da wohl am besten
an. Das setzt aber auch einen festgelegten Wert des Goldes voraus.
Ein „Zocken“ wie es im Moment geschieht, darf es dann nicht geben.
Dann geht es aber schon wieder mit einem Haken los: Das Goldschürfen
lohnt sich dann nur noch für die ganz Großen. Im Moment profitieren
die kleinen Schürfbetriebe vom steigenden Goldwert. Wahrscheinlich
muß dann der Staat das Gold suchen und schürfen. Als ersten Schritt
überhaupt, sollten die Banken und Kapitalgesellschaften wie Blackrock
und Vounguard an die Kette gelegt werden. Nur von wem? Ein Kanzler
der von Blackrock gestellt wird, wird sicher seinen wirklichen Arbeitgeber
nicht kapeister gehen lassen. Ein Milliardär wie Trump, der sein Vermögen
auch von den großen Geldverwaltern vermehren läßt, ebenso wenig.
„Was tun“, sprach Zeus, „die Götter sind besoffen!“.
Man muss bei einem Vollgeldsystem wie diesem dann zusätzliche Arbeiskraft verausgaben, um flüssig zu werden.
Weil man blind dafür ist, die verausgabte Arbeitskraft im Wirtschaftsprozess zu sehen, wird jedes fiat money für ungedeckt und wertlos gehalten.
Wenn man Probleme verschärfen will, wird man Vollgeld-Fetischist. Dann kann man seinen Voll-Horst auch besser ausleben.
Frage: Wer beschreibt bitte eine Theorie zum vollkommenen Ersatz/Ablösung des Geldsystems durch die Einführung der Kilowattstunde als Zahlungsmittel?
Nennt man auch Kapitalismus.
Und den kann man nicht deckeln oder begrenzen.
Nur abschaffen!
@Motonomer: Kapitalismus ist hier nicht die Ursache, sondern die Folge. Der Overton-Artikel beschreibt Probleme, die vor dem Kapitalismus liegen: grenzenlose Geldschöpfung, Zwang zum Wachstum, Machtkonzentration. Das sind strukturelle Mechanismen, die sich auch ohne freien Markt genauso abspielen würden. Kapitalismus ist das sichtbare Symptom – die Regeln des Geldes sind der eigentliche Motor.
Wer sagt „Kapitalismus abschaffen“, ohne die Architektur anzuschauen, übersieht genau diesen Punkt. Wenn die Geldordnung unverändert bleibt, entstehen dieselben Effekte auch unter jedem anderen Etikett. Ob wir es „Kapitalismus“ nennen oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist: Wer darf Geld schaffen, nach welchen Regeln und mit welchen Grenzen?
Hier liegt auch der Grund, warum Debatten über Alternativen so wichtig sind. Ob Bitcoin, Vollgeld, regionale Währungen oder andere Modelle – man kann Geldsysteme gestalten. Man muss nicht alles übernehmen, man muss nichts glorifizieren. Aber so zu tun, als gäbe es nur „weiter so“ oder „alles abschaffen“, ist eine Sackgasse.
Das Finanzsystem ist ein immanenter Teil des Kapitalismus.
Ich dachte, das wäre wohl jedem geläufig.
Ergo, das Finanzsystem abschaffen und ein Taussystem mit
Muscheln einführen. Das würde dann aber der Erde den Rest
geben, wenn die Menschen millionenfach die Küsten leer
machen.
Man muss ja nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Das Kind sollte aber erzogen werden, sprich dem Kapitalismus muss soziales Verhalten beigebogen, und bisweilen auch Grenzen gesetzt werden. Das müsste kultureller Konsens sein.
Gerade das ist es aber nicht.
Trotz 1929 wird davon ausgegeangen, dass Kapitalismus ein Selbstläufer ist und per se Wohlstand und Fortschritt schafft.
Ohne eine ökonomische „Tempelreinigung“ wird es also nicht gehen.
Aber wer traut sich schon, die falschen Götter vom Throne zu stoßen?
Das haben ja noch nicht einmal die Adepten des Ketzers aus Nazareth verstanden!
Bitcoin fungiert im wesentlichen als Anlagegut und nicht als Zahlungsmittel.
Dabei hat dieses Anlagegut im Zweifel keinen intrinsischen Wert, welcher gesetzlich garantiert ist. Und die Transaktionskosten sind auch nicht ohne. Aber deshalb wird es als Zahlungsmittel auch nicht genutzt, von Ausnahmen abgesehen, wenn die üblichen Wege nicht.beschritten.werden können.
@Luck: Das mit dem „Zahlungsmittel“ greift an der Stelle zu kurz. Die Diskussion hier geht nicht darum, ob man mit Bitcoin beim Bäcker bezahlt. Entscheidend ist, dass Bitcoin beweist, dass Geldgestaltung anders funktionieren kann – mit klarer Begrenzung, ohne willkürliche Ausweitung und transparenten Regeln, die niemand allein ändern kann.
Ob man Bitcoin mag oder nicht, ist zweitrangig. Es geht auch nicht um einen „gesetzlich garantierten intrinsischen Wert“ – den gibt’s bei Euro, Dollar und Gold genauso wenig. Geld ist Vertrauen in Regeln. Genau deshalb ist Bitcoin relevant: Es zeigt, dass man Regeln neu schreiben kann.
Ich sehe da keinen Beweis.
Bislang funktioniert Bitcoin nur als Derivat für staatliche Währung.
Man könnte auch sagen, Bitcoin ist eine Ware innnerhalb unseres Systems, mit der man handeln kann.
Der Beweis, dass man damit mehr anstellen kann, steht meiner Meinung nach noch aus.
Bitcoin wird als Asset genutzt und nicht als Zahlungsmittel.
Diesem aber Zahlungsfähigkeiten anzudichten, zeigen nur die Untulänglichkeiten des Bezeichnenden auf.
Ein Georg Friedrich Knapp hat das vor 120 Jahren schon besser gewusst und die Intrinsität funktional verortet.
Miri: Aber wenn man mit Bitcoin nicht auch beim Bäcker
bezahlen kann, ist es als Alternative schon sofort
auszuschließen. Ein Zahlungsmittel muß für jede
Zahlung taugliche sein, sonst ist es überflüssig.
Wenn Miri meint, dass es funktioniert, erübrigt sich diese Nachfrage.
Aber leider kümmert sich die Realität nicht um solch religiös anmutendes Gewäsch, das Miri sicher mit einer gewissen Aufrichtigkeit zum besten gibt.
Leider kapiert sie es (noch) nicht.
Weil man etwas anderes einführt, funktioniert es zwar, aber nur innerhalb der jeweiligen Restriktionen.
Warum hatten Hayek und Friedman einen Disput?
Und wie bewerten sie diesen?
Erst eine angemessene Antwort auf diese Frage zeigt auf, ob das Grundproblem verschiedener Geldsysteme überhaupt ansatzweise erkannt worden ist.
Dabei ist die Art des Geldes das kleinere Problem im Wirtschaftssystem, wenn man als Vergleich die Verteilungsfunktion von Zahlungsmitteln im Ökonomieprozess nimmt.
In meinen Artikeln kommen die Lösungsvorschläge immer am Schluss, du musst also bis zum Ende lesen, ehe du kommentierst. Über Bitcoin habe ich weiter unten einen Kommentar geschrieben, aber hier noch mal extra für Miri:
An Miri und alle Bitcoin-liebhaber
Immer wieder tauchen bei meiner Aufklärung über das Finanzsystem Fans von Bitcoin auf, zum Beispiel Miri, die Bitcoin als Alternative zum bestehenden Finanzsystem darstellen wollen. Das ist Unsinn. Bitcoins sind kein Geld, sondern Spielgeld. Für Geld fehlt dem Bitcoin und den anderen Krypto-Währungen erstens ein fester Wert und zweitens die allseitige Akzeptanz.
Der Wert ist wie bei Briefmarken oder Kunstgegenständen von der Marktlage abhängig; denn er ist eine Funktion des Handels, ähnlich Aktien und deshalb ist er auch an der Börse gerne gesehen.
Die Akzeptanz aber ist ist der größte Schwachpunkt. Nur wenige akzeptieren Bitcoin und die Art wie er per Zufall generiert wird. Auch die Blockchain-Technik wird nicht akzeptiert, weil Zahlungen nicht für jeden objektiv verfolgbar und nachweisbar sind. Dazu benötigt man eine zentrale Instanz, die notfalls für Rechtssicherheit sorgt.
Bitcoin funktioniert nur in einer Community der Wolwollenden oder Gutmenschen oder Fans, nicht als Geld für den gesamten internationalen Markt.
Ich habe das schon vor Jahren ausführlich dargelegt und kann das nicht in jedem Artikel wieder erwähnen. Bitcoin-Krypto-Blockchain-Geld https://kritlit.de/tdt/bitcoin.htm
Beste Grüße
Rob Kenius
@Rob Kenius: Mir geht es nicht darum, Bitcoin zu verteidigen oder als perfekte Lösung darzustellen. Es geht darum, dass Ihre Analyse an entscheidenden Stellen fehlerhaft ist und dadurch für jeden, der sich technisch und ökonomisch tiefer mit dem Thema beschäftigt hat, wie eine oberflächliche oder sogar schlampige Auseinandersetzung wirkt. Als Physiker sind Sie an analytische Stringenz gewöhnt – genau diese wäre hier notwendig.
Sie nennen Bitcoin „Spielgeld“ und behaupten, es fehle ein fester Wert und eine „allseitige Akzeptanz“. Beides ist so nicht haltbar. Ein „fester Wert“ existiert bei keinem Geldsystem: Weder Euro, Dollar noch Gold sind stabil, ihr Wert ist immer marktabhängig. Der Vergleich mit Kunst oder Briefmarken ist irreführend, weil Bitcoin fungibel, hoch teilbar, global handelbar und deterministisch in seiner Geldmengenentwicklung ist. Die Börsenpräsenz, die Sie als Abwertung nutzen, bestätigt im Gegenteil die Relevanz, die Bitcoin mittlerweile auch im institutionellen Bereich hat. Die Forderung nach „allseitiger Akzeptanz“ ist ebenfalls ein Kriterium, das kein existierendes Geld erfüllt. Selbst der Dollar funktioniert nur dort, wo er gesetzlich durchgesetzt oder kulturell etabliert wurde. Akzeptanz ist graduell, nicht absolut.
Ihre Aussage, Bitcoin werde „per Zufall generiert“, ist ebenfalls unpräzise. Der Emissionspfad ist festgelegt und seit 2009 unverändert: Maximal 21 Millionen Einheiten, regelmäßige Halbierungen der Belohnung, deterministischer Zeitplan. Der Zufallsfaktor betrifft nur die Verteilung neuer Blöcke an Miner, nicht die Geldmengensteuerung selbst.
Völlig falsch ist die Behauptung, die Blockchain-Technik werde „nicht akzeptiert, weil Zahlungen nicht objektiv verfolgbar und nachweisbar sind“. Die Bitcoin-Blockchain ist ein vollständig transparentes, unveränderliches Register. Jede Transaktion kann von jedem Node geprüft und von jedem Dritten nachvollzogen werden. Es gibt kaum ein System, das technisch verbindlichere Nachweise liefert als Bitcoin. Wenn Sie Rechtssicherheit meinen, dann sprechen Sie über staatliche Identitäts- und Vertragsdurchsetzung, nicht über die Nachweisbarkeit der Transaktion selbst. Hier werden technische und rechtliche Ebenen vermischt, was die Analyse verzerrt.
Auch die Aussage, Bitcoin funktioniere „nur in einer Community der Wohlwollenden“ ist unzutreffend. Das System ist gerade dafür entworfen worden, ohne Vertrauen auszukommen. Es funktioniert auch zwischen misstrauischen Parteien, weil die Konsensmechanismen und kryptografischen Beweise so gestaltet sind, dass niemand einer zentralen Instanz oder dem guten Willen der anderen Teilnehmer vertrauen muss. Das ist ein Kernprinzip von Bitcoin und der entscheidende Grund, warum es international genutzt werden kann.
Schließlich werfen Sie Bitcoin und andere Kryptowährungen in einen Topf, ohne zwischen sehr unterschiedlichen Konzepten zu unterscheiden. Bitcoin ist in seiner Architektur einzigartig: keine zentrale Emittenteninstanz, kein Pre-Mining, deterministische Geldpolitik, verteilte Konsensfindung. Es unterscheidet sich grundlegend von vielen „Krypto“-Projekten, die ganz andere Sicherheits- und Wirtschaftsmodelle haben. Alles pauschal in einen Hut zu werfen, wirkt ungenau und wissenschaftlich unsauber.
Mir geht es nicht darum, Bitcoin zu idealisieren. Aber wenn man es kritisiert, sollte man das auf Basis korrekter Fakten tun. Wer Bitcoin oberflächlich abwertet und dabei zentrale technische und ökonomische Grundlagen falsch darstellt, riskiert, die eigene Glaubwürdigkeit zu untergraben. Gerade weil Sie als Physiker publizieren, erwartet man die gleiche methodische Präzision wie in Ihrem Fachgebiet. Alles andere wirkt auf Leser, die mit der Materie vertraut sind, nicht wie eine fundierte Analyse, sondern wie Schlampigkeit.
Oh, doch vertrauen ist notwendig, z.B. ein Vertrauen darauf, dass nicht eine Gruppe (die zusammen arbeitet) nun mehr als 50% der Rechenkapazitäten des Bitcoin-Netzwerks kontrolliert.
Ein weiteres Problem besteht natürlich generell bei asymmetrischen Kryptoverfahren/systemen und mit Schlüssellängen, welche zu einem historischen Zeitpunkt t zwar sicher waren (oder zumindest als sicher galten), aber zu einem Zeitpunkt t+t‘ (mit hinreichend großen t‘) dann eher nicht mehr sicher sind (und der Zeitpunkt t+t‘ dann irgendwann in der Vergangenheit liegt)…
Alles quatsch
Kryptowährungen werden uns nicht weiterhelfen, solange es Kapitalismus gibt
Das ist richtif.
Aber seit über 16 Jahren existiert das Modell eines intelligenten Marktes.
Warum Herr Rob Kenius gehen Sie darauf nicht ein?
Dieses Modell würde es ermöglichen, dass die Bürger zur Selbstveraltung fähig werden.
Und die Geldmenge wäre begrenzt, werthaltig und es gäbe keinen Zinsesins-Effekt.
Das wäre die notwendie soziale Antwort auf die digitale Revolution.
siehe auch im Laufe des Tages nach Freigabe:
https://ansage.org/kuenstliche-intelligenz-winter-oder-sommer/#comment-173665
Die Fassung mit korrigierter Rechttschreibung und Ergänzung.
Das ist richtig, was Rob Kenius über BitCoin sagt.
Geld muss an etwas Werthaltiges gebunden werden. Auch StableCoins erzeugen nur eine Illusion von Werthaltigkeit. Auf jeden Fall muss das FIAT-Geld weg.
Und die Macht über das Geld muss bei denen liegen, die die Werte erst erschaffen.
Aber seit über 16 Jahren existiert das Modell eines intelligenten Marktes.
Warum Herr Rob Kenius gehen Sie darauf nicht ein?
Dieses Modell würde es ermöglichen, dass die Bürger zur Selbstverwaltung fähig werden.
Und die Geldmenge wäre begrenzt, werthaltig und es gäbe keinen Zinseszins-Effekt.
Das wäre die notwendie soziale Antwort auf die digitale Revolution.
siehe auch im Laufe des Tages nach Freigabe:
https://ansage.org/kuenstliche-intelligenz-winter-oder-sommer/#comment-173665
Die physisch vorhandene Geldmenge, in der Form von Geldscheinen und Münzen, ist beschränkt – und weit geringer als die fiktiv vorhandene Geldmenge.
Durch ein Ersetzung dieses Geldes durch Bitcoin, würden dann vermutlich anschließend die Banken als sogenannte Coinbörsen und Wallet-Verwalter dienen (oder diese die Rolle von Banken übernehmen), die dann die Bitcoins der eigentlichen Besitzer verwalten. Wobei die Konten einiger dann Guthaben (in der Währung Bitcoin) und andere Schulden (in der Währung Bitcoin) auf ihren Konten haben werden. Die Banken sollten dann doch sicherlich kein Problem haben, Kredite in der Währung Bitcoins auszugeben, wobei dieses natürlich – so wie die Ausgabe von Geld an Geldautomaten – nur „physisch“ geht, solange man noch selbst über eine Menge an Bitcoins verfügt, aber bei Transaktionen (Zahlungsverkehr) von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto (egal ob beide Konten bei der gleichen oder unterschiedlichen Banken sind) findet kein physischer Austausch von Geld statt.
Die Vermögenswerte werden dann in Bitcoins bemessen (und nicht mehr z.B. in US-Dollar). Der Effekt gegenüber dem IST-Zustand wäre dann also maximal die Einführung einer globalen Währung (und das einige Staaten, welche vorher noch „Geld“ drucken konnten, um Teile ihrer Schulden zu bezahlen und die Schuldenlast durch Geldentwertung der eigenen Währung zu drücken, dieses dann nicht mehr direkt können).
„Raider“ wäre damit in gewisser Weise zu „Twix“ geworden und vieles würde sich dadurch auch nicht zum besseren ändern. (Und das ohne den momentanen Stromverbrauch für Bitcoin-Transaktionen zu berücksichtigen).
Also vielleicht noch Mal richtig die mutmaßlichen Vorteile von „Bitcoin“ herausarbeiten (und auch nicht die Nachteile vergessen zu erwähnen) und warum mit „Bitcoin“ das momentane System nicht aufrechterhalten werden würde.
Die neoklassische Schranke, die Geld nur als Warenersatz wie Vollgeld ansieht, wird dadurch nur verstärkt. Und damit wird das zentrale Problem, dass der Markt Zahlungsmittel zunehmend ungleich verteilt, nur.umso größer.
Das heißt nicht, dass die derzeitige Form der Geldschöpfung in ihrer Verwendungsform schon richtig ist.
Richtig wäre sie nur, wenn sie die Marktunfähigkeiten ausgleicht oder zumindest erheblich reduziert. Aber dafür muss man strukturelles Marktversagen erst einmal konstatieren. Und dafür fehlt es schon.
Sehr fundierte und gute Kritik. Das ist leider bei vielen Themen so, dass die Beiträge da aufhören wo sie an sich beginnen müssten. Ich nenne es immer auf Meta-Ebene verbleiben.
Man könnte auch das klassische Geldsystem, wenn man wollte ohne weiteres beschränken, die Golddeckung war ein versuch in diese Richtung. Der Vorteil von Geld ist, ich muss nicht Ware gegen Ware tauschen, was viele praktische Vorteile hat. In jetziger Form hat es aber keinen echten Wert. Es ist lediglich eine allgemeine stillschweigende Übereinkunft so zu tun als hätte es einen Wert.
Wenn man mit Geld Arbeitszeit, Waren oder Anlagegüter kaufen kann, hat es trotzdem keinen Wert?
Was ist „Wert“ und wie ist dieser einzuordnen, um nicht als „Heilige Kuh“ zu gelten?
Warum empfahl einer der wichtigsten Matweialisten, von der Vergötzung des „materialistischen“ Wertmaßstabes die Finger zu lassen?
Das letzte Hemd hat keine Taschen.
Genau 🙂
Das sollte sich der ein oder andere vielleicht ab und an mal klar machen.
https://youtu.be/PciJreaXQH4?si=lbYXCWnXkS_HvrUN
Randnotiz: 50 000 Dollar für eine Niere
https://www.aerzteblatt.de/archiv/randnotiz-50-000-dollar-fuer-eine-niere-5b174677-5c39-41f8-b5d8-3333b65b4eb5
.
„Das letzte Hemd hat keine Taschen.“
Die Taschen meiner Kinder als Erben sind grösser als mein letztes Hemd.
Ich werde nichts vererben.
Ich werde mein Hab und Gut dem schenken der mir die letzten Jahre am meisten geholfen hat.
Wann ist denn dein Todestag?
Das System heißt Kapitalimus, was hier nicht mit einem Wort erwähnt wird.
Wer denkt mit Geld mehr Geld machen zu wollen ist ein Kapitalist.
Kapitalimus basiert auf ewigem Wachstum und Profit.
Kapitalismus führt immer zur Akkumulation des Kapitals bei ein paar Wenigen.
Kapitalismus im Endstadium führ zyklisxch immer zu Kriegen, Inflation und Währungsreformen,dem so genannten Reset, bei dem sich immer große Teile des Besitzes der Bürger in die Hände der herrschenden Klasse fällt.
Ich frage mich ja immer, was das „immer mehr haben wollen/müssen“ bei den Reichen und Superreichen auf sich hat: auch die können den Kaviar immer nur einmal fressen, einen Rolls Royce selber fahren und eine Exklusiv-Reise zum Mars erleben😉? Wann also ist es genug?? Hat man nicht vor allzulanger Zeit herausgefunden, dass nach Stillung elementarer Bedürfnisse und ab einer bestimmten Geldmenge das Glück nicht mehr wächst? Überhaupt: kann echtes Glück mit Geld erworben werden?
Es heißt schon sehr lange: Geld macht nicht glücklich,
aber es beruhigt. Ich kann mit einem Klumpen Gold, einem Diamanten
oder mit einem Fass Öl kein Brötchen kaufen. Ich kann aber mit Geld
einen Klumpen Gold, einen Diamanten und auch ein Fass Öl kaufen
und auch noch zum Bäcker gehen und ein lecker Brötchen kaufen!
Also für einen Diamanten verkaufe ich sogar zwei Brötchen. Deal?
Schon klar, aber reicht nicht die Geldmenge, um sagen wir 10 Klumpen Gold, 10 Diamanten und 100.000 Ölfässer zu kaufen und mit dem Rest gut zu leben? Warum müssen es 100 Klumpen Gold, 100 Diamanten und 1 Mio. Fässer Öl sein, wenn ich meine Lebensqualität und Zufriedenheit dadurch um kein Jota steigere? Aber ich weiß natürlich schon, es ist die Gier, das Grundproblem aller Probleme.
Suchtkranke, die an einer gesellschaftlich angesehenen Kultur-„Krankheit“ laborieren, haben doch nahezu keinen Interventionsspielraum. Auch gibt es gewissen sozialen Druck, mehr haben zu müssen. Und auf kleiner Flamme gibt es die Notwensigkeit, Zahlungsmittel zu erwerben, um überhaupt einigermaßen vernünftig leben zu können.
Es geht mittlerweile nur noch um Konsum. Die Leute sollen andauernd und ungehemmt konsumieren und dadurch „glücklich“ werden. Werden sie natürlich nicht.
Es ist dieses ungehemmte, gierige und verselbständigte, was mir sehr übel aufstößt.
Da ist kein Innehalten und kein Nachdenken mehr.
Und Kritiker kann man nur schlecht konsumieren, daher werden sie konsequent ignoriert oder angefeindet. Im Prinzip müsste erst der ganze Konsumapparat zusammen brechen, bis die Menschen anfangen, über etwas anderes nachzudenken.
Der Film „Matrix“ hatte schon etwas prophetisches…
@ Eric Meyer
„Die Leute sollen andauernd und ungehemmt konsumieren und dadurch „glücklich“ werden.“
Nein, das sollen sie nicht! Sie sollen nur den Glauben hegen, glücklich zu werden! Wenn nämlich der Glaube bzw. das Vertrauen ins Geld verloren geht, dann implodiert das System, welches nur einige Wenige glücklich, weil mächtig macht! Es ist nur eine Nebelkerze, welche die zugrunde liegenden faschistischen Züge verdecken soll. Geeignet um Schaumschläger an der Macht zu halten. So ersparen sie sich ständige Lobhudelei ihrerselbst, welche die ganz kleinen Lichter dieser Welt wie ein „Luck“ dann mit viel Selbstberäucherung wettzumachen versuchen, aber meist damit scheitern.
Fazit: Die heutige Fixierung allein aufs Geld erspart den profitierenden Egomanen schlussendlich die Endstation „Klapse“, wohin sie bei klarer, nicht nebelverhangener Sicht hingehören. Weshalb auch sämtliche Formen von Gemeinwohl mit sämtlichen Tricks und härteren Gangarten bis hin zum Krieg unterbunden werden, sobald sie an den Festungen des globalen Großkapitals auch nur kratzen. Im genau kontrollierten und eng abgesteckten Rahmen ist natürlich vom Gegenteil die Rede, um ja nicht zu viele Gegenreaktionen vom Fußvolk zu provozieren. Eine gigantische Show, bei welcher Schauspieler natürlich im Vorteil sind…
Ja das liebe Kapital.
Kapital seit seiner kreiierung ist das Makel jeglicher vernünftigen Zusammenkunft, für ein zivilisiertes zusammenleben.
Muss das so sein?
Natürlich nicht, ein ziviliertes Zusammensein ist immer möglich, das hängt aber davon ab, wie die deweiligen Zivilisationen etwa verstehen was Zivilisation bedeutet. Da liegt ein Fall vor, das die Menschheit seit ‚ihrer Zivilisation‘ ,etwas missverstanden hat, sie wurden seit Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten manipuliert. Das Geld wurde erzeugt, um Dinge auszutauschen…
Der Mensch an und für sich, benötigt genügend Tauschmittel ,um seine Familie oder Träume zu erfüllen.
Das was ich seit +40 Jahren sehe, ist eine ideologische Obszönität, das Geld etwas besseres schaffen könnte, als der Mensch könnte.
Diese Fiktion vom Kapital, ist der Grund, warum wir uns in dieser Situation befinden.
Ein Kapital das als der Oberfaschist dasteht und alle machen mit.
Die Dummheit zu diesem Phänomen liegt in der anhaltenden dauer Propaganda…
Nur der Mensch kann die irrsinnigen politischen, medialen Vorgaben ändern, in dem dieser sich gegen den gelebten Irrsinn vorgeht..
@ Pro1
Neben den Ausführungen von Miri ist Ihr Kommentar hier der einzige, welchen ich weitestgehend mittragen kann.
Nur sehe ich nicht das Kapital als solches als Oberfaschisten an, sondern als Mittel, um Faschismus zu tarnen und gleichzeitig auf einige wenige Egomanen zu konzentrieren, um Macht zu legitimieren & zementieren; nahezu unabhängig von Gesetzen, welche für den Rest der Welt gelten (sollen).
Den Rest Ihrer Aussagen gehe ich bis auf eine Naivität mit, nämlich jener nachdem „Nur der Mensch die irrsinnigen politischen, medialen Vorgaben ändern kann, in dem dieser sich gegen den gelebten Irrsinn vorgeht.“
Hierfür wäre zumindest eine gewisse Einigkeit unter 7 von derzeit 8 Mrd Menschen nötig, welche dann noch organisiert werden müsste. Aus meiner Sicht ist schon die Einigkeit in dieser Größenordnung kaum vorstellbar und die Organisation schon gar nicht.
Die derzeitigen Nutznießer der bestehenden Verhältnisse sind sich schon sehr viel einiger und um Längen besser organisiert. Nur der Ansatz eines Versuchs, eine bis dato nur theoretische Einigkeit in der Praxis zu organisieren, scheitert bereits an der immer lückenloseren Kontrolle und entsprechenden Gegenmaßnahmen diverser Art und Weisen, welche hier aufzuzählen bereits reine Sisyphusarbeit wäre – allein die Aufzählung! Dazu käme ein Zeitrahmen für tatsächliche Änderungen, welcher unsere aktive Lebenszeit von vielleicht 50 Jahren sprengen würde und sich somit dem Interesse der „Veränderer“ baldigst entziehen würde. Wem sind die Nachfolgegenerationen schon wichtiger, als die überschaubaren Zyklen der eigenen Lebensspanne? Die Frage, welche sich zwangsläufig stellt ist doch: Was habe ich davon? Und die realistische Antwort wäre: Nichts, außer Nachteilen. Deshalb ist doch die Elite trotz besseren Wissens bestebt, den zwangsläufigen Untergang nicht nur hinzunehmen, sondern noch zu forcieren, denn die bereits heute Lebenden betrifft es doch noch am wenigsten: Solange es mir gut geht, nach mir die Sinnflut. Just a thought…
P.S.: Wer wäre heute schon bereit, als Pionier einen fiktiven, aber mindestens 30 Reisejahre entfernten Planeten erstzubesiedeln, damit für künftige Generationen eventuell eine Basis für den Fortbestand der Menschheit besteht? Derjenige müsste hier auf Erden schon absolut chancenlos & verzweifelt sein, in allen Belangen & ohne jegliche Hoffnung, nicht wahr? Eine deutliche Mehrheit würde sich selbst bei technischer Machbarkeit nicht finden – schon gar nicht, wenn es alle maßgeblichen Mächte & Instanzen mittels Kontrollen und immer schärferen Gesetzen und Strafen bekämpfen würden, um ihre Untertanen nicht zu verlieren.
Ich stelle fest:
Das Geldsystem-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der staatlich verordneten Bildungsverwahrlosung (Axiome) wirkt.
Die Promovierungen sind nur möglich, wenn man die Axiome nicht hinterfragt!
Das Geldsystem, Weltwährung Buchungsziffern mit länderspezifischen Eigennamen, ist zur Abdeckung des Leistungsaustauschgegenwerts, die genialste Errungenschaft.
Man kann das bereitgestellte Geldvolumen nur einnehmen, wenn es vorher ausgegeben wird! Konsum hin oder her!
Die Organisation, einerseits als eigenes Gewerbe und andererseits als Schuld- und Verzinsungskonstrukt, suggeriert einen Zahler, welcher nicht existent sein kann. Die Organisation erfüllt glasklar eine Gemeinschaftsaufgabe, die praktizierte Umsetzung ist schlichtweg Satanswerk. Dieser Betrug wäre in einem Rechtstaat niemals möglich!
Weder das Geld- noch Staats- und Sozialwesen kann als intermediäre Funktion gelten, es wird jedoch entsprechend modelliert, damit die Sektenmitarbeiter für die Sekte Rechtstaat, die Demokratie als Spielwiese benutzen können.
Niemand auf der Welt finanziert die Banken oder den Staat und das Soziale, weil mit der Geldentstehung der Gegenwert für sämtliche Wirtschaftsfaktoren enthalten sein müssen.
Die anteiligen Wirtschaftseinnahmen als Gegenwert der Leistung für das Gemeinwohl und Soziale ist direkt zwischen Wirtschaft und Staat umzulegen und nicht wie betrügerisch praktiziert über das Erwerbseinkommen und erfundenen Substraten!
Leider wird die Bildung vom Staat diktiert, damit die Macht, ihre Ausstrahlung nicht verliert! SEKTE!
Nachdenken könnte helfen, wie Geld entsteht und sich auswirkt, denn es muss vorher „erzeugt“ sein, bevor es umgelegt werden kann. Wir leben nicht in Höhlen, alles was wir aus der Natur veredelt sehen, wurde mit dem Gegenwert Geld erschaffen!
Der Parameter Gold, diente der Höhe des Geldvolumens, eine Idiotie der Extraklasse, denn wer konnte Gold erwerben?
Wer in Fiatgeld ein Problem sieht, wird ohne ein solches vor erheblich massiveren Problemen stehen.
Dafür müsste man aber in differenzierender Saldenmechanik etwas fitter als ein Flassbeck sein.
Jeder Schuld steht.eine Forderung gegenüber. Diese Gläubiger haben kein Interesse daran, ihre Forderung sofort zurückbezahlt zu bekommen.
Es gibt sehr.wohl (massive) Restriktionen bei der Giralgeldschöpfung. Wer sich mal mit dem Thema Marktfolge beschäftigt hat,. weiß davon.
Entscheidend für das Wohl oder Wehe des Geldsystems ist die Zinshöhe und nicht der Zinseszins. Wer aber an schon an ganz einfachen Äquivalenzumformungen scheitert, kann und.wird das nicht kapieren.
Auch bei einem Nullwachstum wächst das nominale BIP, weil die Inflationsrate in aller Regel höher als Null ist. Mit der Inflationsrate wird übrigens die Konsumgüter-Inflation nach Warenkorb gemessen und keine Asset-Inflation.
Investmentbanken kaufen hoch gehebelt mit Krediten Anlagevermögen, um durch dessen überproportionale Wertsteigerung neben den Zinsen auch noch Gewinn zu erzielen.
Eine vernünftige Gesellschaft konzentriert sich weniger auf die Schaffung abstrakten Reichtums, sondern versucht, diesen konkret für deren Mitglieder real werden zu lassen, indem die Lebensverhältnisse gesichert und planbar werden und nicht vom Marktgeschehen und dessen Logik abhängig sind.
Und dafür kann dann das Geldsystems in der Weise reformiert werden, dass die Fiat-Money-Fähigkeiten für die vom Markt Benachteiligten genutzt werden.
Das wäre der entscheidende Einstieg in den Ausstieg vom Kapitalismus.
Man würde sich als Teil eines Ganzen begreifen und nicht als Monade, die in ewiger Rivalität um das Dasein kämpfen muss, wobei dieses Kämpfen vor allem eine Dauerbelastung in Form von Stress darstellt, welcher gerade nicht zum Akteursstein anspornt. Man ist sonst weiterhin nur passiver Knecht einer weltlichen Gottheit mit der faden Beigeschmack, periodisch ihre Opfergaben zu fordern. Dabei gäbe es diese Gottheit ohne den Wahn der Rivalität gar nicht.
Aber Weisheit wächst weder auf Bäumen, noch gedeiht sie alleine im Gehirn. Eine herzlose Welt hat somit schlechte Perspektiven.
Fiat eine Erfindung der einfältigen Ökonomen, welche das Geldsystem aus staatlich verordneten Axiomen, nicht begreifen dürfen.
Die derzeit umgesetzte Weltwährung Buchungsziffern mit länderspezifischen Eigennamen, wird als Gegenwert irgendeiner Leistung „erzeugt“. Eine geniale Erfindung, wäre die Organisation korrekt und nicht als Betrugsform „Gewerbe, als Schuld- und Verzinsungskonstrukt!“
Die Banken als Geldmonopol (Geldquelle) verkörpern systembedingt, keine Wirtschaftsunternehmen! Sie erzeugen keine Verbindlichkeiten, sondern ermöglichen den Leistungsaustausch. Eine klare Gemeinschaftsfunktion!
Es handelt sich bei der Bereitstellung und Administration des Geldsystems um eine Gemeinschaftsaufgabe. Auf der einen Seite der Medaille der Beschaffungsgrund und auf der anderen Seite der Leistungsgegenwert in gleicher Höhe!
Auch der Staat schöpft bei einer Verschuldung Geld.
Bei der Schöpfung von Giralgeld kommt es entscheidend auf die Verwendung an, ob damit Wohlstand geschaffen oder dieser eher verhindert wird. Denn Asset-Inflation hat durchaus diesen sauren Beigeschmack. Und zwar immer mehr und stärker.
Wirtschaften auf eigene Rechnung kann, muss aber nicht dem Allgemeinwohl dienen. Entscheidend sind die Ausgangsvoraussetzungen.
Für jeden Dialektiker sollte das Routine sein. Ist es aber leider nicht.
„Auch der Staat schöpft bei einer Verschuldung Geld.
Bei der Schöpfung von Giralgeld kommt es entscheidend auf die Verwendung an, ob damit Wohlstand geschaffen oder dieser eher verhindert wird.“
Mein Verdacht ist, dass Mittelherkunft und Mittelverwendung in Verbindung stehen.
Der Staat verschuldet sich auf dem Sekundärmarkt, statt bei der eigenen Zentralbank, also bei privaten Geldinstituten.
Deren Eigentümer sind vermutlich auch in anderen Bereichen investiert, wie z.B. der Rüstung/ Pharma/ Klimawandel etc. und machen womöglich den Kauf von Staatsanleihen von entsprechenden Ausgaben des Staates abhängig.
Würde der Staat sich bei der eigenen Zentralbank verschuldung, wäre sieser Einfluss obsolet und es müsste nicht mal ein Zins fällig werden, da die Überschüsse der ZB am Ende eh wieder beim Staat landen.
Die Kosten der ZB werden durch die Seignorage beglichen.
Man könnte sich auch fragen, ob es überhaupt private Geschäftsbanken geben muss, denn den Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe könnten auch Filialen der ZB übernehmen und die Spekulation könnte man getrost Investmentbanken auf eigenes Risiko überlassen.
Warum wird diese Überlegung überhaupt nicht angestellt?
Eine ordentlich aufgestellte Zentralbank-Ablegestelle mit vielen Filialen könnte durch Insolvenz zur Verwertung anstehende Aktiva auch besser verteilen und somit einen höheren Verkaufserlös erzielen, weil man wissen würde oder zumindest könnte, wo diese am besten einsetzbar wäre.
„Warum wird diese Überlegung überhaupt nicht angestellt?“
Reiche Kaufleute, wie die Fugger oder Wälser z.B. haben seit Jahrhunderten die teuren Spielereien des Adels ( Prachtbauten, Kriege etc.) finanziert und sich damit das Privileg der Kontrolle über das Geldsystem abgetrotzt.
Die Inhaber dieser Banken werden Alles tun, dass an diesem Privileg nicht gerüttelt wird.
Der Adel mag mittlerweile an Macht verloren zu haben, wurde aber ersetzt durch korrupte Parteien in Pseudo-Demokratien, welche ihre „Legitimation durch Wahlkomödien“ im Sinne der Finanzakteure mindestens genauso dreist misbrauchen, die Majorität der Gesellschaft auszuplündern.
Sind Partikular-Interessen oder das Gemeinwohls in einer Demokratie ausschlaggebend?
Dass Einzelinteressen als dem Gemeinwohl dienlich interpretiert werden, ist ja nicht neu. Es geht aber darum, den Schwachsinn dieser Mär aufzudecken.
Grundsätzlich geht es darum, dass eine Gesellschaft so organisiert ist, dass die menschlichen Bedürfnisse gedeckt werden. In einer marktwirtschaftlichen Ordnung müssen diese Bedarfe dann als Nachfrage zur Geltung kommen können.
Dafür braucht der einzelne Marktteilnehmer dann ausreichend Kaufkraft.
Diese wird aber immer mehr verwehrt, obwohl sie sich mit dem Verkauf ihrer Arbeitskraft ausreichend einbringen.
Und dieses Problem ist marktstrukturell (lim: economies of scale) und kann nur administrativ behoben werden.
Ansonsten wird diese Gesellschaft zugrunde gehen und es wird nahezu jeden treffen. Auch die Reichen, die glauben, von einer funktionierenden Gesellschaft nicht abhängig zu sein.
„Sind Partikular-Interessen oder das Gemeinwohls in einer Demokratie ausschlaggebend?“
In einer Demokratie, welche diesen Namen verdient, natürlich das Gemeinwohl.
Nur haben wir eben eine enge Verflechtung zwischen Kapital und Politik, unter Mussolini gemeinhin „Faschismus“ genannt.
²Dass Einzelinteressen als dem Gemeinwohl dienlich interpretiert werden, ist ja nicht neu. Es geht aber darum, den Schwachsinn dieser Mär aufzudecken.“
Dazu müsten die weitreichestarken Medien aber tatsächlich neutral sein, was sie nicht sind.
²Auch die Reichen, die glauben, von einer funktionierenden Gesellschaft nicht abhängig zu sein.“
Das wissen die schon, nur würden sie sich gerne der „Unnötigen“ entledigen, bevor diese auf die Barrikaden gehen und ihr Besitzstandsmonopol angreifen.
Die Reichen bräuchten durch einen entsprechenden Obolus doch nur das Funktionieren der Gesellschaft gewährleisten und schon wird das (relative) Monopol nicht infrage gestellr.
Ansonsten wird etwas mehr infrage gestellt werden.
Mit den richtigen Fragen und einer entsprechenden Verve wohlgemerkt.
„Die Reichen bräuchten durch einen entsprechenden Obolus doch nur das Funktionieren der Gesellschaft gewährleisten und schon wird das (relative) Monopol nicht infrage gestell.“
Müssen die ja nicht, wei seit dem Zusammenbruch des Ostblocks ihr Kapital auf der Jagd nach den höchsten Profiten global vagabundieren kann.
Nur für die Lohnabhängigen gibt es Grenzen.
Der Ursprungsstaat, welcher die Entwicklung großer Kapitalien erst ermöglicht hat, soll seine Leistung auf den Schutz der Ausbeuter reduzieren.
Der Kettensägenmann läßt grüßen. 😉
Nein, der Staat ist, wie wir Bürgerinnen und Bürger auch, nur der Geldumleger! Das Geld wird vom betrügerisch als eigenes Gewerbe als Schuld- und Verzinsungskonstrukt konzipiertes Bankensystem, bereitgestellt!
Metapher: „Es ist wie damals im Sandkasten (Bankensystem), man kann nur mit dem vorhandenen Sand (Geldvolumen) Burgen (Bedürfnisse abdecken).“
Das Geldsystem-Alzheimer-Symptom als Ergebnis der staatlich verordneten Bildungsverwahrlosung, wirkt weltweit, denn 99,9% der Mitmenschen sind der festen Überzeugung, sie würden ihr Geld einerseits den Banken zur Ermöglichung ihre Aktivitäten überlassen und andererseits Steuern und Soziales aus ihrem Einkommen bezahlen. Die Irreführung, wonach die Rente von Aktiven «finanziert» und der Staat seine Aktivitäten mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger abdeckt, ist sehr einfach zu erkennen, denn mit der Hinzufügung dieser Geldquoten zum Erwerbseinkommen, wird die indoktrinierte Fiktion modelliert. Die Menschheit ist verblödet, merkt diesen Schwindel der Ökonomie und Justiz nicht!
Systemisch unmöglich, ist jedoch dem Vernehmen nach, staatlich verordnete Wissensvermittlung. Wer die Axiome hinterfragt, hat keine Chance die Promovierung zu erhalten, demnach müssen sich die Wissensvermittler «schizophren» verhalten.
Noam Chomsky:
«Die Mehrheit der Bevölkerung versteht nicht was wirklich geschieht. Und sie versteht noch nicht einmal, dass sie es nicht versteht.» .» Anders formuliert: «Der Mensch weiss nicht, dass er die Wahrheit nicht kennt!»
„Das Finanzsystem ist unbegrenzt. “
Nein, ist es nicht !!
Schon man versucht Geld zu essen ?
letztens hab ich n sofa gegessen. hmmmm.
Früher galt Schuldenerlass als notwendiges Mittel, um überschuldeten Staaten wieder Luft zum Atmen zu geben und ihnen einen wirtschaftlichen Neuanfang zu ermöglichen. Heute hingegen geschieht er fast ausschließlich unter harten Auflagen, die von Institutionen wie IWF, Weltbank oder der EU diktiert werden. Diese Bedingungen beinhalten meist drastische Sparprogramme, Privatisierungen und Kürzungen bei Sozialleistungen – Maßnahmen, die die Lage der Bevölkerung verschlechtern, statt sie zu verbessern. Der eigentliche Zweck eines Schuldenschnitts, nämlich die Befreiung aus der Schuldenfalle, wird so ins Gegenteil verkehrt. Dies ist weniger ökonomischer Vernunft als vielmehr bestehenden Machtverhältnissen geschuldet.
Die Schuldenfalle exisstiert und der einzige Ausweg ist Schuldenerlass, wie Sie richtig erwähnt haben. Warum wird das nicht mehr praktiziert? Weil es nicht die Geldmenge erhöht. (Nur ein positiver Posten verschwindet aus der Bilanz der Banken.) Bei Umschuldung werden aber neue Schulden gemacht und das ist zum Vorteil des Finanzsystems. Alle Schulden, besonders alle Staatschulden,. sind zum Vorteil der Geldbesitzer und zum Nachteil der Schuldner. Das ist so einfach, dass Mohammed es schon erkannt hat. Er konnte sich aber nicht durchsetzen.
An Miri und alle Bitcoin-liebhaber
Immer wieder tauchen bei meiner Aufklärung über das Finanzsystem Fans von Bitcoin auf, zum Beispiel Miri, die Bitcoin als Alternative zum bestehenden Finanzsystem darstellen wollen. Das ist Unsinn. Bitcoins sind kein Geld, sondern Spielgeld. Für Geld fehlt dem Bitcoin und den anderen Krypto-Währungen erstens ein fester Wert und zweitens die allseitige Akzeptanz.
Der Wert ist wie bei Briefmarken oder Kunstgegenständen von der Marktlage abhängig; denn er ist eine Funktion des Handels, ähnlich Aktien und deshalb ist er auch an der Börse gerne gesehen.
Die Akzeptanz aber ist ist der größte Schwachpunkt. Nur wenige akzeptieren Bitcoin und die Art wie er per Zufall generiert wird. Auch die Blockchain-Technik wird nicht akzeptiert, weil Zahlungen nicht für jeden objektiv verfolgbar und nachweisbar sind. Dazu benötigt man eine zentrale Instanz, die notfalls für Rechtssicherheit sorgt.
Bitcoin funktioniert nur in einer Community der Wolwollenden oder Gutmenschen oder Fans, nicht als Geld für den gesamten internationalen Markt.
Ich habe das schon vor Jahren ausführlich dargelegt und kann das nicht in jedem Artikel wieder erwähnen. Bitcoin-Krypto-Blockchain-Geld https://kritlit.de/tdt/bitcoin.htm
Beste Grüße
Rob Kenius
Soweit ich das sehe, würde ich folgendes festhalten:
– das Fiat-Money-System ist NICHT das Problem (Zahlen gibt es genug)
– das Problem ist ein Wirtschaftssystem, das eine Umverteilung von unten nach oben erzwingt oder zumindest begünstigt
-> ein Verteilungsproblem durch Besteuerung zu lösen, halte ich im Grundsatz für möglich, auch wenn dies von wesentlichen Akteuren nicht gewollt ist und daher verhindert wird
👍
Auch Kapitalismus genannt.
Muss ich zu erwähnen wohl vergessen haben. 😉
+++
Vermögensbildung als Anreiz für Entwicklung muss sein, aber gleichzeitig so gedeckelt, dass es keine zerstörerische Macht erreicht.
Das gelingt aber nur über echte demokratische Kontrolle.
Danke Alex-R. Ihr Kommentar ersetzt hier alle anderen Gedankengänge!
Eine Besteuerung großer Vermögen wäre nur im Rahmen einer Änderung der Machtverhältnisse möglich. Denn freiwillig wird hier nichts versteuert, eher hinterzogen. Gerne auch verrechtlicht (verrechtlichte Kriminalität) oder ohne diesen Anspruch, offen illegal, gleich scheißegal.
Wären die Machtverhältnisse tatsächlich mal dahingehend gekippt, kann man sich das Besteuern sparen und das Raubgut auch gleich wieder vergesellschaften. Es also in die Obhut derer befördern, denen es gestohlen wurde.
Das Wirtschaftssystem wird vom Geld und dem Streben nach Geld gesteuert. Weil es aber Geld im Überfluss gibt, ist die feudale Finanzmacht immer am längeren Ende des Hebels. Warum kaufen Firmen ihre eigenen Aktien, anstatt die Produktion zu verbessern? Weil sie dann im Geldsystem mitmischen und dort höher bewertet werden. Warum zahlt Daimler-Benz viel zu hohe Dividende? Damit der Börsenwert steigt. Alles bezieht sich auf das Finanzsystem, es gibt kein Wirtschaftssystem, das darüber steht.
Beste Grüße
R.K.
Das nennt man Kapitalismus !
@Alex_R: Dein Ansatz verkennt die Ursache. Steuern können die Umverteilung nicht lösen, weil sie **Teil des Mechanismus** sind, der sie überhaupt erzeugt. Im heutigen Schuldgeldsystem wird Geld über Kredite geschaffen, auf die Zinsen fällig werden – gezahlt vor allem von unten, während die Erträge oben landen. Ein Großteil der Steuern fließt zudem in Schuldendienst, Subventionen und Strukturen, die Vermögende begünstigen. Die Umverteilung ist kein Fehler, sondern eine Systemfolge. Ohne das System selbst zu ändern, bleibt jede Steuerpolitik wirkungslos.
@Miri: Wenn Sie mir etwas empfehlen können, wo das ausführlich (möglichst mit Zahlbeispielen) dargelegt wird, dann würd ich mir die Argumentation gerne mal näher ansehen, sei es eine Website oder ein Buch.
Aber weder überzeugt mich der Text, noch die Diskussionsbeiträge hier im Forum, die bleiben mir alle zu sehr an der Oberfläche.
Bis dahin aber gilt: Bevor mir jemand seine These nicht klipp und klar vorrechnet, bin ich nicht überzeugt, dass dort das Problem liegt.
@Alex_R: Wenn Sie das Thema wirklich mit Zahlen sehen wollen, empfehle ich, sich einmal die Mechanik der Geldschöpfung konkret anzuschauen – das ist der Schlüssel. Ein kurzes Beispiel:
Angenommen, eine Bank vergibt einen Kredit über 100.000 €.
Diese 100.000 € entstehen neu durch Buchung, sie waren vorher nicht da.
Der Kreditnehmer muss aber 100.000 € + Zinsen zurückzahlen, z. B. 5 % = 105.000 €.
Diese zusätzlichen 5.000 € existieren bei Kreditvergabe noch nicht. Damit sie überhaupt zurückgezahlt werden können, muss irgendwo anders neues Geld entstehen – also weitere Kredite.
Das System erzeugt dadurch einen permanenten Wachstumszwang: Ohne neue Schulden kollabiert der Geldkreislauf.
Was passiert mit den Steuern?
Der Staat verschuldet sich ebenfalls, oft in Milliardenhöhe.
Ein erheblicher Teil der Steuereinnahmen fließt nicht in Infrastruktur oder Soziales, sondern in Zinszahlungen und Subventionen, die Großkapital und Banken begünstigen.
Laut Bundeshaushalt 2024 gehen über 40 Mrd. € allein in Schuldendienst – Geld, das direkt nach oben umverteilt wird.
Quellen dafür:
Deutsche Bundesbank: Geld und Geldpolitik (kostenloses PDF)
Richard Werner – Prinzip der Geldschöpfung
Joseph Huber – Monetäre Modernisierung
@Miri: Alles das ist mir bekannt, trotzdem vielen Dank für die ausführliche Erläuterung.
Allein: ich sehe nicht die Zwangsläufigkeit eines Kollapses.
Die ist es, die ich begründet sehen möchte. Und außer der Behauptung, das „sei doch logisch“ (nicht von Ihnen, aber andere an anderem Ort), hab ich nichts gesehen, das mir plausibel erschien.
@Alex_R
Ich habe die Mechanik und die daraus resultierende Wachstumsabhängigkeit so präzise wie möglich dargestellt. Wenn wir uns einig sind, dass Geld durch Kredit entsteht, Zinsen zusätzliche Rückflüsse erfordern und diese Zinsen nur durch neue Geldschöpfung gedeckt werden können, dann folgt daraus logisch, dass das System dauerhaft auf Expansion angewiesen ist.
Der Punkt, an dem diese Expansion an ihre Grenzen stößt – Ressourcen, Produktivität, Demografie –, ist kein politischer Streitpunkt, sondern eine mathematische Konsequenz. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie lange sich das System mit Hilfsmitteln wie Inflation, Zentralbankinterventionen oder Schuldenerlassen stabilisieren lässt. Aber irgendwann erreichen diese Instrumente ihre Grenzen, weil der zugrunde liegende Mechanismus unverändert bleibt.
Wenn Sie anderer Meinung sind, wäre es interessant zu hören, welches Modell Sie stattdessen plausibel finden. Denn ohne eine alternative Erklärung für die Stabilität eines wachstumsabhängigen Schuldgeldsystems kann ich an diesem Punkt nicht mehr präziser werden, als ich es bereits getan habe.
„Das System ist infolge mathematischer Konsequenz auf Expansion angewiesen.“
Dem stimme ich zu, soweit es die finanziellen Zahlgrößen betrifft. Dass dies zwingend einherginge mit einer Expansion in Hinsicht auf Ressourcen, würde ich bestreiten. Im Gegenteil kann es sogar sein, dass infolge von Produktivitätszuwächsen das nächste gleichwertige Handy sogar weniger Ressourcen und Arbeitszeit benötigt, als die vorangegangene Generation.
@Alex_R: Ihr Argument klingt auf den ersten Blick schlüssig, greift aber an einer entscheidenden Stelle zu kurz: Sie betrachten das Wachstum der Geldmenge aggregiert, aber nicht asymmetrisch. Und genau dort entsteht der eigentliche Kollaps – nicht in der Gesamtzahl der Euro, sondern in der Verteilung der Kaufkraft.
Wenn Banken neue Kredite vergeben, entsteht neues Geld. Dieses Geld fließt jedoch nicht gleichmäßig in alle Schichten, sondern dorthin, wo Sicherheiten existieren: Immobilien, Aktien, Unternehmensübernahmen. Wer bereits Vermögen hat, bekommt mehr Kredit, bessere Konditionen, niedrigere Zinsen. Wer kein Vermögen hat, trägt die Last steigender Preise – ohne Zugang zum Hebel der Geldschöpfung. So wachsen die Vermögen oben exponentiell, während die Kaufkraft unten stagniert oder sinkt.
Das erklärt auch, warum sich Ihre Annahme „mehr Geld = gleiche Verteilung + etwas Inflation“ in der Realität nicht bestätigt. Der Effekt ist sozial segmentiert:
Oben wachsen Assets und Erträge, weil neues Geld direkt dort hineinfließt.
Unten steigen Lebenshaltungskosten, während Löhne nicht mithalten.
Der Mittelstand finanziert die Differenz über Kredite, was die Abhängigkeit verstärkt.
Besonders sichtbar wird das im Rentensystem: Es basiert auf dem Umlageprinzip, also darauf, dass heutige Beiträge zukünftige Renten sichern. Steigen aber Preise und Assetwerte, während die Löhne real stagnieren, bricht dieses Versprechen schleichend weg. Das System kann sich nicht automatisch an die Dynamik der Geldschöpfung anpassen. Ergebnis: Rentenlücke, Kaufkraftverlust, wachsende Abhängigkeit.
Ihr Szenario vom „kosmetischen Nullsummenspiel“ blendet also aus, dass jeder neue Kredit ungleiche Startbedingungen verstärkt. Mit jedem vergebenen Euro werden die Spielräume der oberen Schichten größer – und die unteren zahlen über Konsumpreise, Steuern und Abgaben ihre eigene Enteignung mit. Das System muss deshalb mathematisch wachsen, ja – aber der soziale Druck wächst asymmetrisch und kumuliert über die Zeit. Genau dort liegt der eigentliche Bruch.
Zumindest verstehe ich nun ihren Punkt.
Dennoch: Verteilungsproblematiken sind zumindest im Grundsatz auf steuerlicher Ebene lösbar, auch wenn das in der Praxis nicht passiert.
Wenn es aber in der Praxis nicht passieren wird und auch sonst keine Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden, scheitert das System. Und das, obwohl es innerhalb des Systems Spielräume gegeben hätte, welche aber aufgrund wissenschaftlicher Doofheit und politischer Ignoranz nicht genutzt wurden.
„Dass dies zwingend einherginge mit einer Expansion in Hinsicht auf Ressourcen, würde ich bestreiten. Im Gegenteil kann es sogar sein, dass infolge von Produktivitätszuwächsen das nächste gleichwertige Handy sogar weniger Ressourcen und Arbeitszeit benötigt, als die vorangegangene Generation.“
Was aber ändert sich am Resourcenverbrauch, wenn zwar das einzelne Handy mit weniger Resourcen auskommt, sich aber die produzierte Menge ( Produktivitätszuwachs ) erhöht?
Produktivitätssteigerung ist etwas anderes als eine Erhöhung der produzierten Menge. Wenn es mir heute gelingt, einen Krug in einer Stunde zu töpfern, obwohl ich gestern noch anderthalb Stunden benötigt habe, dann habe ich meine Produktivität gesteigert. Die produzierte Menge erhöht sich nur, wenn ich anschließend einen zweiten Krug anfange, was ich tun KANN, aber nicht tun muss; ich kann sie aber ebenso einsetzen um meine tägliche freie Zeit zu erhöhen.
Das dürfte unter kapitalistischen Bedingungen wegen Konkurrenzdruck und Gewinnmaximierungs-Zwang aber eher die Ausnahme sein.
Dazu bräuchte es schon eine quasi- Monopolstellung ohne Substitutionsmöglichkeit.
Hier zwei Argumente, warum der Kollaps nicht eintritt:
a) Angenommen, es sind heute 100 Bio € im Umlauf. Nächstes Jahr wird die Geldmenge um 2% erhöht, während die Menge an Waren und Dienstleistungen gleich bleibt, dann beträgt die neue Geldmenge 102 Bio €, die aber den gleichen Wert haben, wie vorher die alte Geldmenge. Die Preise werden steigen und ich werde feststellen, dass mein Geld an Kaufkraft verliert, nämlich um etwa 1,96% (Geldentwertung, Inflation). Ja, das passiert. Es passiert jedes Jahr. Die Preise werden höher. Aber ein Kollaps droht nicht, denn an Zahlen herrscht kein Mangel.
b) Angenommen, ich nehme für den Kauf einer Tafel Schokolade einen Kredit auf i.H.v. 1 Euro, und das zu 900% Zinsen, weil unsere Inflation so riesig ist, dass sie diesen hohen Zinssatz rechtfertigt.
Dann kommen da am Ende des Jahres 9 Euro Zinsen drauf, so dass ich nun 10 Euro Schulden habe, meine Schulden verzehnfachen sich also.
Nach zwei Jahren sind das 100 Euro = 10^2 Euro,
nach drei Jahren 1000 Euro = 10^3 Euro,
nach hundert Jahren 10^100 Euro.
(Zum Vergleich: die Zahl der Protonen im sichtbaren Universum beträgt 10^80.)
Im Januar reden die Leute noch von 10 hoch 100 Euro,
im Februar nur noch von 100 ZehnHochs,
im März von 100 Pfennigen,
und im April werden die 100 Pfennige zusammengefasst zu 1 Mark.
Und was bekomme ich in hundert Jahren dafür: nach wie vor eine Tafel Schokolade.
Es gab einen kosmetischen Bruch mit der Streichung von 98 Nullen (oder 100 bzgl. der Mark), aber keinen Grund für einen echten Kollaps.
@Alex_R: Der entscheidende Punkt ist nicht, ob wir irgendwann bei „10^100 Euro“ oder „1 Mark“ landen. Der Kollaps findet längst statt – nur schleichend und nicht dort, wo Sie hinschauen. Es geht nicht um eine plötzliche Explosion der Geldmenge, sondern um systematische Enteignung von Lebenszeit und um soziale Folgen, die sich in realen Zahlen und menschlichem Leid ausdrücken.
Nehmen wir ein Beispiel:
Jemand arbeitet 40 Stunden pro Woche und verdient 2.000 € netto. Durch Inflation verliert dieses Geld jedes Jahr etwa 5 % Kaufkraft, während Mieten, Energie- und Lebensmittelpreise schneller steigen. Sein Lohn zieht kaum nach, weil neues Geld zuerst bei Großinvestoren und Konzernen ankommt. Ergebnis: Von seinen 40 Stunden pro Woche arbeitet er real vielleicht 15 Stunden nur dafür, die Preissteigerungen auszugleichen, die durch Geldpolitik und Umverteilung entstehen. Das ist stille Enteignung.
Und jetzt kommt der Teil, den Sie völlig ausblenden: das Rentensystem. Es ist strukturell nicht in der Lage, sich an diese Dynamik anzupassen. Die heutigen Beiträge basieren auf dem Versprechen, dass spätere Rentenzahlungen Kaufkraft sichern sollen. Aber dieses Versprechen zerbricht, wenn die Geldschöpfungspolitik die Kaufkraft kontinuierlich erodiert. Jeder zusätzliche Euro, der „nachgedruckt“ wird, entwertet die Rentenansprüche von Millionen Menschen, während die oberen 10 % Vermögen in inflationsgeschützte Assets umschichten. Die Menschen verlieren nicht erst am Ende ihres Arbeitslebens – sie verlieren doppelt: heute ihre Zeit und morgen ihre Absicherung.
Der Kollaps passiert also nicht in der Geldmenge, sondern in der sozialen Realität:
Die Kaufkraft der unteren 50 % sinkt trotz Arbeit.
Rentenversprechen werden systematisch ausgehöhlt.
Neue Kaufkraft fließt dorthin, wo sie nicht gebraucht wird.
Wenn man diesen Effekt ignoriert, redet man an der eigentlichen Krise vorbei. Sie ist nicht „hypothetisch“ und nicht „kosmetisch“. Sie läuft heute, still und unsichtbar, während die offiziellen Zahlen Wachstum simulieren.
Die Frage ist also nicht, ob das System mathematisch „zusammenbricht“. Die Frage ist, wie lange Gesellschaften diesen langsamen Kollaps der Lebenszeit und der Absicherung noch tragen, bevor die politische Stabilität kippt.
„Die Frage ist also nicht, ob das System mathematisch „zusammenbricht“. Die Frage ist, wie lange Gesellschaften diesen langsamen Kollaps der Lebenszeit und der Absicherung noch tragen, bevor die politische Stabilität kippt.“
Richtig.
Ergänzend könnte man auch noch betrachten, wohin sich die offiziellen Wirtschaftsdaten bewegen wie Auftragseingänge der Wirtschaft, Insolvenzen, Investitionen, Differgenz zw. Zahl der Arbeitslosen und offenen Stellen etc..
Die Einnahmen des Staates sinken bei steigendem Schuldendienst, ohne dass die Verschuldung zu nennenswertenm Wachstum führt.
Die Fehlallokation von X-Milliarden € in die Rüstung ist keine wirkliche Investition, sondern Staatskonsum ohne anschließende Wertschöpfung, was zu einem fiskalischen Multiplikator < 1 führt.
https://www.vwl.uni-mannheim.de/media/Lehrstuehle/vwl/Krebs/wirt._Auswirk._Militaerausgaben.pdf
Der Staat wird immer weniger in der Lage sein, den Wohlstand der Gesellschaft zu erhalten oder gar zu erhöhen, weil die Schuldenlast/Zinsen keinen Spielraum für sinnvolle Investitionen mehr lassen und der Zugriff auf die großen Vermögen politisch tabu ist.
https://kritlit.de/tdt/bitcoin.htm
Meine Kritik dazu:
Der Artikel auf kritlit.de versucht, Bitcoin technisch und ökonomisch zu erklären, verfehlt dieses Ziel aber fundamental. Er ersetzt Analyse durch persönliche Vorstellungen, falsche Analogien und unbelegte Behauptungen. Schon zu Beginn fällt auf, dass grundlegende technische Begriffe falsch genutzt werden. Es wird behauptet, Bitcoin werde „nach einem Zufallsprinzip“ generiert und Miner müssten „eine unbekannte Ziffernfolge herausfinden“. Das ist falsch. Die Emission neuer Bitcoins folgt einem fest programmierten, deterministischen Zeitplan: maximal 21 Millionen Einheiten, regelmäßige Halbierungen, feste Blockzeiten. Zufall gibt es nur bei der Frage, welcher Miner als erster einen gültigen Block findet – nicht bei der Geldschöpfung selbst.
Der Artikel behauptet außerdem, das Mining erinnere an „die Entschlüsselung von Kryptografie“ und daraus leite sich der Begriff „Kryptowährung“ ab. Auch das ist schlicht falsch. Bitcoin entschlüsselt nichts. Alle Daten sind bekannt: Blockinhalte, Hashfunktion, Regeln. Miner führen Berechnungen aus, bis der Hash des Blocks kleiner als das Difficulty-Target ist. Der Begriff „Krypto“ kommt daher, dass Bitcoin kryptografische Verfahren nutzt: digitale Signaturen sichern die Eigentumsrechte, Hashfunktionen gewährleisten Integrität, und Merkle-Bäume machen Transaktionen überprüfbar. Es geht um Sicherheit durch Kryptografie, nicht um Entschlüsselung.
Ein weiterer Fehler ist die wiederholte Darstellung von Mining als „Lotto-Spiel“ mit „beliebigen Zufallszahlen“. Bitcoin-Miner „füttern“ den Algorithmus nicht mit willkürlichen Zahlen. Sie variieren gezielt den Nonce-Wert im Blockheader, berechnen den SHA-256-Hash des gesamten Blocks und prüfen, ob dieser unterhalb des vorgegebenen Zielwerts liegt. Der Text spricht zudem von einem „DHA-256“-Algorithmus, den es nicht gibt. Bitcoin verwendet SHA-256, einen standardisierten, öffentlichen Algorithmus. Solche fundamentalen Fehler zeigen, dass die technische Grundlage der Argumentation unsauber ist.
Auch die Behauptung, Bitcoin sei „Spielgeld“, ist keine Analyse, sondern eine rhetorische Abwertung. Der Artikel fordert Kriterien wie „fester Wert“ und „allseitige Akzeptanz“, ohne diese zu begründen. Kein Geldsystem der Welt erfüllt diese Bedingungen. Weder Euro noch Dollar noch Gold haben einen festen Wert, und selbst staatliche Währungen erreichen ihre Akzeptanz erst durch Gesetze und Infrastrukturen. Bitcoin erfüllt mindestens zwei klassische Geldfunktionen — Tauschmittel und Wertspeicher — und wird täglich in Milliardenhöhe transferiert.
Die Darstellung, Blockchain-Zahlungen seien „nicht objektiv verfolgbar“ und man brauche deshalb eine „zentrale Instanz“ für Sicherheit, ist ebenfalls falsch. Bitcoin ist das Gegenteil: Die gesamte Transaktionshistorie ist öffentlich, jede einzelne Zahlung kann von jedem Node unabhängig geprüft werden. Die technische Nachvollziehbarkeit ist vollständig gegeben. Was der Artikel hier eigentlich meint, ist rechtliche Durchsetzbarkeit, aber das ist eine andere Ebene. Technische Verifikation und rechtliche Identitätsfeststellung sind zwei verschiedene Dinge.
Wenn der Artikel Mining als „absurdes Spiel“ bezeichnet, weil Energie verbraucht wird, fehlt die eigentliche Erklärung: Der Energieeinsatz ist kein Nebeneffekt, sondern Teil der Sicherheitsarchitektur. Proof-of-Work macht Manipulation extrem teuer und schützt so die Unveränderlichkeit der Blockchain. Man kann Energieverbrauch kritisieren, aber ihn als „Zufall“ oder „Spiel“ darzustellen, ignoriert das grundlegende Prinzip, auf dem die gesamte Sicherheit von Bitcoin beruht.
Auch die Passage über „langsame Transaktionen“ ist irreführend. Eine Bitcoin-Transaktion ist in der Regel nach einer Stunde endgültig bestätigt. Im traditionellen Bankensystem dauern internationale Überweisungen oft Tage oder erfordern Kreditlinien und Zwischenhändler, an denen andere mitverdienen. Bitcoin bietet eine finale Abwicklung, ohne dass zusätzliche Instanzen Geldschöpfung oder Schuldenzwang einbauen müssen.
Der Text reduziert Bitcoin außerdem auf Spekulation und Börsenhandel, als ob das die einzige Nutzung wäre. Ja, der Preis schwankt, aber das tun auch Immobilien, Gold, Öl oder Aktien. Spekulation beweist Liquidität, nicht Nutzlosigkeit. Weltweit nutzen Millionen Menschen Bitcoin für grenzüberschreitende Zahlungen, Inflationsschutz oder als technologische Infrastruktur. Diese Fakten fehlen vollständig im Artikel.
Besonders problematisch ist, dass der Artikel eigene Fantasiebegriffe wie „Prüfziffer“ und „Zusatzzahl“ einführt, die in Bitcoin nicht existieren. Es gibt keine geheime Zahl, keinen verborgenen Code, der gefunden werden muss. Der Blockhash ist das Ergebnis der Blockdaten und der Nonce. Jede Aussage, die Bitcoin-Mining wie eine Lotterie darstellt, entstellt die technische Realität.
Das größte Problem des Artikels ist nicht eine einzelne falsche Aussage, sondern das Muster dahinter: Anstatt die Technologie sauber zu erklären, wird ein Bild konstruiert, das auf Missverständnissen basiert. Fehlerhafte Begriffe, unzutreffende Analogien und willkürliche Kriterien führen zu einer Analyse, die weder ökonomisch noch technisch belastbar ist. Wer Bitcoin kritisieren will, muss das auf Basis von Fakten tun — Energieverbrauch, Preisvolatilität, Regulierung, gesellschaftliche Folgen. Diese Kritikpunkte sind real, aber sie werden im Artikel nicht behandelt. Stattdessen werden falsche Vorstellungen aufgebaut und dann widerlegt.
Damit verspielt der Text jede Glaubwürdigkeit. Er informiert nicht, sondern verwirrt. Wer den Artikel liest, versteht Bitcoin hinterher schlechter als vorher. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Geldsystemen und neuen Technologien erfordert klare Definitionen, präzise Darstellung der Fakten und nachvollziehbare Argumente. Der Artikel auf kritlit.de leistet das nicht.
Warum sollte die Geldform das zentrale ökonomische Problem sein?
Solange diese Frage nicht beantwortet ist, erübrigt sich jede weitergehende Überlegung.
Jede Geldform bzw. deren konkrete Ausgestaltung hat aber ein jeweils spezielles Problem- oder Emanzipations-Potential.
Man muss mit dem Begriff der neoklassischen Schranke aber schon zurecht kommen, um dazu überhaupt etwas Relevantes sagen zu können.
Man kann es auch wie ein Silvio Gesell machen, und ein spezielles Problem verallgemeinern und glauben, eine Zentallösung gefunden zu haben.
@Luck
Ihr Einwand klingt auf den ersten Blick plausibel, verschiebt aber die eigentliche Fragestellung. Es geht nicht darum, ob jede Geldform ihre eigenen Vor- und Nachteile hat – das ist selbstverständlich. Der entscheidende Punkt ist, dass die Geldform die Regeln bestimmt, nach denen ein Wirtschaftssystem funktioniert. Wer schöpft Geld? Wer profitiert zuerst davon? Wer trägt die Last der Entwertung? Das sind keine Nebenaspekte, sondern die Mechanismen, über die sich Macht, Umverteilung und politische Steuerung konkret abbilden.
Gerade deshalb ist die Geldform zentral: In einem Fiat-System kann Kaufkraft per Beschluss erzeugt und verteilt werden – ohne gesellschaftliche Zustimmung. Das beeinflusst politische Meinungsbildung, weil Zustimmung nicht mehr durch Überzeugung, sondern durch Umverteilung und Subventionierung organisiert wird. Die Frage, wer die Kontrolle über den Geldhahn hat, entscheidet am Ende darüber, wie Wirtschaft und Politik zusammenwirken.
Sie sprechen die „neoklassische Schranke“ an. Wenn man das ernst nimmt, kommt man genau an diesem Punkt nicht vorbei: Knappheit ist eine Grundannahme ökonomischer Modelle. Ein System, das Geld künstlich vermehrt, bricht diese Annahme permanent – und das hat massive Auswirkungen auf Preise, Verschuldung und Vermögenskonzentration. Ob man diese Dynamik gut oder schlecht findet, ist eine Debatte, die man führen kann. Aber sie existiert, und sie entscheidet über die Stabilität der gesamten Architektur.
Ich habe übrigens nie behauptet, dass es eine einfache Gesamtlösung gäbe. Mein Hinweis auf Alternativen zeigt lediglich, dass unterschiedliche Modelle technisch möglich sind. Ob man diese als sinnvoll erachtet, steht auf einer ganz anderen Ebene. Wenn wir diese Fragen aber ernsthaft diskutieren wollen, müssen wir die Machtfunktion von Geld direkt betrachten, sonst bleiben wir an der Oberfläche.
Die Geldform bestimmt die Bandbreite möglicher Regeln und nicht unbedingt die Regeln selbst.
Die neoklassische Schranke bedeutet, dass Geld wie ein anderes Wertgut getauscht wird und nur als Vermittler auftritt. Bei Vollgeld ist das in etwa so der Fall.
Geld mit entsprechender Funktion richtig eingesetzt kann aber Probleme entschärfen und teilweise sogar beheben. Und da hat fiat money andere Möglichkeiten als der Rest.
Derzeit wird dieses ja hauptsächlich falsch eingesetzt zum Vorteil Vermögender, welche auch noch die weit besseren Konditionen bekommen.
Das derzeitig drängendste Problem ist aber mangelnde Kaufkraft, besonders im Niedriglohnbereich. Aufgrund der Verteilungswirkung des Marktes wird dieses Problem immer drängender und größer und ist der hauptsächliche Grund für schwache ökonomische Zahlen und tendenziell abnehmenden Wohlstand in diesem Bereich. Dadurch sind Produktionsmittel weniger stark ausgelastet, als es sein müsste, und auch die Kosten je erzeugter Einheit erhöhen sich durch eine solche Minderauslastung.
Ich interpretiere schon Keynes so, dass es kein stringentes Festhalten an Gleichgewichtsmodellen braucht. Macht man es doch, ist eine Folge das volkswirtschaftliche Gleichgewicht bei Unterkonsumption. Dann liegen volkswirtschadtliche Potentiale brach, während gleichzeirig Menschen darbeb, weil sie mangels Kaufktaft zur Unterkonsumption gezwungen sind.
Man schädigt dadurch das ökonomische durch Unwissenheit oder Unfähigkeit.
Fiat Money ohne Verschuldungszwang wäre dagegen in der Lage, solches Marktversagen zumindest teulweose zu kompensieren. Der Verzicht darauf bedeutet eine geringere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wohlstamdsverluste.
Wer das unverändert lässt, riskiert die Revolution.
@Luck: Ihr Ansatz, Fiat-Money durch „besseren Einsatz“ oder „andere Regeln“ zu optimieren, setzt bereits voraus, dass das Grundproblem im Management des Systems liegt. Genau hier liegt der Denkfehler. Das Problem ist nicht, wie die Regeln angewendet werden – das Problem ist, wer die Regeln schreiben darf.
Die Architektur unseres Geldsystems konzentriert die Macht über Geldschöpfung und Kreditvergabe bei wenigen Akteuren. Diese entscheiden, wer zuerst Zugriff auf neues Geld hat, lange bevor die Preissteigerungen beim Rest der Gesellschaft ankommen. Diese strukturelle Asymmetrie erzeugt die von Ihnen beschriebenen Ungleichheiten – und lässt sich durch bloßes „besseres Management“ von Fiat nicht beheben.
Ihr Vorschlag, Fiat „ohne Verschuldungszwang“ einzusetzen, verdeutlicht das Dilemma: Der Verschuldungszwang ist kein Fehler, sondern das zentrale Designprinzip. Geld entsteht über Kredite, Zinsen erzeugen Wachstumsdruck, und dieser Wachstumsdruck erzwingt immer neue Kredite. Jede Reform, die diesen Mechanismus ignoriert, läuft zwangsläufig wieder in dieselbe Dynamik hinein.
Und selbst wenn man annimmt, dass man die Regeln ändern könnte: Diejenigen, die diese Regeln schreiben, profitieren am meisten von ihnen. Sie haben keinen Anreiz, ein System so umzugestalten, dass ihre eigene Machtbasis schwindet. Genau deshalb scheitern nahezu alle „Reformideen“ innerhalb des Fiat-Systems: Sie überlassen die Gestaltung der Rahmenbedingungen denselben Akteuren, die von den bisherigen Bedingungen profitieren.
Das Kernproblem ist also nicht „falscher Einsatz“, sondern Macht über die Spielregeln selbst. Solange wir Systeme bauen, in denen einzelne Institutionen oder Gruppen den Hebel der Geldschöpfung kontrollieren, reproduzieren wir zwangsläufig dieselben Zyklen von Umverteilung, Verschuldung und Krisen – unabhängig davon, ob wir sie Fiat, Vollgeld, MMT oder Schwundgeld nennen.
Die entscheidende Frage lautet daher: Wie gestalten wir ein System, in dem niemand diesen Hebel für eigene Zwecke missbrauchen kann? Solange diese Frage ausgeklammert bleibt, drehen wir uns weiter im Kreis – nur mit neuen Etiketten auf denselben Mechanismen.
Einzig die Analyse und das Begreifen offenbaren die jeweiligen Schwächen und Grenzen ökonomischer Strukturen und deren Funktionen.
Wenn die Kaufkraft zunehmend in falschen Händen ist, kann sie selbst bei konsumptiver Verschwendung dort nicht die Warennachfrage auslösen, wie es bei besserer Verteilung der Fall ist.
Die Macht eines Systems endet immer dort, wo es versagt. Insbesondere dann, wenn es systematische Gründe dafür gibt.
Ich wüsste nicht, dass die tendenzielle Entwicklung der Kaufkraftverteilung in einem Maße aufgezeigt worden wäre, dass es zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen gekommen wäre.
Dabei hätte eine Gesellschaft, deren Vermögen stärker wächst als die Wirtschaftskraft abzüglich des Konsums, weitergehende Freiheiten der Abschöpfung.
Aber gerade Arbeitskraft wird überproportinal mit Abgaben belastet. Wenn man dann noch die konsumptiven Abgaben hinzu addiert, wird dieses Missverhältnis noch erweitert.
Grundsätzlich bin ich optimistisch, dass gravierende Änderungen möglich sind. Sie werden aber auch gebraucht. Und das zunehmend stärker.
Die zentrale Messgröße ist die Produktivkraft einer Gesellschaft und wie diese organisiert ist, was u. a. heißt, wie diese animiert und verwendet wird.
Das war übrigens schon eine der Zentralaussagen von Marx, was aber in dessen Rezeption keine Bedeutung hinterlassen hat.
Wenn eine Gesellschaft sich auf privates Eigentum verlässt, dann hat dieses auch die Pflicht, die Aufgabe des „lenders of the last ressort“ einzunehmen.
Man ist aber immer noch der Meinung, man könne damit anstellen, was man will. Ohne eine Zielbewirtschaftung wird es aber nicht gehen. Dann bleibt nur die Alternative der nominalen Vergesellschaftung.
Wer das aber nicht will, hat sich anzupassen oder wird angepasst werden.
@Rob Kenius: Mir geht es in dieser Diskussion nicht darum, Bitcoin zu verteidigen oder als perfekte Lösung darzustellen, sondern um die grundlegende Qualität Ihrer Analyse. Wer öffentlich Artikel über das Geldsystem schreibt, muss die gleiche methodische Präzision anlegen, die man auch in der Physik erwarten würde. Genau diese fehlt hier. Der Text enthält eine Reihe von Fehlern, ungenauen Begriffen und falschen Analogien, die den Leser in die Irre führen. Ich respektiere Ihre Arbeit, aber Ihre Darstellung wirkt an vielen Stellen oberflächlich und technisch ungenau. Für jeden, der sich intensiver mit Bitcoin, Kryptografie und Geldarchitektur beschäftigt hat, fällt das sofort auf.
Sie bezeichnen Bitcoin wiederholt als „Spielgeld“, begründen das mit fehlendem „festem Wert“ und mangelnder „allseitiger Akzeptanz“. Beides ist sachlich nicht haltbar. Kein existierendes Geldsystem hat einen „festen Wert“ – weder der Euro noch der Dollar noch Gold. Alle Geldformen sind vom Vertrauen der Nutzer und der Marktlage abhängig. Der Preis von Bitcoin bildet sich wie bei Gold oder anderen knappen Gütern über Angebot und Nachfrage. Das macht ihn nicht zu Spielgeld, sondern ordnet ihn in dieselbe ökonomische Logik ein, die auch für jede Fiat-Währung gilt. Ihr Vergleich mit Briefmarken oder Kunstwerken ist methodisch falsch, weil Bitcoin im Gegensatz dazu fungibel, hoch teilbar, global handelbar und deterministisch in seiner Geldmengenentwicklung ist. Die Volatilität des Preises ist ein legitimer Kritikpunkt – aber sie disqualifiziert Bitcoin nicht als Geld.
Ihre Forderung nach „allseitiger Akzeptanz“ ist ebenfalls ein Problem. Es gibt kein universell akzeptiertes Geld. Der Dollar ist in Europa kein gesetzliches Zahlungsmittel, Gold kann man im Supermarkt nicht einsetzen, und selbst der Euro musste politisch durchgesetzt werden. Akzeptanz ist graduell, nicht binär. Bitcoin hat aktuell keine globale Akzeptanz, aber in vielen Märkten, Branchen und Staaten wird er genutzt und wächst in seiner Reichweite – ähnlich, wie der Euro sich erst durchsetzen musste. Zu behaupten, Bitcoin fehle „allseitige Akzeptanz“ und ihn deshalb pauschal auszuschließen, ist ökonomisch nicht tragfähig.
Ihre Darstellung des Mining-Prozesses ist ebenfalls irreführend. Die Bitcoin-Emission erfolgt nicht „per Zufall“. Der Geldmengenpfad ist deterministisch programmiert: Maximal 21 Millionen Einheiten, alle vier Jahre eine Halbierung der Belohnung, seit 2009 unverändert. Zufall spielt lediglich eine Rolle bei der Zuteilung der nächsten Blockbelohnung an Miner, nicht bei der Gesamtgeldmenge. Das ist ein fundamentaler Unterschied, den Ihre Analyse übergeht.
Genauso falsch ist die Aussage, die Blockchain werde „nicht akzeptiert, weil Zahlungen nicht objektiv verfolgbar oder nachweisbar sind“. Das Gegenteil ist der Fall: Die Bitcoin-Blockchain ist eines der transparentesten Systeme, das je entwickelt wurde. Jede einzelne Transaktion ist für jeden öffentlich einsehbar und kann unabhängig überprüft werden. Was Sie hier verwechseln, sind zwei Ebenen: technische Nachweisbarkeit versus rechtliche Identitätsdurchsetzung. Für Streitfälle über Eigentum und Verträge brauchen wir Gerichte und staatliche Strukturen, ja – aber das hat nichts mit der Verifizierbarkeit von Bitcoin-Transaktionen selbst zu tun. Diese sind eindeutig, überprüfbar und unveränderlich.
Sie behaupten außerdem, Bitcoin funktioniere nur „in einer Community der Wohlwollenden“. Genau das Gegenteil ist richtig: Bitcoin ist gerade dafür entworfen worden, ohne Vertrauen auszukommen. Es funktioniert auch zwischen misstrauischen, konkurrierenden oder anonymen Parteien, weil die Regeln kryptografisch durchgesetzt werden, nicht durch das Wohlwollen der Teilnehmer. Das ist einer der Kernunterschiede zu traditionellen Systemen und einer der Gründe, warum Bitcoin technisch so besonders ist.
Darüber hinaus werfen Sie Bitcoin mit „anderen Kryptowährungen“ in einen Topf. Das ist analytisch unsauber. Bitcoin ist in seiner Architektur einzigartig: keine zentrale Emittenteninstanz, kein Pre-Mining, ein streng begrenzter Emissionspfad, vollständig verteilte Konsensfindung. Viele andere Krypto-Projekte – ob Ethereum, Ripple oder hunderte Token – haben völlig andere Sicherheitsmodelle, Governance-Strukturen und ökonomische Anreize. Wer Bitcoin und „Krypto“ pauschal gleichsetzt, macht die Unterschiede unsichtbar und verliert den Blick auf die eigentlichen Besonderheiten.
Schließlich bezeichnen Sie Bitcoin als „Spekulationsobjekt“ und verweisen auf Kursanstiege an der Börse. Das ist nur die halbe Wahrheit: Ja, Bitcoin wird gehandelt und spekuliert, aber das tun wir mit allen knappen Assets – Öl, Gold, Immobilien, sogar CO₂-Zertifikate. Börsenhandel ist kein Beweis für mangelnde Substanz, sondern für Liquidität und Marktrelevanz.
Zusammengefasst: Ihr Text vermischt Begriffe, setzt falsche Maßstäbe, enthält technische Fehler und ignoriert zentrale Unterscheidungen. Das Ergebnis ist keine nüchterne Analyse, sondern eine stark vereinfachte Darstellung, die wichtige Fakten falsch vermittelt. Wer Bitcoin kritisieren möchte, kann das fundiert tun – es gibt genügend valide Kritikpunkte, angefangen bei Energieverbrauch, regulatorischen Risiken oder Preisvolatilität. Aber das setzt voraus, dass man die technischen und ökonomischen Grundlagen korrekt darstellt.
Als Physiker kennen Sie den Unterschied zwischen Hypothese und Beweis. Genau diese methodische Strenge fehlt in Ihrer Argumentation. Solange Sie grundlegende Fakten zum Funktionsprinzip, zur Geldmengenentwicklung und zur Transparenz falsch darstellen, wirkt die Analyse auf Leser, die mit der Materie vertraut sind, nicht wie eine fundierte Auseinandersetzung, sondern wie Schlampigkeit. Das untergräbt Ihre Glaubwürdigkeit – und schade wäre es, wenn die eigentliche Debatte über Geldarchitektur und Alternativen daran scheitert.
Sie wissen über Bitcoin besser Bescheid als ich. Es gibt auch Astrologen, welche mehr über die Sterne wissen als Physiker. Wenn sie Recht hätten, dann frage ich: Die Brics-Staaten suchen nach einem gemeinsamen Zahlungssystem, das unabhängig vom US-Dollar ist. Warum wird Bitcoin nicht in Erwägung gezogen? Weil es für diesen Zweck ungeeignet ist.
Es gibt eine Alternative zum bestehenden Finanzsystem, es ist das, was ich Degressive Währung nenne, früher Schwundgeld, von dem Erfinder Silvio Gesell Freigeld genannt. Darüber habe ich mehrfach geschrieben, hier ein Link:
https://kritlit.de/tdt/klar.htm#ddm
Das ist das Geld der Demokratie, für jeden verständlich, mit Digitaltechnik leicht realisierbar, nicht kryptisch, nicht exklusiv und parallel zu einer bestehenden Festwährung anwendbar und bereits erprobt. Das Wunder von Wörgl.
Das habe ich schon als Podcast erklärt, mit anschließendem Transcript. https://kritlit.de/ton/9min.htm#wundergeld
Das Schwundgeld entwertet doch nur das Geld selbst über Zeit.
Geldanlage, z.B. in Form von Aktien oder Besitztümer (insbesondere auch Grundbesitz, Firmenbesitz, Gebäude etc.), wird aber dadurch nicht mit der Zeit entwertet. Es sorgt also allenfalls dafür, dass die
Schulden (notiert in einer Währung) und die Geldguthaben (in der Währung des Schwundgelds) auf die Dauer weniger werden. An der Konzentration des Besitzes ändert dieses aber nicht unbedingt etwas.
Eine Geldentwertung findet ansonsten auch durch Inflation statt – nur hier ist ja das allseits gewünschte (und verkündete) Ziel eine möglichst geringe Inflationsrate zu haben – wodurch die Schulden eigentlich auch – aus einer gewissen Sicht – weniger werden würden.
Und auch beim Schwundgeld sehe ich nicht, was dagegen spricht, dass bei der Kreditvergabe vom Kreditgeber verlangt werden kann, dass nun später ein höherer Betrag des Schwundgelds zurückgezahlt werden muss (bzw. der Zinssatz nun nicht über dem Prozentsatz der Entwertung des Schwundgelds liegen kann/darf).
Auch ein Schwundgeld löst kein „Gleichgewicht bei Unterbeschäftigung“.
Es löst auch nicht das Verteilungsproblem, dass sich im ökonomischen Prozess zwangsläufig ergibt.
Warum funktioniert das Say’sche Theorem immer weniger?
@Rob Kenius:
Der Vergleich mit „Astrologen“ ist ein klassisches Ad-hominem-Argument und kein Beitrag zur Sache. Sie unterstellen damit, dass mein Wissen über Bitcoin dem Aberglauben entspricht und stellen mich rhetorisch als „Gläubigen“ dar, statt auf meine inhaltlichen Punkte einzugehen. Genau diese Herangehensweise verhindert eine ernsthafte Diskussion.
Zu BRICS: Dass die BRICS-Staaten Bitcoin nicht wählen, beweist nichts über die technische Eignung, sondern zeigt lediglich, dass Staaten keine Souveränität abgeben wollen. Bitcoin ist neutral – niemand kann es kontrollieren, niemand kann die Regeln ändern, niemand kann bevorzugt profitieren. Genau das macht es für geopolitische Machtblöcke unattraktiv, weil sie eigene Systeme bevorzugen, die sie vollständig steuern können. Dass BRICS Bitcoin nicht nutzt, ist also kein Gegenargument, sondern eine Bestätigung seiner Unabhängigkeit.
Zu Ihrer „degessiven Währung“: Das Modell von Gesell ist nicht vergleichbar mit Bitcoin, weil es zentral durchgesetzt werden muss, während Bitcoin dezentral, transparent und global funktioniert. Schwundgeld erfordert Vertrauen in eine Institution, die Regeln vorgibt und anpasst. Bitcoin entfernt diese Vertrauensebene vollständig. Außerdem existiert Bitcoin seit über 15 Jahren global, mit täglich Milliarden an Transaktionsvolumen – Ihr Modell bleibt dagegen rein theoretisch oder auf lokale Experimente wie Wörgl beschränkt.
Kurz gesagt:
Ihr „Astrologen“-Vergleich ist ein Angriff auf die Person, kein Argument.
BRICS wählt Bitcoin nicht, weil Bitcoin zu neutral ist, nicht weil es untauglich wäre.
Schwundgeld löst keines der strukturellen Probleme, die Bitcoin adressiert – Inflation, asymmetrische Regeln, Eigentumssicherheit.
Wenn wir über Alternativen zum bestehenden Geldsystem sprechen wollen, sollten wir über Fakten, Konzepte und technische Mechanismen reden – nicht über persönliche Herabsetzungen.
Sie wollen mir eine Diskussion über Bitcoin aufzwingen. Ich habe mich vor mehr als zehn Jahren mit der mathematischen Struktur und den technischen Bedingungen genau befasst und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Bitcoin eine Art Spielgeld ist. Das ist der Inhalt des Artikels von damals.
An der Exaktheit der mathematischen Struktur, die hinter Bitcoin und der Blockchain-Technik steckt, besteht meinerseits kein Zweifel.
Aber Bitcoin findet aus mehreren Gründen keine allgemeine Akzeptanz:
Zu große Wertschwankungen.
Zu hoher Rechenaufwand.
Zuteilung nach einem Zufallsprinzip. (Die Umkehrung einer unumkehrbaren Funktion durch Ausprobieren.)
Es scheint, ich habe Recht behalten; denn in den zehn oder zwölf Jahren hat sich Bitcoin nirgendwo als allgemeines Zahlungsmittel durchgesetzt, außer in den Kreisen der Fans, oder Liebhaber, die vielleicht an Zahl und Geldeinsatz mehr geworden sind.
Doch die Argumentation scheint sich verbal geändert zu haben. Sie verwenden jetzt Begriffe und Argumente, die alle Einwände geschickt abwehren. Das ist vergleichbar mit Sektenbildung, Astrologie oder Esoterik. Es macht keinen Sinn, mit Mormonen über Religion zu diskutieren. Und es macht keinen Sinn, mit Bitcoin-Liebhabern über Bitcoin zu diskutieren. Ich möchte auch nicht die Degressive Währung mit Bitcoin vergleichen. Mich interessiert an erster Stelle die Realität. Und ich benutze Sprache, die allgemein üblich ist.
@Rob Kenius
Ich möchte eines vorwegnehmen: Mein ursprünglicher Kommentar war keine Einladung zu einer Bitcoin-Diskussion. Ich habe Ihrem Artikel im Kern zugestimmt und lediglich angemerkt, dass er an entscheidenden Stellen zu oberflächlich bleibt. Mein Hinweis auf Bitcoin war nur ein Randaspekt, um zu verdeutlichen, dass Alternativen grundsätzlich möglich sind. Mehr nicht.
Dass wir jetzt an diesem Punkt so stark über Bitcoin sprechen, liegt daran, dass Sie selbst die Debatte dorthin gelenkt haben. Sie haben mehrfach Aussagen getroffen, die nicht korrekt waren, und diese öffentlich zur Grundlage Ihrer Argumentation gemacht. Auf diese Punkte habe ich reagiert – nicht, um Sie von einer Technologie zu überzeugen, sondern weil ich keine falschen Fakten unkommentiert stehen lassen möchte.
In Ihrer Antwort schreiben Sie, ich wolle Ihnen „eine Diskussion aufzwingen“. Damit verschieben Sie die Rollen in dieser Debatte, und zwar bewusst. Mein ursprünglicher Beitrag war eine Ergänzung zu Ihrem Artikel, keine Provokation. Es wirkt fast so, als wollten Sie den Fokus weg von Ihren eigenen Argumenten lenken, indem Sie mir Absichten unterstellen, die ich nie hatte. Damit umgehen Sie aber genau die Punkte, die inhaltlich geklärt werden müssten.
Zudem fällt auf, dass Sie die Diskussion immer wieder durch Vergleiche abbrechen, die inhaltlich nicht tragen. Begriffe wie „Sektenbildung“, „Astrologie“ oder „Mormonen“ klingen zugespitzt, ersetzen aber keine Analyse. Es wirkt wie ein Versuch, Kritik pauschal abzuwehren, statt sie inhaltlich zu prüfen. Das Problem ist: Wenn wir Debatten auf diese Weise führen, reden wir irgendwann nicht mehr über Mechanismen oder Strukturen, sondern nur noch über Zuschreibungen.
Auch der Verweis auf Ihre Beschäftigung mit Bitcoin vor zehn Jahren kann keine ausreichende Grundlage mehr sein. Seitdem haben sich technische Rahmenbedingungen, Märkte und gesellschaftliche Nutzung erheblich verändert. Wenn man über heutige Entwicklungen spricht, muss man aktuelle Daten und neue Zusammenhänge einbeziehen. Sonst läuft man Gefahr, längst überholte Argumente zu wiederholen. Das ist keine persönliche Kritik, sondern ein Hinweis auf den Stand der Debatte.
Mir geht es ohnehin nicht um Bitcoin, sondern um den größeren Kontext, den Sie in Ihrem Artikel selbst ansprechen: Die strukturellen Probleme unseres Finanzsystems. Hier wäre eine tiefergehende Analyse entscheidend. Welche Rolle spielen Geldschöpfung, Staatsverschuldung, Umverteilung und Machtkonzentration? Warum ist politische Meinungsbildung so eng mit monetären Steuerungsmechanismen verknüpft? Genau diese Fragen sind entscheidend – und bislang bleiben sie in Ihrem Artikel weitgehend offen.
Wenn wir diese Fragen ernsthaft diskutieren wollen, braucht es Präzision, nicht Schlagworte. Begriffe wie „Spielgeld“ oder pauschale Behauptungen über fehlende Akzeptanz helfen niemandem weiter. Sie sind eher rhetorische Marker, um Positionen abzuwerten, als sachliche Argumente. Wer eine echte Analyse führen möchte, muss prüfen, welche Mechanismen tatsächlich wirken – unabhängig davon, ob man eine Technologie befürwortet oder nicht.
Ich respektiere Ihre Arbeit und Ihre eigenen Vorschläge wie das Konzept der „degressiven Währung“. Gerade deshalb wäre ein Vergleich auf Augenhöhe spannend: unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Modelle, klare Datenbasis. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns darauf einigen, Behauptungen zu belegen und Diskussionen nicht durch persönliche Zuschreibungen abzukürzen.
Mein Ziel ist kein Streit über Technologien, sondern eine sachliche Auseinandersetzung darüber, wie Geldstrukturen politische Prozesse beeinflussen. Wenn wir diesen Fokus wiederherstellen, kommen wir viel näher an die Kernfragen, die Ihr Artikel selbst aufwirft. Alles andere führt uns weg vom eigentlichen Thema – und das wäre schade, weil die Debatte wichtig ist.
Miri, der Wert des Bitcoins ergibt sich aus dem Glauben an seinen Wert. Da kann man die Technologie noch so schön erklären. Wenn der Strom weg ist oder der Glaube, dann ist er niohts mehr wert. Okay, ich weiß dass man die Zugangsdaten auf Papier speichern kann. Das hilft aber auch nichts in einer Krise. Häuser, Rohstoffe, Gold, Lebensmittel (und auch Genussmittel wie Whisky und Zigaretten) behalten einen Wert. Unternehmen vielleicht. Überbewertete Aktien nicht.
MIch wundert. dass hier keiner über Aktien redet. Aktien sind eigentliche ein Mittel, mit dem jeder Bürger einen kleinen Anteil erwerben kann und auch Anteil and en Firmengewinnen hat. Nun sind aber nicht mehr die Gewinne, also z.B. Dividenden wichtig, sondern was die Anleger GLAUBEN, dass das Unternehmem wert ist. Dazu muss der Anleger nicht einmal wissen, wie das Unterehmen wirtschaftet und funktionert. Er glaubt einefach an das Papier, weil andere daran glauben. Eine schöbe Beispiel ist die Aktie von Rheinmetall. Ihr Wert ist seit 2000 reel, also inflationsbereinigt um über 5000 % (ca. das Fünfzigfache) gesteigen, während die Produktivität, also die Wertschöpfung reell um die 180% (knapp auf das dreifache) gestiegen ist.
Aber auch der gesamte Aktienmarkt ist von der Produktivität entkoppelt. In den letzten fünf Jahren hatten wie beim BIP eine leichte Rezession, während in der Zeit der Gesamt-Akteinwert reell um ca 70%angestiegen ist. Wer in Aktien invetiert hat, der hat Geld dazugewonnen, also aus dünner Luft Geld erzeugt. Weil aber die vorhandenen Werte gleich geblieben sind, Ist hier eine Werte-Inflation entstanden. Wer ein paar aktien hat, gewinnt, wer viele Aktien hat gewiint mehr. wer dann noch die „richtigen“ Aktien hat, gewinnt noch mehr. Wer keine Aktien hat ist der Verlierer. Es hat eine Umverteilung von umten nach oben stattgefunden. Genauso wie der Bitcoin sind Aktien moderner Alchemie. Man lässt Geld „arbeiten“ und es vermehrt sich von selbst. Allein durch den Glauben and Tulpenzwiebeln, Aktien und Bitcoin. Falls der Glauben´schwindet und jeder die genannten Objekte wieder loswerden will, kommt der Kollaps.
Sind im Begriff „Geldvermögen“ Aktien nicht inkludiert?
Hallo Johann Siegfried von Oberndorf,
Sie berühren eins der zentralen Probleme, das auf den riesigen Geldüberfluss zurückzuführen ist. Die Finanzwelt hat sich von der Realität gelöst, was man am Aktienmarkt, wie sie beschrieben haben, deutlich erkennt. Auch dieses Phänomen habe ich bereits mehrfach behandelt. Das beste Beispiel ist Facebook: https://kritlit.de/ton/9min.htm#zucker
Die Diskontierung künftiger erwarteter Gewinne basiert nicht auf Bekanntheit, sondern auf der Vermutung der Gewinnentwicklung in der Zukunft.
Der Großteil des Geldvermögens besteht aus dieser Nicht-Geldform.
Sie wollen mir eine Diskussion über Bitcoin aufzwingen. Ich habe mich vor mehr als zehn Jahren mit der mathematischen Struktur und den technischen Bedingungen genau befasst und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass Bitcoin eine Art Spielgeld ist. Das ist der Inhalt des Artikels von damals.
An der Exaktheit der mathematischen Struktur, die hinter Bitcoin und der Blockchain-Technik steckt, besteht meinerseits kein Zweifel.
Aber Bitcoin findet aus mehreren Gründen keine allgemeine Akzeptanz:
Zu große Wertschwankungen.
Zu hoher Rechenaufwand.
Zuteilung nach einem Zufallsprinzip. (Die Umkehrung einer unumkehrbaren Funktion durch Ausprobieren.)
Es scheint, ich habe Recht behalten; denn in den zehn oder zwölf Jahren hat sich Bitcoin nirgendwo als allgemeines Zahlungsmittel durchgesetzt, außer in den Kreisen der Fans, oder Liebhaber, die vielleicht an Zahl und Geldeinsatz mehr geworden sind.
Doch die Argumentation scheint sich verbal geändert zu haben. Sie verwenden jetzt Begriffe und Argumente, die alle Einwände geschickt abwehren. Das ist vergleichbar mit Sektenbildung, Astrologie oder Esoterik. Es macht keinen Sinn, mit Mormonen über Religion zu diskutieren. Und es macht keinen Sinn, mit Bitcoin-Liebhabern über Bitcoin zu diskutieren. Ich möchte auch nicht die Degressive Währung mit Bitcoin vergleichen. Mich interessiert an erster Stelle die Realität. Und ich benutze Sprache, die allgemein üblich ist.
Mal ein neuer Ansatz: aller Besitz ist geraubt.
Wenn nicht vom aktuellen Besitzer, dann von dem vorhergehenden, oder vorvorhergehenden oder vorvorvorhergehenden, ….
Was ist uns denn (natur-)rechtmäßig eigen?
Einzig unsere Arbeitskraft und Geistesleistungen!
Alles andere hat der „liebe Gott“ UNS ALLEN GLEICHERMAßEN zur Verfügung gestellt. Kein Mensch kann Moleküle, Materie schaffen. Kein Mensch kann Raum oder Boden schaffen, also besitzen. Keine Energie außer die der Muskelkraft, ist uns eigen, kann besessen werden, sondern ist uns von höheren Mächten, der Natur, dem Kosmos, gegeben.
Mit Geld kann nur bemessen werden, was uns oder anderen tatsächlich eigen ist.
Also kann nur Arbeit und Geistesleistung monetär bewertet und besessen und gehandelt werden. Wenn der Bauer Kartoffeln verkauft, so verkauft er die Frucht des Ackerbodens. Aber nicht die Kartoffel hat er geschaffen, sondern einzig und alleine seine Arbeit, die er darin investiert hat ist es, was er tatsächlich verkaufen kann. Wenn ein Händler ein Produkt abholt und zum Verkauf bereitstellt, so hat er das Produkt nie besessen, kann es also nicht verkaufen. Was er einzig tatsächlich verkaufen kann – weil es ihm tatsächlich eigen ist – ist die Arbeitsleistung des Abholens, des Bereit- bzw. Zurverfügungstellens, Anbietens, des auf Lager Haltens.
Diese Denkweise kann man auf jeden Bereich wirtschaftlicher Tätigkeit anwenden.
Boden kann niemand besitzen, und damit auch nicht vermieten, verpachten, verkaufen. Einzig die Urbarmachung oder Bearbeitung oder Gestaltung des Bodens ist eine Entlohnung wert. Boden sollte nur solchen Personen zustehen, nur von solchen Personen „besessen werden“, die den Boden nutzen und selbst bewirtschaften oder selbst bewohnen.
Mit so einem Ansatz würde nicht nur eine durchgreifende Gerechtigkeit über die seit Generationen fortgeschriebene Ungerechtigkeit der ersten, unrechtmäßigen, da meist gewalttätig vollzogene Aneignung erlangt werden, sondern auch das Problem der Geldentartung könnte damit neu und grundlegend angegangen werden.
Ist es gerecht, dass heute jemand ein Besitzrecht auf etwas inne hat, das vor Jahrhunderten von Raubrittern oder Landesfürsten, Königen, Lehnsherren, Kirchenoberen, etc. sich gewaltsam angeeignet wurde und dann per „Besitzurkunden“ ab dann angeblich legal immer weiter, bis in unserer heutige Zeit, weitergereicht wurde? Nein, gewiss nicht!
Vor der Geldfrage muss die Besitzfrage grundlegend und neu geklärt werden!
Viel Unrecht der heutigen Zeit entspringt der Fortschreibung des Unrechts aus früheren Zeiten. Diese Kontinuität von Gewalt und Macht muss einmal durchbrochen werden.
Die Besitzfrage wird am besten dadurch geklärt, dass Besitz wirklich zur positiven gesellschaftlichen Entwicklung verpflichtet. Man ist also persönlicher Treuhänder für die Gesellschaft.
Wer aber glaubt, “ there ist No Thing sich aus society“ erklärt sich damit selbst für besitzungfähig.
Die meisten Debatten hier kreisen um Symptome: Schulden, Inflation, Kapitalismus, Sozialstaat, BRICS, Schwundgeld, MMT. Aber der Kern des Problems liegt tiefer: Geld ist der mächtigste Hebel, den wir als Menschheit erfunden haben – und dieser Hebel wird systematisch missbraucht.
Entscheidend ist: Wer diesen Hebel kontrolliert, kontrolliert Macht, Eigentum und Lebenszeit. Genau das geschieht heute, oft unbemerkt.
Neue Kaufkraft wird durch Kredite geschaffen, die zuerst an jene gehen, die sie am wenigsten brauchen: Großinvestoren, Konzerne, Finanzakteure.
Inflation entwertet die Rücklagen derjenigen, die kein Vermögen besitzen.
Steuern finanzieren Subventionen, Rettungspakete und Strukturen, die die oberen Schichten weiter begünstigen.
Das perfide daran: Diejenigen, die am meisten verlieren, merken es oft am wenigsten. Wer im unteren Drittel der Gesellschaft lebt, zahlt über steigende Preise und höhere Abgaben mit seiner Lebenszeit – während sich Vermögen an der Spitze exponentiell vermehrt. Diese stille Enteignung passiert im Takt der Geldpolitik, nicht der Demokratie.
Damit sind wir beim eigentlichen Punkt: Politische Entscheidungsbildung ist pervertiert. Früher musste Politik Mehrheiten überzeugen. Heute reicht es, Geldströme zu steuern: Subventionen, Steuererleichterungen, Rettungspakete. Zustimmung wird nicht mehr gewonnen, sie wird gekauft. Wer den Geldhahn kontrolliert, kontrolliert den Diskurs.
Und genau hier liegt der wunde Punkt, über den kaum jemand sprechen will:
Alle diskutieren über Kapitalismus oder Sozialismus, über Vollgeld, MMT oder Degressivgeld. Aber keins dieser Modelle beantwortet die entscheidende Frage: Wie verhindern wir, dass der Geldhebel immer wieder als Machtinstrument missbraucht wird? Wenn wir das nicht lösen, reproduziert jedes System dieselben Krisen, dieselben Umverteilungen, dieselben sozialen Spaltungen.
Wer über Lösungen reden will, muss zuerst anerkennen, dass das Problem strukturell ist. Solange wir nur Modelle vergleichen, aber nicht über Missbrauchssicherheit sprechen, drehen wir uns im Kreis. Der Hebel bleibt, und er wird genutzt – immer gegen die, die am wenigsten Einfluss haben.
Und wer nicht erkennt, dass es bereits seit Jahren ein System gibt, das diesen Hebel technisch anders definiert und damit den Missbrauch zumindest begrenzt, der muss sich nicht wundern, wenn die Diskussion hier nie weiterkommt.
@Miri
Im großen und ganzen stimme ich Ihren Fakten/Klarstellungen und auch Überlegungen zu Bitcoin zu. Auch im weiteren Kontext, dass die strukturellen Probleme unseres Finanzsystems beseitigt werden müssen. Es wäre in der Tat wünschenswert wenn bei dem Thema BTC mehr Sachkenntnis vorhanden wäre und die eigentlich wichtige Frage ,was der Grundgedanke hinter BTC darstellt, diskutiert werden würde.
Trotzdem ist mir nicht ganz klar, was Sie eigentlich genau sagen wollen. Mir drängt sich der Verdacht auf beim Lesen ihrer Beiträge, dass Sie das Finanzsystem als „Grundübel“ unseres Wirtschaftssystems – also dem Kapitalismus – betrachten um entscheidende und grundsätzliche Änderungen zu erreichen.
Dies finde ich eine sehr oberflächliche Betrachtungsweise, weil das Finanzsystem bei weitem nicht das Grundübel unserer wirtschaftlichen Handlungsweise darstellt.
Mit dem Satz: (…) Die meisten Debatten hier kreisen um Symptome: Schulden, Inflation, Kapitalismus, Sozialstaat, BRICS, Schwundgeld, MMT. Aber der Kern des Problems liegt tiefer: Geld ist der mächtigste Hebel, den wir als Menschheit erfunden haben – und dieser Hebel wird systematisch missbraucht. (…), verwechslen Sie meiner Meinung nach Ursache und Wirkung. Kapitalismus ist keineswegs das Symptom des Fianzsystems, sondern umgekehrt.
Viele Ökonomen und Philosophien (z.B. Marxismus) argumentieren, dass das Finanzsystem eine Folge des Kapitalismus und nicht dessen Ursache ist. Doch die Wurzel liegt nach den meisten klassischen und modernen Theorien in den Prinzipien der Produktion und Profitverwertung, nicht im Geldsystem selbst.
Wenn Sie das Thema interessiert, würde ich Ihnen das Buch von David Graeber empfehlen:“ Schulden: Die ersten 5000 Jahre“ . Ein ebenso radikaler wie befreiender Blick auf die Wurzeln unserer Schuldenkrise.
Selbst wenn wir ein hundertprozentig gerechtes/demokratisches, Anti-Fiat und transparentes Finanzsystem hätten – und BTC erfüllt alle diese Kriterien meiner Meinung nach – was würden wir damit machen?
Antwort: Genau das gleiche wie mit dem Fiat-Währungssystem in dem wir uns befinden: mehr Wälder abholzen, mehr Fische in den Schleppnetzen fangen, mehr Berge absprengen, mehr Straßen bauen, industrielle Landwirtschaft ausweiten und mehr Abfall in die Deponien schicken – was alles ökologische Folgewirkungen hat, die unser Planet nicht länger ertragen kann. Wir werden dies alles tun, weil unser Wirtschaftssystem verlangt, dass wir Produktion und Verbrauch exponentiell erhöhen.
Das ist ja eigentlich die Idee hinter der Verwendung sauberer Energie zum Betreiben eines Systems des „grünen Wachstums“, dass wie die Materialproduktion und den Verbrauch weiterhin steigern können. Warum sonst sollte der Energiebedarf steigen?
Dies sind alles Zerstörungen, die auch mit einer weltweiten BTC-Weltwährung (oder einer beliebig anderen) ablaufen würden.
Der Umstieg auf ein alternatives Finanzsystem wird nicht zur Verlangsamung all dieser anderen Ausformungen der ökologischen Krise beitragen. Aus der Bratpfanne der Finanzkatastrophe zu hüpfen, bringt uns nicht viel, wenn wir am Ende doch ins Feuer der ökologischen Katastrophe springen
Die Befürworter des grünen Wachstums haben darauf allerdings eine einfache Antwort. Ihrer Meinung nach müssten wir nichts anderes tun, als das BIP-Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.
Sie räumen natürlich ein, dass der Ressourcenverbrauch historisch gesehen im Gleichschritt mit dem BIP gewachsen ist. Das bezieht sich aber auf die globale Ebene. Während es in bestimmtem einkommensstarken Ländern wie Großbritannien, Japan und eine Reihe anderer reicher Länder, gelungen ist den inländischen Materialverbrauch (Domestic Material Consumption DMC) zu senken und trotzdem das BIP zu steigern behaupten sie. Selbst in den USA hat sich das DMC in den letzten zwanzig Jahren mehr oder weniger abgeflacht.
Die Ökologen und Ökologinnen haben diese Behauptung allerdings längst widerlegt. Das Problem mit dem DMC ist, dass er ein entscheidendes Puzzlestück ignoriert: Er rechnet zwar die importierten Güter ein, die ein Land verbraucht, aber nicht die Ressourcen, die man für die Produktion dieser Güter braucht.
Da die reichen Länder einen derart grossen Teil ihrer Produktion in andere Länder ausgelagert haben – vor allem in den globalen Süden -, ist nun auch die Verantwortung für diesen Aspekt des Ressourcenverbrauchs praktischerweise aus ihren Bilanzen verschwunden. Um dem Recnung zu tragen, bevorzugen die Wissenschaftler die Verwendung des sogenannten „Materialfußabdrucks“ als Maßstab, der die Summe der in den Importen einer Nation enthaltenen Ressourcen einbezieht.
Wenn man diesen ganzheitlichen Maßstab anwendet, wird sehr schnell klar, dass der Materialverbrauch der reichen Länder überhaupt nicht gesunken ist. Ganz im Gegenteil, er hat in den letzen Jahrzehnten dramatisch zugenommen, sogar so stark, das er am BIP-Wachstum vorbeizog. Er war nicht als eine buchhaltungstechnische Illusion.
Das Problem ist die Tatsache, dass wir ein politisches System haben, das ein paar Leuten die Macht gibt, für ihren eigenen privaten Profit unsere gemeinsame Zukunft zu sabotieren.
(Als Vorlage meines Beitrages diente mir – ab dem Absatz: Selbst wenn wir ein hundertprozentig gerechtes/demokratisches, Anti-Fiat (…), das Buch von Jason Hickl: Weniger ist mehr: Warum der Kapitalismus den Planeten zerstört und wir ohne Wachstum glücklicher sind; 15. März 2022)
Der Titel verrät schon, was das wirkliche Grundübel unserer Wirtschaftsweise ist und daran wird kein alternatives Finanzsystem etwas ändern, wenn wir nicht endlich das Grundübel der kapitalistischen Produktionsweise beseitigen.
Es ist wohl so, dass sich die Menschen eher ihr Ende vorstellen können (und das wird auch relativ schnell kommen), als das Ende des Kapitalismus. Traurig aber wahr.
Es gibt keine Lösung innerhalb des kapitalistischen Systems, der Megamaschine
Auch das Märchen vom grünen Wachstum ist wissenschaftlich längst widerlegt, zudem es einen zentralen Punkt übersieht um den man nicht herumkommt: Die Emissionen sind nur ein Teil der Krise. Zusätzlich zu der Klimakrise überschreiten wir bereits eine Reihe anderer planetarer Grenzen, angetrieben durch die steigende Extraktion aus der Erde.
Der Kapitalismus beruht ja auf dem Prinzip: Nimm dir mehr als du bereit bis zurückzugeben.
Das Problem ist nicht allein die Art der Energie, die wir verwenden und wie wir damit handeln, sondern das, was wir damit anfangen.
p.s. ich vermute stark, dass Sie ihre Texte mithilfe einer KI schreiben, was ich nicht schlimm finde, solange es die eigene Ansicht wiedergibt. KIs können oft helfen, Gedanken und Ansätze strukturiert, klar und pointiert zum Ausdruck zu bringen (von meiner Seite aus wurde keine KI verwendet bei meiner Antwort)
Danke Markus, für deinen ausführlichen Beitrag und die vielen Gedanken, die du einbringst. Ich schätze die inhaltliche Tiefe sehr und stimme dir in einem wichtigen Punkt zu: Es fehlt in der gesamten Debatte oft an echter Sachkenntnis, sowohl beim Thema Bitcoin als auch bei den strukturellen Ursachen des Finanzsystems.
Allerdings sehe ich einen entscheidenden Unterschied in unserer Perspektive: Du stellst es so dar, als würde ich das Finanzsystem als „Grundübel“ betrachten, während du die Wurzeln im Kapitalismus verortest. Ich spreche allerdings nicht vom gesamten Finanzsystem, sondern sehr gezielt vom Geldsystem — also der Architektur, über die Geld überhaupt entsteht, verteilt und kontrolliert wird. Das kann man als Teil des Finanzsystems sehen, aber es ist der zentrale Hebel, der die Spielräume aller anderen Ebenen vorgibt.
Das ist für mich kein moralischer Punkt, sondern eine strukturelle Frage: Der Wachstumszwang entsteht nicht aus einer „kapitalistischen Mentalität“, sondern mathematisch durch die Mechanik der Schuldgeldschöpfung. Solange neue Kredite notwendig sind, um bestehende Kredite + Zinsen zurückzuzahlen, erzwingt das System selbst immer neue Investitionen, Produktionsausweitungen und damit steigenden Ressourcenverbrauch. Kapitalismus operiert innerhalb dieser Architektur — er ist nicht deren Ursprung.
An diesem Punkt greift auch deine ökologische Argumentation zu kurz: Ja, wir würden selbst mit einem anderen Finanzsystem weiterhin Ressourcen verbrauchen. Aber der entscheidende Unterschied liegt darin, wer bestimmt, wohin Kapital fließt und wie schnell. Heute sind es Kreditvergabe und Zinslogik, die die Produktion in die Bereiche treiben, die maximale Rendite versprechen — fossile Energien, Immobilienblasen, Massentierhaltung, industrielle Extraktion. Ein System mit technisch begrenzter Geldschöpfung würde diesen Hebel verschieben: Investitionen müssten priorisiert werden, weil das Volumen nicht endlos ausgedehnt werden kann. Es verhindert keine Zerstörung, aber es koppelt das Tempo der ökologischen Schäden zurück an reale Knappheit, anstatt sie durch billige Kredite zu beschleunigen.
Damit kollidiert übrigens eine deiner eigenen Thesen mit deinen späteren Aussagen: Du betonst, dass Wirtschaftswachstum historisch immer mit steigendem Ressourcenverbrauch einhergeht, behauptest aber gleichzeitig, dass die Geldarchitektur dafür keine entscheidende Rolle spielt. Genau das widerspricht sich. Wenn das Wachstum von Ressourcenverbrauch abhängt, dann muss man den Mechanismus hinter dem Wachstumszwang adressieren — und der liegt eben im Geldsystem.
Kapitalismus ist dabei kein universell definierter Begriff, sondern beschreibt unterschiedliche institutionelle Formen: Marktwirtschaft, verschuldungsbasierte Fiat-Architektur oder ein dezentralisiertes Eigentumssystem wie Bitcoin. Wenn man Kapitalismus als „Zwang zur Kapitalakkumulation“ versteht, muss man erklären, woher dieser Zwang kommt. Ist es Gier? Ist es Kultur? Oder ist er — wie ich argumentiere — strukturell im Schuldgeldmechanismus eingebaut?
Aus diesem Blickwinkel geht es mir nicht darum, Bitcoin als Lösung zu verkaufen. Mir geht es darum, aufzuzeigen, dass es überhaupt möglich ist, die Geldarchitektur technisch so zu gestalten, dass Machtmissbrauch schwieriger wird. Bitcoin ist nur ein Beispiel, weil es die Regeln festschreibt und nicht nachträglich änderbar macht. Ob man Bitcoin mag oder nicht, ist dabei zweitrangig — wichtig ist, dass es zeigt, dass Alternativen existieren.
Zum Thema KI: Ich nutze KI, um Zeit zu sparen und meine Gedanken weniger verkopft auszudrücken. Die Inhalte stammen von mir, die KI hilft mir nur dabei, meine Überlegungen schneller in Worte zu fassen.
Hallo Miri, hier mein zweiter Punkt.
Du schreibst: (…) „An diesem Punkt greift auch deine ökologische Argumentation zu kurz: Ja, wir würden selbst mit einem anderen Finanzsystem weiterhin Ressourcen verbrauchen. Aber der entscheidende Unterschied liegt darin, wer bestimmt, wohin Kapital fließt und wie schnell. Heute sind es Kreditvergabe und Zinslogik, die die Produktion in die Bereiche treiben, die maximale Rendite versprechen — fossile Energien, Immobilienblasen, Massentierhaltung, industrielle Extraktion. Ein System mit technisch begrenzter Geldschöpfung würde diesen Hebel verschieben: Investitionen müssten priorisiert werden, weil das Volumen nicht endlos ausgedehnt werden kann. Es verhindert keine Zerstörung, aber es koppelt das Tempo der ökologischen Schäden zurück an reale Knappheit, anstatt sie durch billige Kredite zu beschleunigen. „ (…)
Auch das ist meiner Meinung nach viel zu kurz gegriffen und kratzt lediglich an der Oberfläche und berücksichtigt in keinster Weise die realen und globalen Macht – und Besitzverhältnisse.
Zudem du ja selber schreibst: (…) Ja, wir würden selbst mit einem anderen Finanzsystem weiterhin Ressourcen verbrauchen. (…) Es verhindert keine Zerstörung. (…)
Dies ist ja schon eine Bankrotterklärung deiner Theorie. In meinen Augen, können wir uns diese Art von Denken schlicht und ergreifend nicht mehr leisten. Nahezu alle der neun Planetaren Grenzen hat das System überschritten oder sie stehen kurz davor überschritten zu werden. Ich habe diesen Gedanken schon 2019 in meiner Studie geäussert und seither hat sich die Lage noch verschlimmert.
Zur Info:
Aktueller Stand der planetaren Grenzen (2025)
Die planetaren Grenzen definieren einen sicheren Handlungsraum für die Menschheit, innerhalb dessen die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Erdsystems gewährleistet ist. Laut den neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen, darunter Studien vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und internationalen Forschungsnetzwerken, sind im Jahr 2025 sechs von neun planetaren Grenzen bereits überschritten.
Diese überschrittenen Grenzen sind:
– Klimawandel (globale Erwärmung über dem sicheren Grenzwert)
– Biodiversitätsverlust und Veränderung der Integrität der Biosphäre
– Landnutzungsänderungen
– Störungen biogeochemischer Kreisläufe (insbesondere Stickstoff- und Phosphorkreisläufe)
– Veränderung von Süßwassersystemen
– Überladung mit neuartigen Stoffen (z.B. Mikroplastik, Pestizide und weitere Chemikalien)
Drei weitere Grenzen gelten derzeit noch als nicht überschritten, aber sie stehen zunehmend unter Druck:
– Ozonschicht (mit regionalen Schäden, jedoch dank internationaler Schutzmaßnahmen in Erholung)
– Aerosolbelastung der Atmosphäre
– Ozeanversauerung (mit Annäherung an kritische Schwellenwerte)
Die Überschreitung mehrerer planetarer Grenzen erhöht die Gefahr, dass das Erdsystem irreversible Kipppunkte überschreitet, die gravierende Umbrüche und den Verlust lebenswichtiger ökologischer Funktionen nach sich ziehen können.
Diese Entwicklungen verdeutlichen die Dringlichkeit eines umfassenden sozial-ökologischen Wandels, um den derzeitigen Trend einer fortschreitenden Erdsystembelastung umzukehren und die langfristige Lebensgrundlage der Menschheit zu sichern. Und eben nicht nur das Geldsystem zu reformieren. Ich hoffe, dass ich meinen Punkt klar gemacht habe.
Wenn du die realen Machtverhältnisse nicht änderst, wird kein Geldsystem unser Überleben garantieren.
Aktuelle Zahlen zur globalen Vermögensverteilung verdeutlichen die extreme Konzentration von Kapital und Macht:
– Weltweit gibt es laut dem Forbes-Magazin 2025 über 3.000 US-Dollar-Milliardäre, deren kumuliertes Vermögen mit rund 16,1 Billionen US-Dollar fast viermal so hoch ist wie das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands.
– Die reichsten 1% besitzen mehr als 45% des globalen Vermögens, wobei institutionelle Investoren über 80% der Bestände digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin kontrollieren.
– Auch auf nationaler Ebene zeigen Studien aus Deutschland, dass die obersten 10% der Haushalte etwa 54% des Nettovermögens besitzen, während die ärmere Hälfte weniger als 3% hält
– Aktuelle Analysen zeigen, dass weltweit nur etwa 265 Menschen über so viel Vermögen verfügen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen, das sind rund 3,5 Milliarden Menschen.
Diese extreme Konzentration von Kapital verdeutlicht nicht nur die ökonomische Ungleichheit, sondern auch die daraus resultierende ungleiche Machtverteilung. Dieses Ungleichgewicht verstärkt soziale und ökologische Probleme und unterstreicht die Grenzen technischer Reformen, die nicht zugleich grundlegende Machtstrukturen verändern.
Angesichts solcher Zahlen, muss sich die Menschheit insgesamt entscheiden ob sie die Barbarei oder das Überleben wählt.
Du schreibst: (…) Ein System mit technisch begrenzter Geldschöpfung würde diesen Hebel verschieben: Investitionen müssten priorisiert werden, weil das Volumen nicht endlos ausgedehnt werden kann (…)
Ein System mit technisch begrenzter Geldschöpfung hätte in der Megamaschine folgenden Effekt meiner Meinung nach: Nehmen wir mal an, BTC wäre die einzig globale Währung und würde demzufolge weltweit handelbar sein (ich kenne deine Ansicht über BTC, nehme es nur als ein Paradebeispiel).
Was würde passieren innerhalb unseres Systems?
Nahezu 80% der BTC-Bestände sind in institutionellen Händen und das System der endlosen Kapitalakkumulation und der Machtzunahme – ökonomisch wie politisch – würde dafür sorgen, das BTC erst auf eine Million, dann eine Milliarde, dann eine Billion und Billiarde usw. steigen würde. Das Angebot würde sich nicht ändern, aber natürlich der Preis – und an den realen Machtstrukturen und Verhältnissen würde sich nichts wesentliches ändern. Selbstverständlich würden Investitionen in ökologisch/ökonomisch zerstörerische Projekte weiter gehen und der Kurs der Vernichtung unserer Biosphäre würde blindlings fortgesetzt werden, weil es den Kurs des BTC nach oben treiben würde. Weil BTC nur maximal 21 Millionen Coins haben kann, führt steigende Nachfrage bei begrenztem Angebot naturgemäß zu höheren Preisen. Im kapitalistischen System, das auf Kapitalakkumulation durch Renditemaximierung ausgerichtet ist, würde dies viele Spekulanten, Investoren und institutionelle Akteure anlocken, die den Preis weiter nach oben treiben.
Diese Wertsteigerung wiederum festigt den Besitz von großen Kapitalträgern. Aufgrund der extrem ungleichen Verteilung von BTC (über 80% in Händen weniger großer Akteure) würde sich die Machtkonzentration sogar noch verstärken. Den gleichen Effekt gäbe es mit Gold, Silber oder einem ähnlich knappen Gut.
Du hättest also den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.
Auch dein Satz: (….) Das kann man als Teil des Finanzsystems sehen, aber es ist der zentrale Hebel, der die Spielräume aller anderen Ebenen vorgibt. (…) finde ich ohne Tiefgang und in keinster Weise geeignet die realen Machtverhältnisse auf diesem Planeten zu erklären oder zu verändern.
Abschließend möchte ich noch folgendes sagen, dass verdeutlicht meinen Standpunkt am besten und so habe ich es schon in meiner Studie geschrieben:
(…) Prof. Dr. Rainer Mausfeld hat das gegenwärtige Problem der Mobilisierung der Massen in einem seiner Vorträge über die Verwüstungen des globalen Neoliberalismus treffend auf den Punkt gebracht:
„Dies [die politische Apathie und soziale Fragmentierung unserer Gesellschaft] sind keine Folgen zufälliger Entwicklungen, sondern Erfolge einer jahrzehntelangen, systematischen Indoktrination durch die herrschenden Eliten. Mehr als fünfzig Jahre Elitendemokratie haben uns gezeigt, wohin dieser Weg führt.
Es ist der Weg der Zerstörung.
Der Zerstörung von Gemeinschaft, der Zerstörung der Idee von Gemeinschaft, der millionenfachen Zerstörung von Leben, der Zerstörung von kultureller und zivilisatorischer Substanz – vor allem der Dritten Welt – und der Zerstörung unserer ökologi-
schen Grundlagen.
Die Nutznießer dieser Zerstörung sehen keinen Grund ihren Weg zu ändern. Die dazu notwendige Veränderungsenergie kann nur von unten kommen – von uns.
Das ist unsere Aufgabe und das ist unsere Verantwortung.“
Wir sind augenblicklich Zeitzeugen, wie eine vier Milliarden Jahre alte Erdentwicklung in einer globalen Wirtschaftsmaschinerie verheizt und ausgelöscht wird. Diese »Megamaschine« erzeugt einen monströsen Überfluss an Warenschrott und produziert zugleich Unmengen von Müll. Sie häuft aberwitzigen Reichtum, massenhaftes Elend, sinnlosen Leerlauf (sog. BullshitJobs), Überarbeitung und permanente ökologische Zerstörung an.
Den Profiteuren dieser globalen Zerstörung muss ebenfalls das Handwerk gelegt
werden, ansonsten wird sich die gesamte Menschheit in einem Alptraum ohne Erwachen wiederfinden, bis zu ihrem bitteren Ende.
Und hier der dritte:
Du schreibst:“ Kapitalismus ist dabei kein universell definierter Begriff, sondern beschreibt unterschiedliche institutionelle Formen: Marktwirtschaft, verschuldungsbasierte Fiat-Architektur oder ein dezentralisiertes Eigentumssystem wie Bitcoin. Wenn man Kapitalismus als „Zwang zur Kapitalakkumulation“ versteht, muss man erklären, woher dieser Zwang kommt. Ist es Gier? Ist es Kultur? Oder ist er — wie ich argumentiere — strukturell im Schuldgeldmechanismus eingebaut?“
Das halte ich für nicht zutreffend. Wie ich bereits erklärt habe, ist Kapitalismus viel mehr als das:
– Kapitalismus ist vor allem eine Ideologie, kein bloßes Wirtschaftssystem. Sie zielt darauf ab, den Menschen — dessen ursprüngliche Natur sozial ist, wie bei allen Lebewesen — „umzuformen“. Das Ziel ist, ihn in eine egoistische, empathielose, konsumgierige, uninformierte und fragmentierte Masse zu verwandeln.
– Im Gegensatz dazu zeigen zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse, darunter die von Mausfeld zitierten, dass Kinder bereits sehr früh soziale Verhaltensweisen wie Teilen, Fürsorge und Gerechtigkeitssinn entwickeln. Diesem inneren Widerspruch sehe ich als wesentliche Ursache für die weltweite Explosion von Depressionen.
– Kapitalismus bedient sich antisozialer, der menschlichen Natur widersprechender Normen und einer stark vergifteten, sinnentstellenden Sprache — Stichwort „Homo Economicus“ — sowie vieler weiterer Absurditäten.
– Kapitalismus und Demokratie sind unvereinbar. Der Begriff „kapitalistische Demokratie“ ist ein Orwellscher Euphemismus. Mausfeld stellt fest, dass der Kapitalismus die wirkungsvollsten ideologischen Machtformen hervorgebracht hat, gegen die zivilisatorische Schutzinstrumente bislang weitgehend wirkungslos bleiben. Dieses Paradoxon – dass liberale Demokratien auf Gleichheitsversprechen basieren, die durch Wirtschafts- und Eigentumsordnung faktisch unerfüllbar sind — ist ihr Kernproblem.
– Kapitalismus ist eine massive Umverteilungsmaschine von unten nach oben. Die meisten Menschen haben keine Ahnung von dem Ausmaß dieser Ungleichheit — siehe dazu auch Mausfeld.
– Kapitalismus funktioniert als System, das stets mehr von der Natur nimmt, als es zurückgibt, während die wahren Kosten dieser Zerstörung komplett externalisiert und nicht in den Preisen der Konsumgüter berücksichtigt werden.
Hauke Ritz hat dies vor vielen Jahren bereits in einer wegweisenden zehnteiligen Serie zum Neoliberalismus/Kapitalismus auf RT Deutsch analysiert — damals noch legal — eine der besten Analysen überhaupt.
Zur 10-teiligen Serie von Hauke Ritz: Die Originalbeiträge sind online aktuell kaum noch offiziell verfügbar, da RT Deutsch in Deutschland verboten ist. Es gibt aber Sekundärquellen und Rezensionen, die seine Inhalte aufgreifen, ebenso wie seine Buchveröffentlichungen, die ähnlich fundierte Analysen enthalten. Etwa in „Endspiel Europa“ von Hauke Ritz oder in verschiedenen Rezensionen und Textsammlungen, die seine Gedanken zu Neoliberalismus, kultureller Herrschaft und ideologischer Machtausübung aufgreifen.
Man könnte ewig über dieses Thema schreiben, doch diese Punkte sind für mich die zentralsten.
Du schreibst dann weiter:
„Wenn man Kapitalismus als ‚Zwang zur Kapitalakkumulation‘ versteht, muss man erklären, woher dieser Zwang kommt. Ist es Gier? Ist es Kultur? Oder ist er — wie ich argumentiere — strukturell im Schuldgeldmechanismus eingebaut?“
Hier kann ich dir nur empfehlen, die bereits genannten Bücher von Mausfeld und Graeber zu lesen. Dort findest du fundierte Antworten, weil das Thema viel zu komplex ist, um es umfassend in einem Forenaustausch zu klären.
Nur so viel: Mausfeld untersucht in der Zivilisationsgeschichte die letzten 5.000 Jahre und zeigt, dass das, was heute zum Grundproblem liberaler Demokratien geworden ist — die ungezügelte Potenzierung von Macht und Reichtum — schon damals erkannt wurde.
Dem wurde früh durch die Entwicklung der egalitären Leitidee der Demokratie als Schutzinstrument begegnet, das die Entstehung parasitärer Eliten eindämmen sollte.
Dieser dialektische Prozess von Elitenbildung und -kontrolle zieht sich durch die Geschichte Mesopotamiens, des alten Chinas und des antiken Athens, wobei Mausfeld eben auch die strukturellen Grenzen all dieser Lösungen herausarbeitet.
David Graeber bietet mit seinen Forschungen über Schulden („Die ersten 5000 Jahre“) eine weiterführende Perspektive, indem er unterschiedliche kulturelle Umgangsweisen mit Schuldwesen und Macht beschreibt — hochinteressant.
Hallo Miri,
ich sehe, du hast verstanden, was ich sagen will: Die Finanzmacht verursacht die falschen Trends und das liegt in der Konstruktion des Systems, wie es 2025 existiert (mit der viel zu großen Geldmenge). Die Frage ist, was hilft dagegen?
Dagegen hilft nur demokratische Politik im Interesse der Bürger. Genau das Gegenteil von dem, was Friedrich Merz macht. Er vertritt die Interessen der Finanzwelt gegen die Allgemeinheit, von der er sein Mandat hat.
Es gibt viele Ansätze: Ein Miterbe des Staates an allen größeren, besonders finanziellen, Erbschaften (bei Firmen gestreckt über 20 Jahre). Viel höhere Steuern auf Finanzgewinne. Zinsen auf null, wie es im Euro-Raum schon einmal war, ehe die EZB sich wieder der FED angepasst hat. (Die FED vertritt die Interessen der reichsten Leute der USA.)
Der Fetisch Wirtschaftswachstum, gemessen in Geld, muss verschwinden. Es gibt menschliche und ökologische Kriterien der besseren Bewertung. Man kann auch die Steigerung der Aktienkurse einer Firma besteuern, dann überlegen sich die Firmen, ob sharholder value das höchste Ziel sein soll. Das ergibt eine neue Firmenpolitik zum Wohle der Beschäftigten und der Kunden. Man muss in das System eingreifen auf der Basis demokratischer Kontrolle.
Das ist nur, was mir gerade so einfällt. Warum die Parteien nicht so agieren, kann ich damit erklären, dass die führenden Köpfe dem Größenwahn verfallen sind, den das Finanzsystem erzeugt. Oder sie sind korrupt oder dumm oder untertänig oder all das auf einmal. Tatsache ist, sie lassen sich vom Geld treiben und wir Wähler sind die Betrogenen.
Rob Kenius
https://kritlit.de
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Mir scheint allerdings, dass wir das zugrunde liegende Problem aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Deshalb eine Verständnisfrage: Wo sehen Sie in meinen Beiträgen, dass ich dieselben Lösungen propagiere wie Sie oder dass wir die Problemstellung überhaupt gleich definieren?
Sie fokussieren in Ihren Vorschlägen auf politische Instrumente wie höhere Steuern, Umverteilung, Nullzinsen oder stärkere Eingriffe in die Wirtschaft. Mein Ansatz geht in eine andere Richtung: Für mich liegt das eigentliche Problem nicht primär in der Höhe von Steuern oder Zinsen, sondern in der Architektur des Geldsystems selbst. Die Art, wie Geld entsteht, verteilt und wieder vernichtet wird, erzeugt strukturell eine Dynamik, die politischen Entscheidungen oft vorgelagert ist.
Konkret:
– Neue Kaufkraft wird über Kredite geschaffen, nicht über vorhandene Mittel. Dadurch gibt es einen permanenten Wachstumszwang, unabhängig davon, wie Politiker oder Notenbanken handeln.
– Dieser Wachstumszwang verstärkt Machtkonzentration, weil jene, die zuerst Zugriff auf neues Geld haben, strukturell Vorteile genießen.
– Maßnahmen wie höhere Steuern oder zusätzliche Umverteilungsmechanismen erhöhen indirekt den Druck auf die Geldschöpfung. Das verstärkt die bestehenden Probleme, weil mehr Schulden und damit auch neue Ungleichgewichte entstehen.
Mir geht es also weniger um „mehr Eingriffe“ oder „bessere Regulierung“, sondern um die Frage, wie man die Missbrauchsmöglichkeiten am Hebel selbst begrenzt. Denn solange die Architektur unverändert bleibt, reproduziert jedes politische Modell — ob kapitalistisch, sozialistisch oder irgendetwas dazwischen — dieselben Krisenmechanismen: Umverteilung von unten nach oben, instabile Schuldendynamiken und steigenden Druck auf Ressourcen.
Meine Perspektive zielt daher nicht auf eine bestimmte Ideologie ab, sondern auf den Versuch, die strukturelle Grundlage zu verändern, die diese Dynamiken überhaupt erst ermöglicht. Ich glaube, genau dort müssen wir ansetzen, wenn wir langfristig Stabilität schaffen wollen.
Hallo Miri,
erst mal danke für deine ausführliche Antwort!
Vielleicht zuerst vorneweg für unsere Diskussion:
Für unser Gespräch nutze ich keine KI, allerdings lasse ich meine Aussagen und Quellen prüfen oder grammatikalisch verbessern, von „ihr“ – ich bevorzuge Perplexity – aber es sind schon meine Worte.
Meine Infos, Meinungen und Ansichten in unserem Dialog beziehen sich auf folgende Literatur:
Fabian Scheidler:
Das Ende der Megamaschine (2016)
Chaos: Das neue Zeitalter der Revolutionen (2019)
Der Stoff, aus dem wir sind (2021)
Prof. Dr. Rainer Mausfeld:
Hybris und Nemesis (2023)
Jason Hickel:
Weniger ist mehr (2023)
Die Tyrannei des Wachstums (2018)
David Graeber:
Anfänge: Eine neue Geschichte der Menschheit
Schulden: Die ersten 5000 Jahre
Diese Werke haben meine Meinung nachhaltig beeinflusst und ergänzt. Besonders Mausfeld hat mir die Frage beantwortet, warum die Schafe wieder und wieder ihre eigenen Schlächter wählen.
Struktur meiner Antwort:
1. Zum Finanzsystem:
Wenn ich vom Finanzsystem spreche, meine ich natürlich das Geldsystem und die endlose Kapitalakkumulation. Allerdings beschreibt das „reine Geldsystem“ meiner Meinung nach nicht mehr die realen Verhältnisse. Es hat eine derartige Krakenstruktur angenommen, dass die Fokussierung darauf zu oberflächlich ist und nicht den Kern berührt. Genauso wie der ökologische Kollaps der Biosphäre. Aber ich verstehe, was du meinst.
2. Zur Schuldgeldschöpfung und Kapitalismus:
Du schreibst: „Der Wachstumszwang entsteht nicht aus einer kapitalistischen Mentalität, sondern mathematisch durch die Mechanik der Schuldgeldschöpfung. Solange neue Kredite notwendig sind, um bestehende Kredite plus Zinsen zurückzuzahlen, erzwingt das System immer neue Investitionen, Produktionsausweitungen und steigenden Ressourcenverbrauch. Kapitalismus operiert innerhalb dieser Architektur — er ist nicht deren Ursprung.“
Das ist historisch falsch, meiner Meinung nach. Das moderne Weltsystem — manche nennen es Kapitalismus, ich bevorzuge den Ausdruck der „Megamaschine“ — begann vor über 500 Jahren, als Kolumbus begann, Eingeborene auf Haiti brutal zu unterwerfen (vor dieser Stelle endet die Geschichtsschreibung oft).
Dieses System wurde mit struktureller und rechtlicher Gewalt verankert und ist bis heute das moderne Weltsystem. Es hat keine Analogie in der Menschheitsgeschichte.
Zitat Fabian Scheidler (Das Ende der Megamaschine), S. 104ff:
DIE ENTFESSELUNG DES MONSTERS
Spätestens seit 1453 hatten die europäischen Magnaten ein Problem: Waren die Handelswege nach Asien bis dahin ein entscheidender Motor der Kapitalakkumulation gewesen, so blieben sie nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen versperrt oder erwiesen sich zumindest nicht mehr als lukrativ. In der Folge setzte ein fieberhafter Wettlauf um die Entdeckung eines Seewegs nach Indien und Ostasien ein. Die Portugiesen hatten ihn schon lange gesucht und an derwestafrikanischen Küste bereits eine Reihe von Militärstützpunkten errichtet, doch erst 1498 erreichte Vasco da Gama Indien. Sechs Jahre zuvor hatte Spanien einen genuesischen Söldner, Abenteurer und Piraten namens Cristoforo Colombo alias Cristóbal Colón damit beauftragt, einenwestlichen Seeweg nach Indien zu suchen. Tatsächlich erreichte er am 12. Oktober 1492 Land, das er für »Indien« hielt: die Bahamas. Dieser Tag wird bis heute in vielen Ländern als offizieller Feiertag begangen: als Columbus Day in den USA, als Fiesta Nacional in Spanien und Día de la Raza in vielen Ländern Lateinamerikas – wobei Venezuela ihn im Jahr 2002 in »Tag des indigenen Widerstands« umbenannte. Kolumbus sind auf der ganzen Welt zahllose Denkmäler gewidmet, und Kinofilme porträtieren ihn als heldenmutigen Entdecker. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) etwa präsentiert in ihrer DVD-Reihe »Die Großen der Weltgeschichte« Kindern ab acht Jahren Kolumbus als einen naiven jungen Mann, dessen Idealismus und kindlicher Entdeckergeist ihm den Weg in die Herzen der Regenten und schließlich über den Ozean öffnet.
Doch nicht ohne Grund endet der Film just in dem Moment, als Kolumbus die »Neue Welt« erreicht. Was danach geschah, wollte die FAS offenbar ihren jungen Zuschauern nicht zumuten. Während die Bewohner der Küstenregionen, die Kolumbus ansteuerte, den Fremden mit bemerkenswerter Gastfreundschaft begegneten, hatten die Spanier anderes im Sinn. Kolumbus notierte im Bordbuch: »Mit 50 Mann könnten wir sie alle unterwerfen und mit ihnen tun, was wir wollen.«64 Schon bei den ersten Landungen ließ er zahlreiche Bewohner festnehmen, um Informationen über Goldvorkommen zu erpressen. Doch die Leute wussten nichts. Um den europäischen Investoren trotzdem etwas zu bieten, verschleppte Kolumbus schließlich 500 Mann als Sklaven nach Spanien, von denen 200 schon bei der Überfahrt starben.
Zur Finanzierung seiner zweiten Reise versprach er dann der spanischen Krone und den italienischen Geldgebern als return on investment »so viel Gold und so viele Sklaven, wie ihr haben wollt«. Das setzte ihn und seine Mannschaft erheblich unter Druck, sie mussten dieses Versprechen um jeden Preis einlösen und eine Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaften.
Die zweite Reise wurde zum Auftakt für den wohl größten Völkermord, den die Menschheit bis dahin erlebt hatte. Da die Goldsuche der Spanier zunächst erfolglos verlief, befahlen sie auf Hispaniola (heute Haiti) allen Männern über 14, alle drei Monate eine bestimmte Menge Gold abzuliefern. Wer das nicht tat, dem wurden die Hände abgehackt und man ließ ihn verbluten. Doch auf Haiti gab es kaum Gold, zumindest keines, das die dort lebenden Arawaks finden konnten. Also flohen sie in die Berge, verfolgt von den Spaniern, die jeden Flüchtigen hängten oder lebendig verbrannten. Massenselbstmorde der Arawaks waren die Folge. Oft töteten sie auch die eigenen Kinder, damit sie nicht den Spaniern in die Hände fielen. In nur zwei Jahren war auf diese Weise die Hälfte der 250.000 Menschen Haitis ausgerottet.
Aber das war nur der Anfang. Weil kaum Gold zu finden war, verfielen die Spanier darauf, die Arawaks auf Sklavenplantagen arbeiten zu lassen, unter Bedingungen, die letztlich so gut wie alle umbrachten. 1515 waren noch 50.000 Haitianer übrig, 1550 nur noch 500.65
So geschah es in allen Gegenden, in die die Spanier ihre Füße setzten, von Mexiko bis Peru. Die genauen Zahlen dieses Völkermordes werden wohl nie definitiv zu ermitteln sein. Von schätzungsweise 50 Millionen Einwohnern Süd- und Mittelamerikas waren 150 Jahre nach Kolumbus gerade noch drei Millionen übrig. Vom Beginn der Conquista bis heute haben sich Historiker immer wieder bemüht, diesen Völkermord zu leugnen oder zu verharmlosen. Das beliebteste Argument ist der Hinweis, die meisten Indigenen seien unbeabsichtigt durch eingeschleppte Krankheiten umgekommen. Selbst wenn das für 90 Prozent dieser Menschen zuträfe (wofür es keinen Beweis gibt), blieben immer noch mehrere Millionen Menschen, die vorsätzlich ermordet oder zu Tode geschunden wurden. Der amerikanische Historiker David Stannard weist im Übrigen zu Recht darauf hin, dass tödliche Epidemien oft die Folge der unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen waren, in die Millionen von Indigenen gezwungen wurden.66
Das Motiv der bis heute anhaltenden Verharmlosungsversuche ist offensichtlich: Eine volle Anerkennung des Völkermordes würde den Mythos der moralischen Überlegenheit Europas zerstören, auf den sich die westliche Expansion seit mehr als 500 Jahren stützt. (…)
Die Erfindung der Aktiengesellschaft
Der autoritäre Staat war nicht die einzige monströse Institution, die in dieser Epoche geschaffen wurde. Ebenso mächtig, wenn nicht sogar mächtiger, und ebenso monströs war eine zweite Institution, die mit der ersten eng verbunden war: die Aktiengesellschaft.
Eine Aktiengesellschaft ist, wenn man sie näher betrachtet, eine sehr eigenartige Konstruktion. Sie ist rechtlich eine »juristische Person«, in den USA sogar als »moral person« mit allen Verfassungsrechten ausgestattet, die sonst nur »natürliche Personen« genießen. Im Unterschied zu anderen juristischen Personen wie Vereinen und Genossenschaften besteht ihr einziges Ziel in der Vermehrung des Geldes der Anteilseigner. Da die Aktiengesellschaft nicht wie natürliche Personen sterben kann, kann sie im Prinzip ewig bestehen. Sie ist also so etwas wie eine Maschine – eine Maschine mit anthropomorphen Eigenschaften –, deren einziges Ziel die endlose Geldvermehrung ist. Die Schaltkreise und Zahnräder dieses gigantischen Cyborgs bestehen zwar großenteils aus Menschen, aber diese Menschen sind vollständig auf ihre Funktion für den Endzweck der Maschine ausgerichtet. Wenn sie diesem Zweck nicht dienen, wirft die Maschine sie aus. Nach diesem Bauprinzip sind die mächtigsten Institutionen der Erde geschaffen. Sie sind finanzstärker als viele Staaten. Obwohl sie auch Konflikte mit Regierungen austragen, sind sie doch deren Geschöpfe: Denn nur Staaten und Regierungen können die komplexen juristischen Konstruktionen erschaffen, bewahren und durchsetzen, die zu ihrer Existenz notwendig sind, ja aus denen sie tatsächlich bestehen. Ihr genetischer Code zwingt sie dazu, sich immer weiter auszudehnen, denn das vermehrte Geld muss wiederum vermehrt werden. Sie durchpflügen Land und Meer auf der Suche nach neuen Anlagen. Schmilzt die Arktis aufgrund der von ihnen produzierten Treibhausgase, ist das kein Motivzum Innehalten sondern eine Gelegenheit, auch in der Arktis nach Öl zu bohren. Was sie produzieren – Autos und Medikamente, Schnuller und Maschinengewehre, Viehfutter und Strom –, sind nur austauschbare Mittel zu ihrem eigentlichen Zweck, nämlich der Geldvermehrung. Ist der Bedarf an Produkten gedeckt, muss neuer Bedarf geschaffen werden.
Daher ist es für ihre Funktionsfähigkeit unabdingbar, dass Bürger in Konsumenten verwandelt werden, deren wesentlicher Beitrag zum gesellschaftlichen Leben darin besteht, zu kaufen, ganz gleich wie sinnlos, überflüssig oder schädlich die Produkte sind. Gesellschaftliche Entscheidungen über Sinn und Zweck des Ganzen, die Frage, was Menschen wirklich brauchen und wie sie leben wollen, haben in ihrer Logik keinen Platz. Doch obwohl der Zweck von Aktiengesellschaften abstrakt ist, muss ihr Input konkret sein, denn sie brauchen Energie und Materie, die sie in Produkte zu verwandeln, die für Geld verkauft werden. Diese künstlichen, unsterblichen Wesen nähren sich also von der Realität und verwandeln sie in pure Abstraktion: in eine Reihe von Ziffern auf einem Nummernkonto ihrer Anteilseigner.
Wie aber ist es zur Schaffung einer so absonderlichen und destruktiven Institution gekommen? Bis zur Gründung der ersten Aktiengesellschaften um das Jahr 1600 war die Kapitalanhäufung an daspersönliche Gewinnstreben einzelner Menschen geknüpft. Erlosch der Wunsch, das Vermögen zu mehren, etwa um sich zur Ruhe zu setzen und die Früchte des Reichtums zu genießen, endete auch die wirtschaftliche Expansion.87 Anders bei der Aktiengesellschaft: Hier ist die Akkumulation zur Institution geworden, während die Menschen in ihr austauschbar sind.
Die Verselbstständigung und Abstraktion der Geldvermehrung hat bis zur Erfindung der Aktiengesellschaft eine lange Geschichte durchlaufen. Die Pioniere des Frühkapitalismus in Venedig und Genua waren noch Abenteurer, die selbst zur See fuhren, kämpften und nicht selten dabei umkamen. (Das englische Wort für Abenteurer »adventurer« bezeichnete ursprünglich jemanden, der Risikokapital – »venture capital« –investiert.) Sie handelten mit vergleichsweise geringen Mengen von Luxusgütern, aber mit extrem hohen Profitraten, denen auch ein hohes Risiko gegenüberstand.88 Mit wachsenden Handelsvolumina, größerer Konkurrenz zur See und engeren Profitraten wuchs die Notwendigkeit, jede Transaktion genau zu kalkulieren. Die entscheidende Erfindung für diesen Zweck war im 14. Jahrhundert die Einführung der doppelten Buchführung, wie wir sie heute noch kennen. Mit ihrer Hilfe konnten Einnahmen, Ausgaben, Gewinn und Steuern genau kalkuliert werden, und zwar nicht nur im Nachhinein sondern auch vorausschauend.89 Diese Mathematisierung des Handels war ein entscheidender Schritt von einer spontanen Reichtumsanhäufung durch Raub- und Handelszüge hin zu einer kalkulierten Geldvermehrung, die mehr und mehr zum Selbstzweck wurde. Dabei änderte sich Schritt für Schritt das Berufsbild des Händlers. Aus dem seefahrenden Freibeuter wurde ein Schreibtischtäter, der von seinem sicheren Büro aus Angestellte in aller Welt dirigierte. Anstelle des physischen Erwerbs konkreter Schätze trat die Akkumulation einer abstrakten mathematischen Größe auf dem Papier. Doch diese Vermehrung war noch nicht ganz automatisiert. Neben den persönlichen Neigungen des Händlers und seiner begrenzten Lebenserwartung bremsten auch juristische Beschränkungen die endlose Akkumulation. In der Frührenaissance hatte es zwar schon eine Reihe von Unternehmensformen gegeben, die es Kapitalgebern und Händlern erlaubten, sich zusammenzuschließen. Allerdings unterlagen all diese Formen zwei Einschränkungen: Jeder Investor haftete mit seinem gesamten Vermögen für alle etwaigen Verluste seiner Partner; und die Lebensdauer der Gesellschaft war in der Regel auf eine Handelsreise beschränkt.90
Diese Beschränkungen wurden erst 1602 mit der Gründung der Niederländischen Ostindien-Kompanie beseitigt, der ersten Aktiengesellschaft im heutigen Sinn. Die Kompanie erhielt vom niederländischen Staat ein Handelsmonopol für den gesamten Raum des Indischen und Pazifischen Ozeans. Um ihre Anteilsscheine zu handeln, wurde kurze Zeit später die erste und für lange Zeit wichtigste Wertpapierbörse der Welt, die Amsterdamer Effektenbörse, geschaffen. In dem Maße, wie die Besitztitel frei handelbar wurden, machte man das Eigentum fließend und abstrakter, entkoppelte es von Personen und Orten. Anders als die bisherigen Handelsgesellschaften hatte die Kompanie eine im Prinzip unbegrenzte Lebensdauer. Sie war außerdem die erste Gesellschaft, die die Haftung der Anteilseigner auf den Wert ihrer Aktien beschränkte. Diese Neuerung, die uns heute als etwas Selbstverständliches erscheint, war tatsächlich eine Ungeheuerlichkeit. Erstmals in der Wirtschaftsgeschichte hatten Investoren ein formal verbrieftes Recht, für die von Ihnen verursachten Verluste und Schäden nicht mit ihrem Vermögen zu haften. Umgekehrt hatten sie auch kaum Mitspracherechte bei den Entscheidungen des Unternehmens und waren daher auch strafrechtlich für Verbrechen, die die Kompanie beging, nicht haftbar. Sie bekamen einfach ihre garantierte Dividende von 16 Prozent, und hatten im Übrigen nichts mit der Sache zu tun.
Die Kompanie trieb damit den Prozess der Entbettung der Ökonomie aus dem Haushalt (griechisch: »oikos«) auf die Spitze.91 Sie war losgelöst von allen Bindungen an reale Menschen, Orte und soziale Beziehungen, von menschlichen Lebensspannen und Verantwortungen. Sie wurde, anders gesagt, zu einer Art metaphysischem Wesen, unsterblich und ortlos wie Engel.
Die wirtschaftliche Macht dieser unirdischen Wesen ließ sich jedoch nicht ohne den massiven Einsatz physischer Gewalt durchsetzen. Bereits bei ihrer Gründung hatte die Niederländische Ostindien-Kompanie das Recht erhalten, eine eigene Armee zu schaffen, mit Söldnern, die einen Treueeid auf die Kompanie schwören mussten. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erhielt auch die Englische Ostindische Kompanie Schritt für Schritt die Rechte, eine eigene Armee aufzubauen und nach Gutdünken Krieg zu führen, eigene Münzen zu prägen, sowie die vollständige Gerichtsbarkeit im Straf- und Zivilrecht »über alle Personen, die zu besagter Kompanie gehören oder unter ihr leben«. Die Handelskompanien waren also staatenähnliche Gebilde mit flottierenden Territorien. Sie wurden von einem Gouverneur regiert, der nicht nur über seine Angestellten befehligte, sondern auch über alle Menschen in den von der Kompanie eroberten Kolonien. In diesen Firmen war wirtschaftliche und militärische Tyrannei in einer Hand gebündelt. (…)
Macht und Ohnmacht im modernen Weltsystem:
Im Namen von Heil und Fortschritt verwandelten Europäer mit Beginn der Neuzeit die halbe Welt in eine Hölle auf Erden. Aus Geldwirtschaft, Metallurgie und Kriegsbusiness hatte sich eine Machtmaschinerie entwickelt, die in der Lage war, sowohl jeden Widerstand innerhalb Europas zu brechen als auch nach außen Schritt für Schritt andere Länder und ganze Kontinente zu unterwerfen. Diese Machtmaschine hat auf den ersten Blick einige Ähnlichkeiten mit Imperien wie dem römischen, bei näherer Betrachtung zeigt sich aber, dass sie anders funktioniert. Ein Indiz für die Neuartigkeit des Systems ist der merkwürdige Umstand, dass der moderne Staat, im Unterschied zu vorangegangenen Staatswesen, von Anfang an ein verschuldeter war. Nur mit den Krediten der Handelsmagnaten konnten sich Regenten Söldner und Waffen kaufen und damit Kontrolle über Territorien und ihre Bewohner erlangen. Aus diesem Grund ist das Machtverhältnis zwischen Kapitalbesitzern und Regierenden in der Neuzeit bis heute ein grundsätzlich anderes als in der Antike. Während in Imperien wie dem römischen oder in den chinesischen Großreichen die Stärkung der staatlichen Zentralgewalt und die Konsolidierung des Reichs das übergeordnete Ziel war, ist im modernen Weltsystem staatliche Gewalt vor allem ein Mittel, um den Weg für die ungehinderte Vermehrung des Geldkapitals zu ebnen. Markt und Staat sind in beiden Fällen unzertrennlich, aber ihr Verhältnis hat sich tendenziell umgekehrt.96 Dieses neue Verhältnis hat weitreichende Konsequenzen: Weil das System einschließlich der Staaten von der Logik der endlosen Geldvermehrung angetrieben wird, kennt es keinen zu erreichenden und zu konservierenden Endzustand, sondern ist auf unendliche Expansion angelegt
Dies ist das System, das du als „reines Geldsystem“ bezeichnest — in Wahrheit ist die Megamaschine der Ursprung und Architekt dieser Architektur. Und es war von Anfang an verbunden mit Völkermord, Krieg, ökologischer Zerstörung, Massenverelendung, Migration usw. usw.
Die Betonung der Gewalt als strukturierendes Element neben ökonomischen und rechtlichen Neuerungen (z.B. Aktiengesellschaften als juristische Personen mit beschränkter Haftung und unbegrenzter Existenz) ist ein wesentlicher Aspekt. Meine Beschreibung der Megamaschine sehe ich als ein komplexes, verschränktes System politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht. Die Reduktion auf das „reine“ Geldsystem erscheint mir viel zu oberflächlich.
P.S.: Das war nur mein erster Punkt. Ich schlage vor, dass wir deine weiteren Aussagen, bei denen ich anderer Meinung bin, Schritt für Schritt durchgehen. Bist du einverstanden?
„dass es bereits seit Jahren ein System gibt, das diesen Hebel technisch […] definiert“
Und genau da liegt der Knackpunkt. Es ist Technik, und diese Technik läuft auf Hardware, und diese Hardware ist im Besitz – und dadurch unter Kontrolle – von wem …?
Von uns? Das ich nicht lache. Aber ganz laut!
Ich denke der Betrug der Banken an den Staaten läuft folgendermaßen ab..
Stellt euch vor Ihr habt eine Bank A in den USA und eine Bank B in Deutschland. Die Deutsche Bank muss nach Basel nur ca 8% Ihrer Kreditsummen aufbewahren. Jetzt leiht Sie der Bank in den USA einfach Ihr Vermögen plus 92%. Daraufhin kann die Amerikanische Bank der Deutschen einen Kredit geben. Das die Bank sich ebenfalls an Basel ähnliche Kapitalvorschriften halten muss. Kann sie der deutschen Bank ebenfalls Ihr Eigenkapital + 92% als Kredit geben. Jetzt haben beide Banken erst mal haufenweise „Schotter“ und kaufen damit Aktien. Dadurch steigen die Aktien und die Banken haben noch mehr Geld um damit weitere Kredite aneinander zu verteilen. Das Spiel geht solange bis der Markt aufgrund von Inflation oder Rezession zusammen bricht..
Danach werden die Banken dann vom Steuerzahler oder der Steuerzahlerin auf Kosten Ihrer Altersversorgung gerettet (schließlich sind die Banken ja „Systemrelevant“) oder wenn das grade unpopulär ist, dann bricht man halt einen Krieg oder eine Pandemie vom Zaun um Abzulenken und die nötigen Gelder über Umwege an die Banken zu schieben (Kriegskasse oder „Verteidigungshaushalt“)..
Nachdem die Banken „gerettet“ sind, geht das Spiel von vorne los, die Leidtragenden sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in den betroffenen Ländern..
https://www.aba.com/banking-topics/operations/capital
https://www.gevestor.de/finanzwissen/oekonomie/betriebswirtschaft/eigenkapitalvorschriften-basel-iii-722358.html
Mfg Makrovir
Hallo Makrovir,
es ist sehr überspitzt, aber im Prinzip deckt es sich mit meiner Systemanalyse. Danach ist es möglich. Dafür gibt es auch die sogenannten Schattenbanken.
Wenn man alle Banken korrekt bilanziert und die faulen Kredite als Totalausfall verbucht, dann sind die meisten Banken pleite, weil sie ihre Gutschriften nicht auszahlen können. Mit dieser Kontrolle der Bilanzen aber fängt keiner an, weil es dann den sogenannten Domino-Effekt gibt. So läuft das Finanzsystem weiter (in den Untergang) und die am Geldhahn profitieren davon.
Es wird immer mehr Geld durch Kreditvergabe produziert und es muss weg, aber nicht in die Hände der Massen, die damit dann machen, was sie wollen, zum Beispiel Urlaub, Ferien und Party. Rüstung ist ideal für die Finanzleute, ganz besonders auf Staatskredit, das Geld ist für die Allgemeinheit futsch und an der Börse verdienen diejenigen, die sowieso zu viel Geld haben.
Rob Kenius, https://kritlit.de