
Wie Fiatstaaten über Kontraktokratie Monetarsklaven schaffen.
In modernen Gesellschaften gilt ein Vertrag als Inbegriff von Freiheit. Zwei rechtlich gleiche Akteure begegnen sich, tauschen Versprechen aus, setzen ihre Unterschriften und gehen auseinander mit dem Gefühl, freiwillig gehandelt zu haben. Dieses Bild trägt weit: Gerichte überprüfen Formen, Juristen sichern Klauseln ab, Ökonomen feiern die Effizienz privater Übereinkünfte. Doch das Ideal verschweigt seinen Preis. Verträge entstehen nicht im Vakuum, sondern in Feldern aus Knappheit, Drohung und struktureller Ungleichheit. Sie sind keine schwebenden Texte, sondern verdichtete Machtverhältnisse. Wer diesen Rahmen ausblendet, verwechselt „formale Zustimmung“ mit Freiheit. Wer ihn ernst nimmt, stößt auf die Logik von Fiatstaat und Kontraktokratie – und darauf, warum Armut in dieser Ordnung nicht Skandal, sondern ein willkommener Nutzen ist.
Die Kontraktokratie sichert Anerkennung, indem sie Gewalt durch Form ersetzt. Nicht der Knüppel, sondern die Klausel; nicht das Dekret, sondern das „Ich stimme zu“. Das ist die Eleganz der Gegenwart: Herrschaft, die argumentiert, sie sei bloß Verwaltung privater Entscheidungen. Dass diese Entscheidungen häufig unter Bedingungen getroffen werden, die reale Wahlfreiheit ausschließen, darf im Idealbild der dahinterliegenden Ideologie nicht vorkommen.
Der Monetarsklave
Armut passt in diese Architektur als Disziplinartechnologie. Sie erzeugt die ständige Drohung des sozialen Absturzes bis hin zur Verelendung und stellt damit über finanziellen Zwang eine reservierte Zustimmung her. Wer nichts hat, unterschreibt, und wer unterschreibt, stabilisiert die Ordnung, die ihn entleert. Es ist kein Zufall, dass die politische Ökonomie der Gegenwart dauerhafte Knappheit verwaltet – in Wohnraum, Zeit, sicheren Einkommen. Knappheit ist der unsichtbare Editor des Vertragstextes: Sie schreibt hinein, was die Vertragsparteien angeblich „frei“ vereinbart haben. Dass dieselbe Knappheit ökonomisch produziert, rechtlich normalisiert und rhetorisch naturalisiert wird, ist der eigentliche Skandal – nicht der einzelne Missbrauch, sondern die verlässliche Funktion.
Die verwaltete Armut hat eine doppelte Wirkung. Sozial hält sie Menschen in Unsicherheit und damit verhandlungsunfähig. Politisch spaltet sie das Gemeinsame in ein moralisches Narrativ der Eigenverantwortung: Aus strukturell erzeugter Not wird „individuelles Versagen“, aus strukturellem Zwang „mangelnder Wille“. Die Kontraktokratie lebt von dieser Verdrehung. Sie braucht keine Folterkammern, solange es Mahnungen, Sanktionen, Bonitätsscores, Kettenbefristungen und die Scham der Bedürftigkeit gibt.
Der Begriff Monetarsklave benennt diese Lage ohne Ausflucht. Er beschreibt kein Eigentumsverhältnis, sondern eine Ökonomie des Erzwungenen. Monetarsklave ist, wer formal frei ist, faktisch aber durch Armut, Schuldendruck und marktförmige Abhängigkeit so weit entmündigt wird, dass seine Zustimmung zur Ware wird: erkauft durch die Drohung des Entzugs von Lebensnotwendigem. Die Unterschrift geschieht nicht unter der Bedingung „Ich will“, sondern unter der Bedingung „Ich muss“. Rechtlich ist der Monetarsklave Person; sozial ist er Funktionsgröße. Zwischen beiden Sphären vermittelt der Vertrag.
Der Unterschied zu historischen Sklavereien liegt in der Form, nicht in der Struktur. Aus dem Körper, der dem Herrn gehört, wird der Körper, der dem Markt gehorcht. Ketten und Auktionen sind verschwunden; geblieben ist die Logik der Verfügbarkeit. Der Monetarsklave verkauft nicht nur Zeit, sondern zugleich verwertbare Unsicherheit: Er akzeptiert Stunden, deren Zahl der Arbeitgeber nach Bedarf setzt; Wege, deren Risiken er in Kauf nehmen muss; Leistungen, deren Bewertung durch Algorithmen zugeteilt werden, ohne Widerspruchsrecht. Seine „Freiheit“ besteht darin, dass ihm ständig gekündigt werden kann – von Arbeit, Wohnung, Versicherung, Kreditlinie. Wo Rechte fehlen, erscheinen Bedingungen als Natur. Wo Alternativen fehlen, erscheint Zustimmung als Tugend.
Die Kontraktokratie verschleiert diese Zwangslage, indem sie die Sprache der Optionen pflegt. Wer „Nein“ zu einem Vertrag sagt, könne ja „woanders unterschreiben“. Der Wechsel von Arbeitgeber A zu Arbeitgeber B, von Befristung zu Befristung, von Kredit zu Kredit verändert die Struktur nicht, sondern stabilisiert sie: Die Wahl zwischen Varianten desselben Problems gilt als Beweis der Freiheit.
Armut als Disziplin: NAIRU und die politische Ökonomie der Angst
Die Theorie liefert der Praxis das passende Alibi. In ökonomischen Lehrbüchern wird die NAIRU – die Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment – als scheinbar neutrale Größe dargestellt. Hinter der Abkürzung steckt die These, es gebe ein Arbeitslosigkeitsniveau, das nötig sei, um Inflation zu kontrollieren. Würde diese Marke unterschritten, gerieten Löhne und Preise in eine Aufwärtsspirale; würde sie überschritten, drohe Stagnation. Die Schlussfolgerung ist technologisch formuliert: Ein bestimmtes Maß an Nichtbeschäftigung ist systemisch „erforderlich“.
Politisch übersetzt heißt das: Arbeitslosigkeit und Prekarität werden nicht als Übel bekämpft, sondern als Steuerungsinstrument gepflegt. Sie halten Lohnforderungen klein, dämpfen Wechselbereitschaft und machen aus Belegschaften verängstigte Bittsteller. Die berühmte „Flexibilisierung“ des Arbeitsmarktes – Zeitarbeit, Minijobs, Scheinselbstständigkeit – erscheint dann nicht als politischer Entschluss, sondern als Sachzwang. In der politischen Diskussion heißt es, man müsse „Anreize setzen“, „Eigenverantwortung stärken“, „Missbrauch verhindern“. Das Ergebnis ist stets gleich: die Stabilisierung einer Drohkulisse, die als ökonomische Vernunft etikettiert wird.
NAIRU ist in dieser Perspektive nicht nur ein Modell, sondern eine Moral. Sie enthebt politische Entscheidungen ihrer Verantwortlichkeit, indem sie sie als technische Notwendigkeiten darstellt. Doch die angebliche Notwendigkeit regelt nicht Temperatur und Luftdruck, sondern Leben. Sie sagt: Ein Teil der Gesellschaft muss unsicher leben, damit das Ganze „stabil“ bleibt. Dass Stabilität so erkauft wird, nennt die Kontraktokratie Ordnung. Dass diese Ordnung Zustimmung erfährt, ist durch Armut gesichert.
Die Debatten über Arbeitsmarktsanktionen, Zumutbarkeitsregeln und „aktivierende Sozialpolitik“ der letzten Jahrzehnte folgen genau dieser Logik. Nicht der Mangel an guten, existenzsichernden Arbeitsplätzen steht im Zentrum, sondern das Verhalten der Bedürftigen. Nicht Vertragspartner mit ungleicher Macht geraten in den Blick, sondern die schwächere Seite, die angeblich „nicht genug will“. Die NAIRU wird zum unsichtbaren Koordinator einer Kultur, die Unsicherheit rationalisiert und daraus Tugenden formt: Flexibilität, Anpassungsbereitschaft, Selbstoptimierung. Der Preis heißt Stille: Wo existenzielle Angst regiert, wird Widerspruch zur Luxusgeste.
Der Vertrag als Technik der Unterwerfung
Der Vertrag ist die technische Form, in der sich diese Ordnung des emergenten Ökonomiesynkretismus legalisiert. Er ist nicht das neutrale Werkzeug, als das er verkauft wird, sondern ein Machtinstrument mit spezifischen Eigenschaften: Erstens – Asymmetrie: Die Vertragsparteien sind rechtlich gleich, aber materiell ungleich. Auf der einen Seite Unternehmen mit Rechtsabteilungen, Algorithmen, Datenmonopolen; auf der anderen Seite Individuen mit Lebenshaltungskosten. Der AGB-Vertrag, das digitale „Take-it-or-leave-it“, das Kleingedruckte im Kredit – all dies lebt vom Wissens- und Machtgefälle. Wer unterschreibt, übernimmt Risiken, die er nicht kalkulieren kann, und Pflichten, die er nicht verhandelt hat und auch nicht verhandeln darf. Dass die Gerichte AGB-Kontrollen als juristisches Verfahren kennen, ändert am Grundsatz nichts: Die Form bleibt, die Lasten wandern.
Zweitens – Entgrenzung: Verträge fixieren heute, was morgen gilt – und verschieben Risiken in die Zukunft. Befristungen entgrenzen Ketten, Leasing und Abos entgrenzen Zahlungen, Versicherungen entgrenzen Ausschlüsse. Der Vertrag produziert Unsicherheit, die er angeblich absichert: Wer kündigen kann, hält sich Optionen offen; wer kündbar ist, verliert sie. Diese Asymmetrie stiftet Gehorsam, lange bevor eine Klausel greift. Schon die Möglichkeit der Sanktion entfaltet Wirkung. Form ist hier Verhaltenstechnik.
Drittens – Delegation an Maschinen oder Fiatstaaten: Vertragsdurchsetzung wird automatisiert. Der Score entscheidet über Konditionen, der Algorithmus über Sichtbarkeit, der Bot über Sperrung. Wo früher Verhandlung war, greift Plattformpolitik; wo früher Kulanz möglich schien, greift die „Richtlinie“. Die technische Objektivität maskiert, dass die Regeln Interessen folgen.
Wer mit einem Klick die AGB einer Plattform akzeptiert, tritt in eine private Rechtsordnung ein, die sich demokratischer Kontrolle entzieht. So entsteht eine parasouveräne Schicht des Alltags: Privatverfassung unter dem Radar.
Viertens – Externalisierung: Verträge werden so konstruiert, dass Kosten auf jene ausgelagert werden, die am wenigsten abfedern können. Scheinselbstständige finanzieren ihr Werkzeug, tragen ihre Krankheit, bezahlen ihre Ausfallzeiten. Mieter finanzieren Sanierungen über Modernisierungsumlagen. Kreditnehmer zahlen Gebühren fürs Zahlen. Jede dieser Konstruktionen ist „frei vereinbart“. Ihre Freiheit besteht darin, dass es schlechtere Alternativen gibt.
Die Kontraktokratie behauptet, all das sei „Wahl“. Doch Wahl ist nur, was Folgen hat. Eine Entscheidung, die man nicht offen verwerfen kann, ohne den Zugang zu Ressourcen zu verlieren, ist keine Entscheidung, sondern Zustimmung unter Zwang. Es ist das Wesen des Fiatstaats, diese Zustimmung in rechtliche Formen zu übersetzen und damit zu normalisieren. Der moralische Trick besteht darin, aus Not eine Tugend zu machen – und aus Tüchtigkeit eine Pflicht.
Wenn Vertragsform und Armut ineinandergreifen, entsteht das, was unsere Gegenwart antreibt: Monetarsklaverei als Alltagsverhältnis. Sie trägt Krawatte und Lieferrucksack, sitzt am Homeoffice-Rechner oder steht in der Spätschicht. Sie klickt auf „Ich stimme zu“, weil es keinen anderen Button gibt, der morgen die Miete bezahlt. Sie akzeptiert „variable Einsatzzeiten“, weil die Alternative der Verlust des Jobs ist. Sie nimmt „zielbasierte Vergütung“ hin, weil ein Algorithmus sonst die Sichtbarkeit entzieht. Nichts davon braucht einen Schlagstock. Alles davon braucht Knappheit.
Wer Vertragsfreiheit verteidigen will, muss an dieser Stelle beginnen: Frei ist ein Vertrag erst, wenn sein „Nein“ ertragbar ist. Solange die Ablehnung eines Vertrags den Ausschluss von Lebensnotwendigem bedeutet, ist Zustimmung kein Ausdruck von Autonomie, sondern eine Maske des Zwangs. Die Kontraktokratie hat diese Maske perfektioniert. Sie nennt sie Markt.
Man kann diese Logik mit moralischer Anklage beantworten – oder mit begrifflicher Klarheit. Begriffe wie Fiatstaat, Kontraktokratie und Monetarsklave sind nicht rhetorische Zuspitzungen, sondern Instrumente, um das Unsichtbare sichtbar zu machen: dass hinter der Fassade der Freiwilligkeit eine Ordnung steht, die Armut verwaltet, um Zustimmung zu produzieren. Wer diese Ordnung verändern will, muss nicht am Wortlaut einzelner Klauseln feilen, sondern an den Bedingungen, unter denen überhaupt unterschrieben wird: Sicherheit vor Erpressung, Zugang zu Ressourcen ohne Demütigung, Rechte, die nicht mit dem Arbeitsvertrag enden.
Ob Arbeitsvertrag, Mietklausel oder Plattform-AGB: Die Formen unterscheiden sich, der Mechanismus bleibt. Verträge sind nur so frei wie die Armut, die sie umgibt, und nur so freiwillig wie die Unsicherheit, die sie verwaltet. Solange diese Bedingungen politisch gesetzt werden, fördert die Gesellschaft keine mündigen Bürger, sondern erzwungene Zustimmung – und nennt dies Freiheit.
Siehe auch vom Autor: Im Schatten der Kontraktokratie: Wie Fiatstaaten die Demokratie herausfordern.


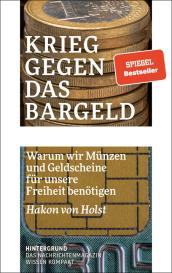
Kapitalimus halt, nichts weiter
Ich nenne es eine „Kakistokratie“!
Keine Herren keine Sklaven!
Meine Wenigkeit hat nie viel von Verträgen gehalten!
Denn, wer Verträge braucht um ein humanes Zusammenleben zu gewährleisten, hat schon verloren!
Meinst du nicht, dass das ein bisschen naiv ist? Wenn du es tatsächlich schaffst, ohne irgendwelche Verträge abzuschliessen durchs Leben zu kommen – gratuliere! Aber… Wie hast du es eigentlich geschafft, deinen Kommentar hier abzuliefern? Hast du etwas die Nutzungsbedingungen abgenickt? Irgendein InternetgertÄt benutzt? Eigenes, wo beim Starten des Geräts die Lizenzbestimmungen zu akzeptieren sind, oder in einem Internetcafé mit Hausordnung und Allgemeinen Geschäftsbedingungen?
Nein, das sind ganz essentielle Forderungen, ohne die humanes Zusammenleben gar nie stattfinden kann.
Keine Ahnung, ich fahre mit Linux und unterschreibe nie etwas.
Das liegt schon einfach daran, das ich es stets geschafft habe, meine wahre Identität zu verschleyern.
Mein Verbindlichkeiten gegenüber anderen Personen, beruhen zu 95% auf den guten alten Handschlag und das schon mein ganzes Leben lang.
Niemals habe ich eine Bewerbung geschrieben, oder einen Schlips getragen, oder mich in sonst irgend einer Weise kompromittieren lassen.
Auch Linux steht unter einer Lizenz:
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
Darum geht´s doch gar nicht.
Es ist doch heutzutage gar nicht mehr möglich sein Dasein zu fristen, ohne sich dem kapitalistischen Verwertungsprozess zu unterwerfen.
@Autor
Vielen Dank, Herr Lommatzsch. Ein sehr guter Artikel (vor allem der Teil in dem es um NAIRU geht)
„Kapitalismus“ ist das eigentliche Problem!
Finde ich auch – toller Artikel. Er geht auf fundamentale Fragen ein und hilft, darüber nachzudenken.
Mal ein Aufruf an alle: wenn Ihr könnt, erwägt an Overton oder Nachdenkseiten zu spenden.
Solche Medien sind unsere Waffen.
Dank an den Autor für die klaren Worte.
Ich kann seinen Ausführungen in Gänze zustimmen.
Wir alle sind Sklaven des Systems. Und er hat völlig recht, wenn er sagt, dass dieses Sklavendasein auch so genannt werden sollte.
Wenn mir eine Verweigerung Nachteile einbringt, ist die Entscheidung nicht freiwillig.
Dabei ist es egal, ob ich als Totalverweigerer, der weder Ersatz noch Kriegsdienst akzeptiert, eingesperrt werde (früher obligatorisch 2 Jahre), oder ob Facebook mich nicht in sein soziales Netzwerk aufnimmt, weil ich den AGBs nicht zustimmen möchte.
Wer dem System nicht in den Allerwertesten kriechen möchte, muss die Nachteile in Kauf nehmen, um frei zu sein.
Allerdings kann man diese Freiheit nicht essen.
Womit wir beim Thema Widerstand wären.
Ist es ok, dass ich mir nehme, was ich brauche, um zu leben, wenn man mich zwingen will, ein Sklave zu sein?
Ich denke, das fällt schon unter Widerstand und Freiheitskampf.
+++
Vielen Dank für diesen sehr klugen und unbedingt lesenswerten Artikel.
+++
…verteh ich nich????
Meinen Vorrednern kann ich mich nur anschließen. Ein wirklich guter Artikel, mal ganz praktisch auf die Mittel und Wege geschaut, mit dem die Mächtigen ihre Vormachtstellung behaupten, nämlich durch Verträge. Der Clou vom Ganzen ist aber, dass man dabei so tut, als geschähe das alles um der Gerechtigkeit willen. Und alle, auch dieser ansonsten ausgezeichnete Beitrag, suggerieren, dass alles sei ein unabänderliches Schicksal. Ist es nicht. Es gab immer Revolutionen, die diese Verhältnisse auf den Kopf gestellt haben, wenn die da oben es zu arg getrieben haben und ein Funken Widerstandigkeit vorhanden war. Eine Revolution führt zu einer Änderung der Machtverhältnisse – aber dann sind andere am Zug, nicht durch Verträge, sondern duch die Guillotine. Könnte man das nicht im Interesse aller Beteiligten irgendwie friedlich lösen, aber mit einer Revolution als realer Drohkulisse?
„Friedlich“ wird sich gar nichts mehr lösen lassen.
Die herrschende Klasse will uns töten!
Wir oder die!
Genau, rette sich wer kann.Kuba und Nordkorea sind die letzten Inseln der Hoffnung. Dort herrscht noch Wohlstand und Gerechtigkeit. Kim jong Un ist der Retter aller Wittwinnen und Waisenknaben.
Das sind genau die typischen Argumente der Konservativen. GÄHN 🙁
Wobei, Kuba mehr oder weniger auf den westlichen Kurs eingeschwenkt ist.
Hier, dein 🐟
Ich mag keinen Fisch, gib mir lieber eine Currywust
Currywurst ist gerade aus. Aber vielleicht schmeckt Ihnen das ja auch 😉
🍞🥨🍺
Diese ewigen Fische find ich auch langsam langweilig. Zumal diese immer
dann verteilt werden, wenn die Argumente ausgehen.
Welche Argumente?
Gegen Dummheit gibt es keine Pillen!
Stimmt, da muß ich Ihnen ausnamsweise mal recht geben, denn bei Ihnen kann man sehr gut erkennen, daß diese Pille noch nicht
erfunden wurde.
Erwerbsregeln 10 und 285.
» Wie Fiatstaaten über Kontraktokratie Monetarsklaven schaffen.«
Was ist denn das für eine Sprache? Wenn es Deutsch sein soll (was ich fast befürchte) ist es jedenfalls grauenhaft schlechtes. Muss das sein?
Neue Neologismen braucht das Monetarsklaven-Land!
Kontraktokraten aller Kanzleien, kontrahiert euch!
Fiat Luxemburg, ÖPNV-Freiheit¹ jetzt!
¹ https://luxtoday.lu/de/blog/luxemburgische-offentliche-verkehrsmittel , Versehentlich kein Nonsens
Na dann gib uns doch mal bitte deutsche Vokabeln für die drei Wörter: Fiatstaaten, Kontraktokratie, Monetarsklaven.
Und bringe sie auch gleich in einem kurzen Satz unter. Danke, (ich habe es vergeblich versucht)
I
Also ich vermute, dass „Fiatstaaten“ Staaten sind in denen viele Autos der Marke FIAT unterwegs sind.
Nennt sich „industrielle Reservearmee“. Aber klar, wenn Marx das seit 150 Jahren kritisiert – ist es von gestern. Aber wenn es bürgerliche Ökonomen recyceln und NAIRU dazu sagen, dann ist es der letzte Schrei. Das ist auch der Grund warum die Kontrolle der Einwanderung leider, leider „uns sind die Hände gebunden“ immer nicht gelingen will. Steigende Löhne – eine Katastrophe für unsere Wirtschaft. Da muss unbedingt mit viel Willkommenskultur gegengesteuert werden.
Spricht doch nicht gegen den Beitrag, weil Großmeister Marx keine Fußnote bekam. Die korrekte Erklärung zählt.
War doch mal eine brauchbare Ausnahme, dieser Beitrag. Besonders für weniger belesene Zeitgenossen hier auf Overton.
Mich stört allgemein das begriffliche Aufplustern. Monetarsklave für Lohnsklave, Knappheit für Armut, Kontraktokratie – Vertragsherrschaft. Eigentlich beschreibt Lommatzsch den stummen Zwang der Verhältnisse.
Soll das bedeuten der Zweck der Armut bestünde darin, die Leute zum Zustimmen zu bringen? Nein. Arm sind sie weil der Lohn eine Kost ist, also Abzug vom Gewinn. Mehr Geld befördert die Zustimmung nicht weniger.
Oder hier:
Ok, würde ich mitgehen. Aber nicht beim folgenden.
Der Gegensatz ist verkehrt. Es stimmt dass der Lohnarbeiter, weil er doppelt frei ist, keinem Herrn unterworfen und frei von Produktionsmittel, keine Wahl und Lohnarbeiten muss. Dem System muss er deswegen aber nicht zustimmen. Seine Zustimmung zu den Verhältnisse folgt nicht aus dem stummen Zwang der Verhältnisse. Logisch wäre ja eher das umgekehrte: Wenn ich hier keine andere Wahl hab, als Verträge zu unterschreiben, die meine Physis kaputt machen und mich in Armut halten, dann ist das ein Grund für Ablehnung. Warum sollte daraus Zustimmung erwachsen? Die Zustimmung zu einem Vertrag mag Zwang sein, weil es keine Wahl gibt, die Zustimmung zu den Verhältnissen aber nicht. Darin betätigt sich der Monetarsklave sehr wohl als mündiger Bürger und das ist kein Lob des mündigen Bürgers.
Marx lebte im 19ten Jahrhundert, während Landflucht und industrieller Revolution. Er dürfte auch noch den Goldstandard mitbekommen haben, damals gab es noch keine FIAT-Money-Systeme und ich würde mal davon ausgehen, dass die Armut (die m.W. keine sozialen Sicherungssysteme kannte) keine Absicht war, auch wenn sie den Industriellen zum Teil nutzte, „nur zum Teil“ deshalb, weil Armut natürlich auch Absatzschwierigkeiten, Kriminalität und soziale Unruhen usw. mit sich bringt (daraus dürfte er sein „Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate“ abgeleitet haben, welches in der Realität nicht nachweisbar ist, weil er mehrere Faktoren unbeachtet lässt).
Die Situation heute ist eine ganz andere, wenn man heutzutage von Industrie spricht, meint man i.d.R. Facharbeiter mit einer relativ hohen Qualifikation und relativ hohem Einkommen (nicht selten tarifgebunden), allein deshalb weil die einfachen Arbeiten alle längst automatisiert sind. Prekär beschäftigt ist man als Reinigungskraft oder Erntehelfer, auch weil da die Anforderungen (u.a. an Sprachkenntnisse) gering sind. Ich will soziale Probleme nicht schönreden, aber von einer „industriellen Reservearmee“ zu sprechen, ist heutzutage faktisch falsch, Fachkräftemangel usw.
„, dass die Armut (die m.W. keine sozialen Sicherungssysteme kannte) keine Absicht war“ LOL. Ehrlich du musst mal Marx lesen oder dir als Hörbuch anhören. K1 III. Die Produktion des absoluten Mehrwerts 8. Der Arbeitstag
Das war Absicht.
„Ich will soziale Probleme nicht schönreden, aber…“ Da kam eben gerade ein Kaberettprogramm in 3Sat: Timo Wopp, „Ja, sorry“ Der hat genau diese Floskel auseinandergenommen. Nach dem „aber“ kommt immer die Bestätigung dessen, was man vorher beschwört nicht zu sein. „Ich bin ja kein Rassist, aber…“ Ich bin ja nicht frauenfeindlich, aber..“ Doch du redest soziale Probleme schön, wenn du leugnest, dass es eine industrielle Reservearmee gibt. Erst behauptest du alle seien Facharbeiter und und dann nennst du selbst die bekannten Berufe aus dem Niedriglohnsektor.
Seit wann hat Marx sich um Tagespolitik gekümmert ? Hat er nicht:
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Das+Kapital/III.+Band%3A+Der+Gesamtproze%C3%9F+der+kapitalistischen+Produktion/III.+Gesetz+des+tendenziellen+Falls
Er leitet aus seiner verkorksten Wertdefinition ab, dass der Lohn (als angeblich einzige Variable, um den „Mehrwert“ zu erhöhen) immer sinken muss, was im Umkehrschluß die Nachfrage senkt, so dass der „Mehrwert“ noch weiter sinkt. Logische Schlußfolgerung: der Kapitalismus muss zusammenbrechen und es geht immer nur bergab.
Ist es nicht so? Stimmt nur eben nicht mit der Realität überein…
Dann gibt es also „industrielle Reservearmee“ und „Fachkräftemangel“ gleichzeitig? Was mich bei euch Linken immer verwirrt, ist, dass ihr Widersprüche einfach wegignoriert.
Wir haben übrigens auch mittlerweile Arbeitsgesetze, Mindestlohn, Gewerkschaften und so Kram, schonmal von gehört?
Ich meine, ich habe das ziemlich gut begründet, du gehst leider nicht darauf ein, also muss ich davon ausgehen, dass du es nicht verstanden hast und dich stattdessen an Formulierungen hochziehst.
Der Spruch ist übrigens unpassend, weil ich nicht beschworen habe, etwas nicht zu sein. Auf argumentum ad hominem lasse ich mich nicht ein, das macht linken Rudelenkern zwar enormen Spaß, mir ist das aber schlicht zu blöde und erkenntnisfrei.
Und übrigens bin ich mir der sozialen Probleme, die es hier und da gibt (auch und vor allem Dank Armutszuwanderung), durchaus bewusst, aber sie ausgerechnet der Industrie anzulasten (in der ich arbeite und gut verdiene) ist weltfremder linker Schei**dreck!
Dass bei Vollbeschäftigung die Inflation hochschnellt, ist eine Binse, ich bin nicht sicher, ob Kausalität oder nur Korrelation (Vollbeschäftigung gibts nur wenn ausreichend Geld da ist, hohe Geldschöpfung führt aus sich heraus schon zu mehr Inflation). Darf man also im Umkehrschluß annehmen, dass Herr Lommatzsch gerne eine hohe Inflation hat (und dann nicht herumjammert, wenn sie da ist)? Oder habe ich überlesen, wie er das Dilemma lösen möchte (sehr schwierig)? Vollbeschäftigung hat übrigens noch andere Nebenwirkungen, Zuwanderung zum Beispiel, und wir wissen wie „gut“ Deutschland damit klar kommt und wie superstreng da kontrolliert wird (wer Ironie findet, darf sie behalten), Zuwanderung wiederrum verknappt u.a. den Wohnraum, was die Inflation weiter anfeuert, denn bei Wohnraum ist es genauso, es muss ein gewisser Leerstand herrschen, damit Vermieter nicht gar zu unverschämt werden.
Gott sei Dank haben wir in diesem Land eine Grundsicherung, so dass man im Normalfall eben nicht damit rechnen muss, auf die Straße zu müssen, wenn man mal den Job verliert…
Aber nicht mehr lange.
Ja, denn sie werden uns alle töten !1!!
Genau, das steht auf ihrer Agenda….bis auf ein paar Arbeitssklaven natürlich!
Ich weiß das, weil ich selbst aus ihrem Schoß entstamme und viele Verbindungen hatte.
Man kann aner auch mal die Agenden von WEF oder UN lesen…macht aber wohl keiner.
Verlink doch mal, an welcher Stelle sie das mit dem Töten verstecken, die Agenden müssten doch alle online sein, oder nicht?
Und wie lange bist du aus dem Schoß schon raus?
Müssen sie gar nicht verstecken. Es gibt sogar ein Ministerium dafür, das in den USA kürzlich in Kriegsministerium umbenannt wurde, wo täglich Aufrufe dazu gibt die Nation endliche kriegstüchtig zu machen. Als Overtonleser hast davon noch nichts mitgekriegt? – Na ja wundert mich nicht wirklich.
Nationen kriegstüchtig zu machen ist nicht identisch damit, Menschen zu töten. Im kalten Krieg rüstete man jahrzehntelang auf, ohne das es zum Clash kam (abgesehen von einigen Stellvertreterkriegen).
Ein gutes Geschäft für den MIK… und ein guter Grund zu hyperventilieren. Soll ja sogar Leute gegeben haben, die deshalb keine Kinder machten, weil ja alles so furchtbar und ohnehin bald vorbei ist.
Die Kriegsartikel nerven mich nur noch, man kann es auch übertreiben mit dem Angstporno. Nicht, dass ich die Entwicklung begrüße, im Gegenteil.
Lesen sie Yuval Harari, oder was der Peter Thiel so von sich gibt.
Ich hoffe nicht, das ich hier erklären muss, wer das ist. 😉
Ich war niemals wirklich raus, nur, konnte ich meine Identität meist gut verschleyern.
Je nachdem in welcher Gesellschaft ich eben verkehre.
Das brachte mir bestimmt auch so manche Vorteile, bei der herrschenden Klasse, widerte mich aber fast immer nur an.
Seinem Namen kann man eben nur schwer davonlaufen.
Ein griffiges Zitat hast du nicht parat? Oder steht das jetzt dann doch nicht so explizit in ihrer Agenda (sondern ist mal wieder nur angstgetriebene Interpretation)?
Nicht, dass ich das komplett ausschließe, es gibt mit Sicherheit bösartige Kreise, aber deren Größe und Wirkmacht einzuschätzen, ist alles andere als trivial (und was es noch viel mehr gibt, sind aufmerksamkeitsheischende Autoren und Spinner aller Art).
Klingt schwer berühmt. Leider machst du immer nur Andeutungen, was du Furchtbares von der „herrschenden Klasse“ zu wissen meinst. Wie wäre es mit einigen Anktoden, musst ja keine Namen preisgeben.
Ich möchte nochmal an dieser Stelle den messerscharfen Unterschied zwischen Sozialismus und sozialer Marktwirtschaft darlegen.
Im Sozialismus wird umverteilt und zwar so
das tatsächlich Reiche ärmer und Arme reicher werden.Selbstverständlich nicht fürs Nichtstun wie die Bild – Zeitung schreiben würde
im Sozialismus strebt man Vollbeschäftigung an.
In der sozialen Marktwirtschaft wird etwas dazu getan damit der Kapitalismus schneller läuft. Dieses dazu ist übrigens oft giftig.
Und jetzt habe ich auch die passende neue Bezeichnung fürs Bürgergeld auf das sich die
CDU und SPD einigen können
Schmiergeld.
Das Problem bei diesen Kapitalismus der immer schneller läuft ist das er zu schnell wird als das
a: Der Kapitalismus sich selbst regulieren könnte so wie Hayek sich das gedacht hat
oder
b: Man daraus eine Planwirtschaft machen kann um schlimme Auswirkungen zu verhindern.
soziale Marktwirtschaft ist sozusagen
unregulierte Planung oder geplante Unregulierung.
Aus Gründen der Progressivität.
Diese Progressivität ist das stabilisierende und gleichschaltende in der Gesellschaft.
Doch nebenbei akkumuliert die SM ein Haufen Probleme die stets auf die lange Bank geschoben werden.
Leute schaut euch nochmal um.
Seit zig Dekaden wird in der Politik im Grunde genommen immer die gleichen Probleme bequatscht.
Doch es ändert sich nichts.
Es wird zwar andauernd zwar so getan meistens mit Geld doch es sind stets nur Tropfen auf heiße Steine.
Es würde mich nicht wundern wenn man LLMs tunen könnte jetzt Artikel zu schreiben die in ein paar Monaten „Aktuell“ werden.
Und daran werden auch Zehn neue Parteien nichts ändern.
Mittlerweile werden nicht nur alle „Klimaziele“ mit Anlauf gerissen, die gesellschaftlichen Unterschiede feiern Rekorde (oder auch nicht), sondern man befindet sich jetzt auch oder fast im dritten Weltkrieg.
Mein Hauptkritik an der SM ist das diese eine Gesellschaft weder zu einen guten Konsens steuert noch das die SM wenigsten das schlimmste verhindert.
Die nackte Wahrheit auf den Punkt gebracht! Chapeau! Sollten sich Sozialpolitiker der LINKEN mal reinziehen, statt auf ein Pöstchen zu hoffen, von dem aus man die Almosen der Kapitalfraktion verteilen kann. Fundamentalopposition wäre die einzig richtige linke Antwort.
Ich kann mit dem Text nichts anfangen. Und er ist sachlich falsch. Auf den Punkt gebracht ist hier gar nichts, stattdessen versteigt sich der Autor in absurde Behauptungen. Beispiel:
Die Gewalt wird nicht durch Form ersetzt, der Vertrag ist die Verlaufsform der Gewalt. Gegensätzliche Interessen werden in eine Verlaufsform gebracht, die dafür sorgt, dass der Gegensatz dauerhaft erhalten bleibt. Der Staat anerkennt die jeweiligen Interessen, der Lohnarbeiter soll als Lohnarbeiter sein Auskommen finden können, also seine Arbeitskraft nicht über Gebühr verschleißen müssen. Das ist kein Dienst am Lohnarbeiter, sondern soll bewirken, dass die Klasse der Lohnarbeiter dauerhaft fürs Kapitalwachstum zur Verfügung steht.
Das wäre -grob vereinfacht- der Grund für staatlichen Regelungen, also das Interesse des Staates an der kapitalistischen Ausbeutung, die aber auf Dauer gestellt.
Dass das in der Form des Vertrags zwischen freien Personen passiert, der Lohnarbeiter also formal dem Kapitalist gleichgestellt ist (und nicht als Leibeigener oder Sklave) ist die Freiheit, die die bürgerliche Gesellschaft vorsieht, und nicht bloßer Schein. „Wahlfreiheit“ ist gegeben, auch wenn die Wahl sich auf lauter Varianten der Lohnarbeit eingeschränkt ist.
Um es vom Kopf auf die Füße zu stellen: eine Ökonomie, die auf Ausbeutung beruht, kennt notwendigerweise Ausgebeutete. Die Freiheit, die Bürger tatsächlich haben, besteht darin, versuchen zu dürfen, die Seite (Klasse) zu wechseln. Vom Tellerwäscher zum Millionär ist die Perspektive, die der Kapitalismus bietet. Darin unterscheidet sich die Klassengesellschaft von Kastenwesen.
„Vom Tellerwäscher zum Millionär ist die Perspektive, die der Kapitalismus bietet.“
Damit wurde das Gott-Gegebene, das Statische aufgehoben, das Axiom akzeptiert, dass (vom Ideal her) grundsätzlich alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben. Was immerhin eine zivilisatorische Errungenschaft der Menschheit auf dem Weg ins Paradies (oder dem Kommunismus) ist.
Manch einer ist damit zufrieden, dass wenige Einzelne der Armut entrinnen können. Schlauere Menschen kritisieren das Prinzip der kapitalistischen Ökonomie
Ihr letzter Satz zeichnet gut Ihre Voreingenommenheit, wonach Menschen, die nicht Ihrer Kritik des Kapitalismus zu stimmen, Dumme sind. Wie fühlt es sich an, sich in seiner Schlauheit zu sonnen?
„Selig sind die geistig Armen“ heißt es nicht umsonst. Wer dumm ist, der bemerkt es zumeist nicht.
Schlaue Menschen leiden hingegen darunter, dass ihnen ständig Dummheiten aller Art präsentiert werden, wie z.B. ihre Feststellung, dass ein zivilisatorischer Fortschritt zu verzeichnen sei, wenn die Grenzen zwischen den Klassen nicht mehrt gottgeben seien. Sie würden das vermutlich auch abfeiern, wenn in der Sklavenhaltergesellschaft einzelne Sklaven zu Aufsehern aufsteigen dürfen, und nicht einmal bemerken, dass das zu der Organisation der Gesellschaft dazugehört.
Nein, ich sonne mich nicht, ich leide zumeist unter der Dummheit meiner Mitmenschen. Bin aber gerne bereit, denen aus ihrer Dummheit herauszuhelfen.
Marx sprach vom „doppelt freien Lohnarbeiter“: frei von Eigentum an Produktionsmittel und frei, sich seinen Ausbeuter selbst auszusuchen.
Die dritte Freiheit, nämlich sich frei von Ausbeutung zu machen, konnte Marx schon damals nirgendwo erkennen. Er sah schon damals nur einen Weg, sich als Klasse von Ausbeutung zu befreien.
Lottogewinner gab es schon immer. Lotteriespiel als Freiheit zu bezeichnen, finde ich einen sehr missglückten Witz. Du hast gar nichts auf die Füße gestellt, sondern nur versucht, einen Nebel um den Kopfstand zu erzeugen.
Gewalt (und Zwang) ist allgegenwärtig und auch natürlich (vorausgesetzt man versteht darunter mehr als nur die rohe körperliche Gewalt). Die sogenannte Gewaltlosigkeit bedeutet nur, dass Gewalt zivilisiert wurde und damit erträglicher oder nicht mehr spürbar ist. Die funktionellen Werkzeuge dafür wären Moral und Ideologie einer Gesellschaft und auch das Rechtssystem des Staates bis hin zur Vertragsfreiheit. Kurz: Es ist der ideologische Überbau, der die Gewalt und den Zwang erträglicher gestaltet und weniger spürbar macht. Das gilt nicht nur für die kapitalistische (oder liberale) Demokratie sondern grundsätzlich für alle Gesellschaftsformen.
I-V-G hat um 8:59 bereits einige Positionen des Artikels korrekt angegriffen. Ich möchte das präzisieren.
Auch wenn wir für das Attribut „modern“ korrekt „bürgerlich“ einsetzen – gemäß dem Kompendium des „bürgerlichen Gesetzbuches“, das übrigens mit einigen Anpassungen aus dem römischen Recht überrnommen worden ist! – ist die Aussage banal falsch, nämlich entweder ignorant, oder taktisch gelogen. Das „bürgerliche Gesetzbuch“ ist ein Konvolut umfassender gesetzlicher Beschränkungen einer den Untertanen eines Staatswesens prinzipiell eingeräumten Vertragsfreiheit. Die Beschränkungen reichen vom gesetzlichen Verlangen nach gegenständlicher und juristischer Schlüssigkeit, über Verstöße gegen übergeordnetes Gesetz, bis zur „Sittenwidrigkeit“. Mit direktem Blick auf diejenige Abteilung sogenannter „Willensfreiheit“, die in Vertragsfreiheit gegenständlich sein soll, könnte man daher mit Fug sagen, das römische Recht hat der privateigentümlichen Sklaverei – die auch das Staatswesen für sich beansprucht hatte – eine Staatssklaverei zur Seite gestellt, die bis auf den Tag erhalten wurde und Geltung hat.
Doch das interessiert Lommatzsch nicht, vielleicht deshalb nicht, weil er zu vermeiden sucht, mittelbar libertären Ideologien das Wort zu reden. Jedenfalls will er nicht das bürgerliche Vertragswesen angreifen, sondern ausgewählte Voraussetzungen desselben, und ausgewählte Bedingungen seiner Wirksamkeit in der Reproduktion der Untertanen und der Herrschaft über ihnen, weshalb er abstrakt von „Freiheit“ reden will, statt gegenständlich.
Die österreichische Verfassung ist in dem Punkt übrigens konsequenter und systemisch sauberer, indem sie der Vertragsfreiheit, die eine Abteilung des Eigentumsrechtes ist – jeder Vertrag setzt ein Eigentum an Vertragsgegenständen entweder voraus oder etabliert eines! – eine „Erwerbsfreiheit“ zur Seite stellt. Gegenstand solcher „Erwerbsfreiheit“ ist genau die einst von Marx „doppelt frei“ genannte Person, die nichts weiter besitzt – ökonomisch gesprochen – als seine persönliche Leib-Eigenschaft.
Im Satzteil, den ich hervor gehoben habe, wird die grundgütige Verlogenheit des Lommatzschen Textes fassbar:
Er weiß doch bitte, wie jedermann, der sich in der bürgerlichen Welt zu bewegen hat, ihr eigentümliches Vertragswesen ist Gegenstand und Resultat umfassenden militärischen Zwanges. Falls Leute es bei bürgerlichen Geschäften beliebiger Art versäumen, diesbezügliche Verträge zu schließen, tritt das Staatswesen in ihre Leib-Eigenschaft ein, und dekretiert ihr Handeln und ihre Händel zu vertragsgemäßen oder vertragswidrigem Handeln, gemäß bürgerlichem Gesetzbuch und Strafrecht, setzt sogenannte „konkluente“ Verträge an die Stelle der von den Handelnden versäumten Verträge, und setzt das zugehörige gegenständliche Recht – darunter auch das Recht auf Arbeitslohn – ggf. gerichtlich und polizeilich durch. Im Falle eines staatsanwaltlich festgestellten „öffentlichen Interesses“ gilt das auch gegen den Willen der an „stummen Verträgen“ beteiligten Personen.
Deshalb könnte – und sollte vielleicht – der Analytiker diese Verhältnisse zuspitzen und sagen: Das bürgerliche Staatswesen, wie schon seine europäischen Vorläufer, gebietet ein Vertragswesen, weil es prinzipiell Pakte zu verbieten trachtet. Dazu zählen natürlich in erster Instanz gesetzwidrige („kriminelle“) Pakte, sofern sie „öffentliches Interesse“ berühren, aber in zweiter Instanz ständische Pakte, die ich eines im gg. Zusammenhang prominenten Bestandteils halber erwähnen will: Syndikate.
Lohnabhängige, die Syndikate zu errichten trachten, deklariert das bürgerliche Recht zu Kriminellen, sie haben Gewerkschaften zu bilden und sich daraufhin an Gewerkschaftsrecht zu halten.
Damit bin ich bei I-V-G’s Satz:
Politökonomisch gesprochen ist der Satz korrekt, obwohl er juristisch und staatsrechtlich falsch ist, weil „die Gewalt“ – sprich das Gewaltmonopol des bürgerlichen Staates – in bürgerlichen Verträgen kein Gegenstand ist – gemäß der Unterscheidung zwischen bürgerlichem Gesetzbuch und Strafgesetzbuch – vielmehr Bestandteil sämtlicher Vertragsgegenstände ist, nämlich in erster Linie vermittels des Eigentumsrechts.
Die Wortbildung „Kontraktokratie“ leistet folglich eine Verschleierung der wahren Verhältnisse, dessen Interesse ich hier zunächst offen lasse.
Auf jeden Fall hat Lommatzsch auch einige bedenkenswerte Erwiderungen herausgefordert, wie auch deine hier.
Danke dafür.
„Wie Fiatstaaten über Kontraktokratie Monetarsklaven schaffen.“
In EINEM Satz gleich drei neue Begriffsschöpfungen. Da mir diese Begriffe trotz häufiger Anwesenheit auf den einschlägigen Foren noch nicht untergekommen sind, scheinen sie SChöpfungen des Autors zu sein. NUR: was soll uns der TExt sagen?
Ich schließe mich da @amenophis an:
Was ist denn das für ein Deutsch?
Ich füge hinzu: Was soll der Sinn des ganzen sein?
Es scheint sich mal wieder um einen dieser TExte zu handeln, die immer öfter auftauchen, wo mit klangvollen und scheinbar wissenschaftlichen Begriffen banale Aussagen zu „Hochwissenschaftlichem“ aufgepeppt werden sollen. die aufgepeppte Sprache und gewundene Satzbildungen ohne erkennbare Zusammenhänge täuschen hinweg über die Inhaltsleere. Viele Fremdwörter sind noch keine Wissenschaft und viele Wortschöpfungen. Viel Unverständliches in Wort- und Satzbildung schließt noch lange nicht auf tiefes Wissen, manchmal ist das einfach nur Ausdruck vom GEgenteil, wovon aber gut abgelenkt wird. So kann dann jeder Leser so tun, als hätte er verstanden, was der TExt sagen will, und sich damit im kleinen Kreis der wenigen wähnen, die mehr zu wissen glauben als die anderen.
Ich wünschte mir, jeder Artikel bei Overton hätte das Niveau dieses Beitrages von Herrn Lommatzsch.
Aber ich weiß, dass das wohl ein bisschen viel verlangt wäre…