
Das Ansehen der links-liberalen Regierung von Präsident Gabriel Boric, der einer der Anführer der Studentenproteste war, geht den Bach runter.
Eigentlich wollte die chilenische Regierung noch im Januar ihre Rentenreform durch den Kongress bringen – ein langwieriges Projekt, an dem sich schon verschiedene Präsidenten versucht hatten. Denn im Andenstaat ist allen klar, dass die Privatisierung der Altersversorgung – seinerzeit durch die Pinochet-Diktatur verfügt – zu einer extremen Altersarmut geführt hat. Das betrifft nicht nur Arbeiter und kleine Angestellte, sondern auch Beschäftigte mit hohen Einkommen; diese können im Alter ihren Lebensstandard nicht halten, sondern sind auf Ersparnisse oder die Kinder angewiesen.
Präsident Gabriel Boric und seine links-liberale Frente Amplio (Breite Front) haben im Parlament keine eigene Mehrheit, und die mit ihnen in einer Koalition verbandelten Sozialisten und Sozialdemokraten stimmen regelmäßig mit den konservativen und ultra-reaktionären Parteien und sorgten dafür, die ersehnte Rentenreform komplett zu verwässern. Nicht nur die Experten aus dem gewerkschaftlichen Umfeld lehnen sie inzwischen ab, weil sie am Grundfehler nichts ändert, denn das lukrative Geschäft bleibt, wenn auch unter einem neuen Namen, in den Händen der Banken und Versicherungen. Es wird keine Rückkehr zum Umlageverfahren geben, zu jenem staatlichen System, in dem die Beitragszahler nicht Kapital für ihre eigene Rente aufbauen, sondern die Altersbezüge durch die laufenden Zahlungen der Beschäftigten finanziert werden.
Inzwischen fordern Politiker der Kommunistischen Partei, die Mitglied der Regierungskoalition ist, das Projekt komplett in die Tonne zu treten. Der ehemalige Bürgermeister der Kommune Recoleta, Daniel Jadue (KPC), meinte gerade, dass es besser sei, „das Vorhaben zurückzuziehen, das nur dazu führt, die Profite und den Betrug der AFP zu erhöhen“.
AFP steht für „Administradoras de fondos de pensiones“, eine Handvoll private Versicherer, die jeden Monat die Abgaben der Lohnabhängigen einstreichen und astronomische Gebühren für die Verwaltung verlangen. Bei denen hat der Beitragszahler ein individuelles Sparkonto, von dem er später leben soll, jedenfalls ein paar Jahre lang; lebt er länger, ist sein Konto leer, seine Ersparnisse aufgebraucht. Dann kann er nur noch um eine winzige staatliche Unterstützung betteln. Von einem gesicherten Lebensabend also keine Spur. Arbeitnehmer, wie etwa die Lehrer, die im staatlichen Umlagesystem geblieben sind, erhalten doppelt so viel Rente wie die, die sich für das AFP-Modell entschieden hatten.
Das 1,2,3 – Projekt
Seit dem Ende der Diktatur (1990) wurde an einem neuen Rentensystem gebastelt, und heraus kamen eine Mindestrente – gezahlt nicht etwa von den privaten Versicherern, sondern vom Staat – sowie einige Hilfsleistungen, ebenfalls aus dem staatlichen Säckel. Das Projekt der Boric-Administration sollte Abhilfe schaffen, konkret einen neuen Fonds, in den die Arbeitgeber einzahlen. Sechs Prozent des Lohns sollen dort hineinfließen, eine Menge Geld. Klar war aber von Anfang an, dass das System der individuellen Sparkonten nicht angetastet würde und dass es keinesfalls eine Rückkehr zum Umlagesystem geben wird.
Zunächst wurde über die Verwaltung dieses Fonds gefeilscht, und diese Diskussion gewannen die Versicherer, die auch in Zukunft über die Verwendung dieser 6 % entscheiden werden. Dann wurde über die Zahl gestritten, und am Ende blieb nur ein Prozent für diesen Fonds übrig, mit dem spezielle Arbeitsförderungsmaßnahmen, u.a. für Frauen, finanziert werden sollen.
Zwei Prozent fließen auf das individuelle Konto des Versicherten, um diesem später eine höhere Rente in Aussicht zu stellen. Und die restlichen drei Prozent fließen auf die Konten der Rentner, um deren aktuelle Bezüge zu verbessern.
Enttäuschung an allen Ecken
Der Staat wird also weiterhin die Profite der Banken und Versicherungen mit Steuergeldern finanzieren, statt für ein funktionierendes Rentensystem zu sorgen, kritisiert die Plattform Ciper.
Die Abschaffung der AFP war eine der wichtigsten Forderungen der Studentenproteste und der Revolte vom Oktober 2019, und Gabriel Boric stammt aus dieser Bewegung. Doch seine Projekte scheitern an der fehlenden Mehrheit im Kongress, an der Macht der Konzerne und an seinen eigenen Parteigängern, die sich im parlamentarischen System eingerichtet haben.
So wurde im Dezember ein Anti-Terrorismus-Gesetz beschlossen. Künftig reicht eine Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“ für eine Verurteilung zwischen 5 und 15 Jahren aus, konkrete Straftaten müssen dem Angeklagten nicht mehr nachgewiesen werden. Selbst eine Einzelperson stellt eine solche Vereinigung dar, es braucht nicht mehr die mindestens drei Mitglieder; von „lobos solitarios“, von einsamen Wölfen, war in den Debatten die Rede. Und schon die Planung steht unter Strafe, sowie die Finanzierung oder Unterstützung.
Ob das auch für Verteidiger der Menschenrechte gilt, werden die Richter entscheiden müssen, von der Politik jedenfalls ist wohl das gewollt. Abhören der Telefone und der Einsatz verdeckter Ermittler wird einfacher gemacht. Im Senat gab es dafür 41 Ja-Stimmen, drei waren dagegen, vier enthielten sich. Im Kongress stimmten 102 Abgeordnete dafür, 30 enthielten sich oder waren dagegen, wie die Kommunisten und einige Abgeordnete der Boric-Partei; sie störten sich an der Legalisierung der IMSI-Catcher. Das sind Geräte, mit denen die auf der SIM-Karte eines Handys die International Mobile Subscriber Identity (IMSI) ausgelesen und der Standort eines Mobiltelefons innerhalb einer Funkzelle bestimmt werden kann.
Das Gesetz wird sich vor allem gegen den Widerstand der Mapuche-Indianer im Süden des Landes richten. Während die vorige rechte Regierung nur wenige Monate den Ausnahmezustand ausgerufen hatte, existiert dieser dort praktisch ununterbrochen seit dem Amtsantritt der Boric-Regierung.
Korruptionsskandale
Lange Zeit glaubten die Chilenen, trotz aller Kritik an ihrer jeweiligen Regierung, dass ihr Land gegen Korruption wie im Nachbarland Argentinien relativ gefeit sei. Doch dann deckte Ciper den Fall Luis Hermosilla auf, ein ausgefeiltes System von Bestechungsgeldern, das bis hinauf in den Obersten Gerichtshof reichte. Das System des Wirtschaftsanwalts funktionierte jahrelang, bis Mitschnitte aus seiner Kanzlei an die Öffentlichkeit gerieten. Konkret ging es um ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung und der Vorlage von 10.000 gefälschten Rechnungen. Polizei, Richter und hochrangige Politiker der reaktionären UDI-Partei wie Andrés Chadwich waren verwickelt. Immerhin wurden Richter suspendiert, Hermosilla sitzt in Untersuchungshaft.
Und dann war da der Fall von Manuel Monsalve, Sozialist und mächtiger Unterstaatssekretär im Innenministerium. Seine Assistentin beschuldigte ihn im Oktober der Vergewaltigung, und an Beweisen mangelt es nicht: Zeugenaussagen und Aufzeichnungen des Hotels. Monsalve soll zudem seine Position im Ministerium dazu benutzt haben, die Polizei anzuweisen, die Hotelvideos zu manipulieren. Auch er sitzt in U-Haft, wurde inzwischen aus der PS ausgeschlossen. Aber das Ansehen der Boric-Regierung geht weiter den Bach runter.
Ähnliche Beiträge:
- Jacques Baud: „Die USA waren sich im Klaren darüber, dass die Offensive keinen Erfolg haben würde“
- Der Sachverständigenrat: Mütterrente? Die kann weg!
- Altersarmut und Altersüberschuldung sind zwei Seiten einer Medaille
- Von der anfänglichen Kriegsbegeisterung ist nichts mehr zu spüren
- Wirecard AG. Wildcard für die organisierte Kriminalität/OK (mit Staatstrojaner)



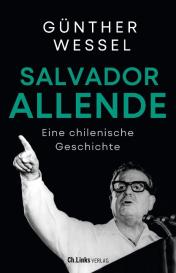
Das ist heute in Gaza passiert:
https://vimeo.com/1044956249
Kommentar zur gestrigen Pressekonferenz von Hrn. Trump.
Modernste Waffen werden gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt.
Das Ermorden von Zivilisten führt innerhalb von vierzehn Monaten zu einer Reduzierung der Bevölkerungszahl von über 10%.
Genannt wird eine Reduzierung der Bevölkerungszahl von 160.000 Personen.
Was will man den Menschen androhen, wenn Menschenrechte zum Verhandlungsgegenstand gemacht werden? Das sie als Flüchtlinge ins Ausland müssen?
Länge: 2:46 Minuten
Sie können den Link gerne rumschicken, wenn Sie möchten.
Ausgezeichneter Journalismus, da ist keine Zeile Zeitverschwendung.
Die Rente wurde unter Pinochet privatisiert. Gewaltsam, denn das hätte niemals eine Mehrheit gefunden. Ab da wurden dann bei uns Klagelieder angestimmt, wie sehr die Deutschen doch im Bremserhäuschen sitzen. Dort in Chile bekäme man Zinsen für seine Einlagen, während hier der Staat zinslos das verteilt, was eben herein kommt. Kaum zur Kenntnis genommen wurde das Scheitern des Vorhabens. Privatunternehmen können eben pleite gehen während eines langen Arbeitslebens. So geschehen und am Ende standen 40 Prozent der chilenischen Rentner ohne Einkommen da.
Nun kriegt der Boric die Rückkehr zu einer staatlichen Rente nicht hin. Geht das überhaupt? Müsste man da den Privaten nicht die Einlagen wegnehmen? Privatisierung ist eine Einbahnstraße. Das sollte man sich merken.
Erstens – Systeme, die auf dem Umlageverfahren beruhen ‚Money in – Money out‘, sind sozusagen zinsfremd. Kein Kapital, kein Zins. Aber – und das ist der entscheidende Vorteil – auch kein Risiko, dass sich angehäuftes Kapital aufgrund hoher Inflation oder eines Crashs im Finanzsystem in Luft auflöst.
Zweitens – Privatisierung kann man selbstverständlich rückgängig machen, nicht ohne Probleme, aber möglich.
‘Money in – Money out’
Kürzer erklären, geht nicht.
Das Problem sind die Banken, die an der Verwaltung der privaten Rente bisher prima verdient haben. Der Normalvorgang, wenn sozialdemokratische Regierungen sich auf reformistische Weise gegen solche Interessen durchsetzen wollen, ist, dass sie den Geldmächtigen und ihren Medien unterliegen.
Da würde nur helfen, dass der Staat ab sofort die Verwaltung des Umlagesystems übernimmt und die Privaten nur noch freiwillige Neueinlagen von denen erhalten, die im privaten System bleiben wollen. Das würde sich erledigen wie die Riesterrente.
Wenn den Geldmächtigen schon gelungen ist, dass Privatbanken die Einnahmen und Auszahlung der Umlagerente tätigen sollen – und dabei natürlich ordentlich Verwaltungsaufwand geltend machen -, haben die Sozialdemokraten schon verloren.
@Artur_C „Dort in Chile bekäme man Zinsen für seine Einlagen“
Mal angenommen, die Zinsen kompensieren die Inflation, was sie normalerweise nicht tun, dann nehmen sich die Banken noch zusätzlich Verwaltungsgebühr (vor der Verzinsung) und, wie schon erwähnt, gegen einige Investments den Bach runter.
Es ist rechnerisch unmöglich, dass private Rente mehr auszahlt als Umlagerente. Es gibt für Arbeiter auch keine wundersame Vermehrung von Kapital durch Dividenden mittels Aktienbesitz. Alles das, was an Dividenden ausbezahlt wird, wird den Arbeitern am Lohn abgezwackt.
Aktien rentieren sich nur für Kapitalanleger, aber auch sie können Investments verlieren.
Sind die gesellschaftlichen Produktivkräfte ausgelastet oder nicht?
Wenn Sie es nicht sind, dann fehlen Zahlungsmittel, um dies zu gewährleisten.
Wer sich selbst administrative Hürden gibt, anstatt diesem entscheidenden Umstand abzuhelfen, handelt nicht im Sinne der Sache.
Aber der Hauptgrund dürfte sein, dass man aufgrund der real vorhandenen Institutionen und deren Wirkungen gar nicht daran denkt, die wirklich wichtigen Fragen zu stellen.
Warum hat man Pinochet nicht zum Cromwell gemacht und dessen Unterstützern und Komplizen dieses angedroht?
Bei aller Liebe muss man immer fähig sein, auch deren Sprache zu sprechen, um so passende Erwiderungen verbaler Natur abgeben zu können.
Das sei allen, die hier von der Abkehr vom Umlagesystem schwafeln, eine Lehre.
Dabei geht es nur um abenteuerliche Gewinne der Finanzwirtschaft.