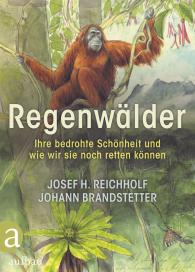Nach einem Bericht von Global Witness steigt mit der Klimakrise auch die Gewalt gegen Menschen, „die ihr Land und unseren Planeten schützen“.
Mit der Klimaerwärmung wird auch Naturschutz immer wichtiger. Das verschärft die Konflikte zwischen denjenigen, die Natur und Klima schützen wollen, und jenen, die auf Ausbeutung und kurzfristige Profite setzen, aber auch den Menschen, die aufgrund der Folgen der Klimaerwärmung zu Flüchtlingen werden und neue Lebens- und Wohnmöglichkeiten suchen.
Dass die Konflikte um knapper werdende und zu schützende Ressorcen sich aufschaukeln, hat gerade ein Bericht der NGO Global Witness dokumentiert. Danach sind 2020 mindestens 227 Land- und Umweltschützer, die nach der NGO „ihr Land oder den Planeten verteidigt“ haben, ermordet worden. Das sei so viel wie noch nie, seitdem der jährliche Bericht veröffentlicht wird. Aber das ist nur die Zahl der dokumentierten Fälle. Es werden mehr sein, sagt die NGO, da Journalismus und Bürgerrechte vielfach eingeschränkt werden.
Seit dem Pariser Klimaabkommen wurden jede Woche vier Umweltschützer ermordet: „Während sich die Klimakrise verschärft, Waldbrände in weiten Teilen des Planeten wüten, Dürren Ackerland zerstören und Überschwemmungen Tausende von Menschenleben fordern, verschlechtert sich die Situation für die Menschen an vorderster Front und für die Verteidiger der Erde immer mehr.“
Mindestens 30 Prozent der tödlichen Angriffe sind mit der Ausbeutung von Ressourcen verbunden: Abholzen, Dämme für Wasserkraft, Minen oder Agrobusiness. Mit 23 Morden steht die Rodung von Regenwald in Brasilien, Nicaragua, Peru und auf den Philippinen an der Spitze.
Am schlimmsten geht es in Lateinamerika mit 165 Morden zu. Schon im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr ist Kolumbien, das unter dem rechten Präsidenten Iván Duque enge Beziehungen zu den USA unterhält, Rekordhalter mit 65 Morden. Dort leben auch Gewerkschafter und Menschenrechtsaktivisten am gefährlichsten. Mexiko ist mit 30 Morden das zweitgefährlichste Land für Umweltschützer. In Brasilien gab es 2020 „nur“ 20 Morde, unter Bolsonaro, der den Regenwald zur Abholzung freigegeben hat, dürfte sich aber das brutale Vorgehen gegen Umweltschützer weiter verstärkt haben.
„In zu vielen Ländern, die reich an natürlichen Ressourcen und klimakritischer biologischer Vielfalt sind, agieren Unternehmen fast ungestraft. Da die Machtverhältnisse zugunsten der Konzerne ausgerichtet sind, wird nur selten jemand verhaftet oder wegen der Tötung von Umweltschützern vor Gericht gestellt. Wenn doch, dann sind es in der Regel die Männer am Abzug – diejenigen, die die Waffen in der Hand haben, und nicht diejenigen, die auf andere Weise direkt oder indirekt in das Verbrechen verwickelt sein könnten.“
Nach Global Witness haben Regierungen die Covid-Pandemie genutzt, um Bürgerrechte einzuschränken, was Unternehmen ermöglicht hat, zerstörerische Projekte voranzutreiben und straflos zu bleiben. Mord ist natürlich nur die Spitze der Gewalt, es wird auch mit Todesdrohungen, Überwachung, sexueller Gewalt oder Verhaftungen gegen Umweltschützer vorgegangen, um sie abzuschrecken und zum Schweigen zu bringen. Besonders im Visier stehen indigene Völker, deren Lebensweise von ihrer natürlichen Umwelt, vor allem Regenwald, abhängig ist. Ein Drittel der Todesopfer stammte von indigenen Völkern.
Besonders bedroht werden Waldschützer. 70 Prozent der Angriffe, die nicht tödlich enden müssen, richten sich gegen Menschen, die den Wald schützen wollen, eine eminent wichtige Aufgabe zum Klimaschutz. Andere müssen sterben, weil sie Flüsse, Küsten oder Meere zu schützen versuchen. 90 Prozent der Getöteten sind Männer, Frauen erfahren dagegen eher sexuelle Gewalt.