
Wenn man auf die letzten zwölf Jahre zurückblickt, dann gab es sehr viele und machtvolle Bezugnahmen auf das „Volk“ als Form der Selbstermächtigung, als Kritik an der Plutokratie und Post-Demokratie. Quo vadis – zweiter Teil.
Den ersten Teil finden Sie: Hier.
„We are the 99 percent“ war der Slogan der Occupy-(wall-street-)Bewegung in den USA 2011, als Antwort auf die Finanzkrise ab 2008. Auch wenn es „nur“ Zehntausende waren, die sich daran beteiligten, so reklamierten sie im Namen des Volkes, für die Mehrheit zu sprechen, gegen die Politik gemacht wird. Es kam zu Besetzungen von Plätzen, Brücken und Straßen. Dazu gehörte auch der Versuch, den Zugang zur New Yorker Börse zu blockieren, was mit brutaler Gewalt verhindert wurde.
„Democracia real YA!“ (Echte Demokratie! Jetzt) und „No nos representan“ (Sie repräsentieren bzw. vertreten uns nicht) in Spanien nach den Jahren 2010
Diese Bewegung hat eigentlich alle angesprochen, die nicht zu dem „einen Prozent“, also den Nutznießern dieses Systems gehören: Alle, die unter den Verschlechterungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen leiden, die die Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und folgende ausbaden müssen, die die weniger als ein Prozent Nutznießer zu verantworten haben: Das reicht von ArbeiterInnen und Angestellten bis zu prekär Arbeitenden und StudentInnen, RentnerInnen und Arbeitslosen. All denen, die nichts zu sagen haben, nicht gehört oder zum Schweigen gebracht werden.
Wie so oft, gab es viele politische Anläufe, bevor schließlich ein Protest medial und politisch wahrgenommen werden musste: der der „indignados“, der Empörten, die ab 2011 weit über Spanien hinaus für Aufsehen und Nachahmung sorgten.
Der Unmut und die Wut hatten sich über viele Jahre angesammelt und aufgestaut. Viele SpanierInnen begriffen und begreifen die ‚sozialistische’ PSOE (die der deutschen SPD inhaltlich nahesteht) nur als kleineres Übel im Vergleich zur rechtskonservativen PP (Partido Popular), deren Mitglieder immer wieder Sympathien gegenüber Franco bekunden und sich damit direkt auf den spanischen Faschismus beziehen. Grundlegende Gesetzesänderungen, die Jahre später mit zur spanischen Wirtschaftskrise beitrugen, wurden innerhalb der Legislaturperiode der sozialistischen PSOE realisiert – also ganz ähnlich wie im Fall der rot-grünen Regierung in Deutschland, die erst die Finanzmärkte deregulierte, also „entfesselte“, um dann die Billionen an Schulden, die diese Entfesselung hinterlassen hatte, über Raubzüge mit dem Namen „Agenda 2010“ (Arbeitsmarkt- und Renten“reformen“) gegenzufinanzieren. Aufgrund steigender Mieten und geplatzter Hypotheken gründete sich bereits 2006 die Bewegung „V de Vivienda“ und die Plattform „Para una vivienda digna“. „Aus dem Titel des Comic- und Spielfilmes V wie Vendetta wurde V de Vivienda (W wie Wohnraum). Fortan hatte die Bewegung einen populären und zugleich revolutionären Namen … und ein einprägsames Logo (Vendetta kämpft gegen ein böses Imperium …). Die Asambleas hatten verschiedene Funktionen. Es gab die Generalasamblea und verschiedene Kommissionen, die sich bestimmten Themen und Aufgaben widmeten. (…) Auf dem Höhepunkt der Bewegung Ende 2006 gingen in Barcelona 25.000 Menschen auf die Straße. (…) Die Bewegung mündete in einer Initiative, die auch gegenwärtig in vielen Stadtteilen und Asambleas aktiv ist: die Plattform de „los afectados por la hipoteca“ (Plattform der Geschädigten von Hypotheken).“ (Anja Steininger, no nos representan!, in: Aufstand in den Städten, Unrast Verlag 2012)
Man kann ihre Form der Selbstermächtigung, ihr Misstrauen gegenüber dem politischen System und der damit kollaborierenden Gewerkschaften als Vorläufer der Bewegung der „Indignados“ begreifen.
Um dem für den 29. September 2010 zaghaft ausgerufenen Generalstreik (für einen Tag) Zähne zu verleihen, besetzten am 25. September 2010 Hunderte „Indignados“ das ehemalige Banesto-Bankgebäude am Plaza Catalunya in Barcelona. „An dem besetzten Bankgebäude, vor dem die Demonstration des Generalstreikes enden sollte, wurde ein 150 Quadratmeter großes Transparent befestigt, das die kritische und provokante Haltung gegenüber den Gewerkschaften CC.OO. und UGT (die in den letzten Jahren immer wieder selbst in korrupte Finanzskandale verwickelt waren und mit der Regierung paktierten) bekundete:
»Die Banken ersticken uns, die Arbeitgeber beuten uns aus, die Politiker lügen uns an, und die CC.OO. und UGT verkaufen uns«.
(Anja Steininger, siehe oben)
Diese Platzbesetzung war die Initialzündung für den Sommer der Platzbesetzungen in ganz Spanien 2011. „Am 15. Mai folgen geschätzte 130.000 Personen in 58 spanischen Städten dem Aufruf der Initiative „Democracia Real Ya!“ Eine Plattform, die sich Wochen zuvor aus vielen kleinen Gruppen zusammengeschlossen hatte, um auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dass die beiden großen Parteien nicht fähig sind, die Mehrheit der Spanier_innen politisch zu vertreten, dass man mit leeren Versprechen an der Nase herumgeführt wird. (…) So unterschiedlich die Personen auf den Plätzen also auch gewesen sind, sie teilen die Kritik an der herrschenden politischen Klasse und dem Zweiparteien-System von Partido Popular (PP) und Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sie fordern ein Ende der Korruption und die Achtung der Grundrechte auf Wohnung, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Bildung und politische Beteiligung.“ (Anja Steininger, s.o.)
„Nuit debout“ – Das (Wieder-)Erwachen einer Bewegung
Auch diese Bewegung in Frankreich hat fast alle angesprochen, die die Politik der großen Parteien, der Gewerkschaften satthaben, die den ständig verlängerten Ausnahmezustand nicht als Schutz ihrer Freiheit erleben, sondern als deren Annullierung, die die Arbeitsmarktreformen nicht als Stärkung „unserer Wirtschaft(skraft)“ erleben, sondern als das, was sie für die Mehrheit bedeuten: noch mehr zu arbeiten, für noch weniger Lohn.
Am 12. Mai 2016 hat die französische Regierung unter Hollande die „Arbeitsmarktreform“ verabschiedet, deren Affinität zur deutschen Wirtschaftspolitik nicht zu übersehen ist. Denn was französische Regierungen zum wiederholten Mal durchzusetzen versuchen (zuletzt mit einer ‚Rentenreform’ unter Nicolas Sarkozy), ist in Deutschland sang- und klanglos über die Bühne gegangen: Die Agenda 2010 unter der damaligen rot-grünen Regierung: Ein großes Festival des Kapitals – eine einzige Niederlage der Gewerkschaften und der (außerparlamentarischen) Linken.
Gleichzeitig nahmen die Proteste den Widerstand gegen den seit Anfang 2016 andauernden Ausnahmezustand (état d’urgence) auf.
All das zusammen hatte das Fass zum Überlaufen gebracht und die Bewegung ‚nuit debout’ hervorgebracht – das Gegenteil von Stiller Nacht (duce nuit). Innerhalb weniger Tage und Wochen verbreitete sie sich wie Flugsand über die ganze Grande Nation, in über 200 Städten, mit zehntausenden Beteiligten. Am 14. Juni 2016 kamen über 1.000.000 Millionen Menschen zusammen, um ihre Ablehnung gegenüber diesem Gesetz und dem seit November 2015 verhängten Ausnahmezustand (état d’urgence) zu demonstrieren.
Man verbrachte die Nacht nicht im Bett oder vor dem Fernseher, sondern auf der Straße. Man „kommunizierte“ nicht über Facebook, sondern direkt, hautnah. Man fand sich nicht ab, sondern unterbrach den Lauf der Dinge. Man warf das diversifizierte und vereinzelte Private in den öffentlichen Raum, schaffte also Raum für ein kollektives Miteinander. Dieses Wagnis fand über Wochen statt, in großen und kleinen Städten Frankreichs, mit dem Ziel, auf unterschiedlichen Wegen die politischen und sozialen „gate communities“ zu verlassen: Ob SchülerInnen oder StudentInnen, ob Junge oder Alte, GewerkschaftlerInnen oder RentnerInnnen, AnarchistInnen oder KommunistInnen.
Doch auch dieser Bewegung ging nach ein paar Monaten die Luft aus. Lag es an der Repression? Lag es an der Erschöpfung, an fehlender Unterstützung? Wir werden später auf diese Fragen zurückkommen.
Kann man den (nationalistischen und rassistischen) Populismus „links“ wenden?
Die nationalistischen und rassistischen Parteien haben den Unmut des Volkes rechts eingebunden, absorbiert – sehr erfolgreich. Das verführt natürlich sehr schnell dazu, die Frage in den Raum zu stellen, ob dieses Modell auch auf „links“ übertragbar ist?
Verknappt könnte man sagen: Ein Populismus ohne Rassismus und nationale Rhetorik – geht das?
An zwei Beispielen, die diese abstrakte Frage durchgespielt haben, kann man sich dieser Frage nähern.
Griechenland: Von OXI zum Umfallen
Die parlamentarischen und außerparlamentarischen Protest- und Widerstandsbewegungen gegen die Troika-Diktate waren nirgendwo so stark wie in Griechenland. Das traditionelle Parteiensystem brach als Folge in sich zusammen. Eine neue Partei, das Parteienbündnis Syriza betrat die Bühne … und bündelte die Proteste. Es lehnte das Verarmungsprogramm der Troika ab und gewann damit die Wahlen Anfang 2015 und die Herzen vieler GlobalisierungsgegnerInnen. Trotz wachsender politischer und ökonomischer Erpressungen durch die Troika gewann Syriza auch das selbst angesetzte Referendum im selben Jahr mit über 60 Prozent der Stimmen.
Es ist naheliegend, dass die über 30 Prozent Wahlstimmen bei den Wahlen 2015, die 60 Prozent Zustimmung beim Referendum nicht alle „links“ gewählt hatten, sondern viele auch national. Der Showdown war klar konturiert: hier das kleine und tapfere Griechenland, dort der arrogante, übergroße Gozilla namens „Troika“.
Der (Haupt-)Feind stand erklärtermaßen außerhalb, in Gestalt des Dreigestirns aus EU, EZB und IWF. Mit dieser Anordnung konnte man auch erfolgreich viele nationale Erzählungen/Empfindungen und Mythen mobilisieren, von der Wiege der Demokratie, über Merkel als Nachgängerin Adolf Hitlers, über Besatzungs-Metaphern bis hin zum (National-)Stolz der Griechen.
In dieser Logik verwunderte es nicht, dass Syriza als stärkste Partei eine Regierungskoalition mit der nationalistischen ANEL-Partei einging. Machtpolitisch war das notwendig, wollte man Regierungsmacht erlangen. Das Ergebnis dieses Versuches, vieles auf die „nationale“ Karte zu setzen, ist bekannt und deprimierend. Die Troika lehnte das Votum des Referendums strikt ab und ließ Griechenland finanzpolitisch fast „absaufen“. Syriza lenkte ein und vollstreckt heute fast alle Diktate der Troika. Heute ist Syriza nur noch ein Schatten seiner selbst
Bleibt die Frage: Hätte es eine andere politische Lösung gegeben?
„Podemos“ – wir können es! Wirklich?
Die wachsende Repression und die Ermüdung der Bewegung der Indignados in Spanien führten schließlich dazu, dass Anfang Juni 2011 die Platzbesetzungen aufgeben wurden, mit der Absicht, die Formen der Selbstrepräsentation (Versammlungen und Kommissionen) in die Stadtteile zu verlegen.
Obwohl die Entscheidung richtig war, den „kurzen Sommer der Anarchie“ (in Anspielung auf Magnus Enzensbergers Essay über den spanischen Bürgerkrieg 1936-39) in den Alltag zu holen, verlor die Bewegung deutlich an Schlagkraft und Anziehung. Der Alltag holte alle im wahrsten Sinne des Wortes ein und zurück.
Diese Fragen stehen am Ende dieses Aufbruchs im Raum:
Wie kann man wirksam und erfolgreich in die herrschenden Strukturen eingreifen?
Wie kann man in das politische System eingreifen, ohne selbst Teil davon zu werden?
Wie kann man basisdemokratische Strukturen aufrechterhalten, die Zeit, also weniger Kapitalismus erfordern?
Es ist keine neue Erscheinung, sondern eher das Ende vieler Bewegungen, dass sie politisch „verwertet“ und „beerbt“ werden. In diesem Fall trägt der selbsternannte Erbe den Namen „Podemos“ – was so viel heißt wie: Wir schaffen es. Diese Partei wurde 2014 gegründet und versteht sich explizit als parlamentarischer Arm der Indignados. Sie verspricht das, was der Bewegung nicht gelang: Die Forderungen in das politische System einzubringen und als Teil einer zukünftigen Regierung umzusetzen.
Bei den Parlamentswahlen im Dezember 2015 erreichte Podemos mit 20,7 Prozent der Stimmen 69 Mandate und stellte damit die drittstärkste Fraktion im Parlament. Die Reaktion auf diesen Wahlerfolg auf Seiten des politischen Establishments Spaniens war denkbar einfältig: Man bezichtigte die neue Partei des Populismus und verortete diesen – im Gegensatz zu Deutschland (AfD) oder Frankreich (FN) – links.
Eine weniger dümmliche Einordnung sieht im Wahlerfolg von Podemos „sehr vorteilhafte Auswirkungen (…) in Sinne einer Regenerierung des spanischen politischen Systems.“ (Vicente Palacio von der Fundación Alternativas)
Auch die Partei „Podemos“ hat sich mehr vom System (was Korruption und Privilegien angeht) beeindrucken lassen, als von den basisdemokratischen Ideen der Bewegung.
2023 ist man für die spanischen Parlamentswahlen ein Bündnis mit „großen“ landesweiten Linksparteien wie Izquierda Unida und Más País und einigen bedeutenden nicht-separatistische linke Regionalparteien wie En Comú (Katalonien) eingegangen. Das Bündnis „Sumar“ bekam 12,33 Prozent der Stimmen und wurde viertstärkste Partei.
Das Scheitern des linken Populismus?
Man imaginiert ein Ganzes, etwas Eines – als Gegenüber zur etablierten Politik – das es nicht gibt. Die 99 Prozent sind nicht nur so unterschiedlich wie das eine Prozent, sie sind es notgedrungen noch viel mehr. Sie umfassen in Armut und prekär Lebende genauso wie akademisch und universitär ausgerichteten Menschen, Menschen in Armut und mit Angst vor Arbeit in Armut. Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne Aufstiegschancen und so weiter.
Dieses Ganze ist aber auch mehr als eine vorausgeworfene Utopie. Diese leugnet Klassenverhältnisse, die heute mehr denn je das Leben bestimmen – also auch die Art des Widerstandes, die Möglichkeiten des Protests, die Beteiligung daran.
Das lässt sich sehr eindrucksvoll an der Protestbewegung „nuit debout“ in Frankreich nachzeichnen.
Die gewünschte und erhoffte „Konvergenz“ der Kämpfe und Klassenunterschiede fand nicht statt: die Streiks der ArbeiterInnen, die Kämpfe gegen den Ausnahmezustand und die Kämpfe von nuit debout kamen letztendlich nicht zusammen.
Dazu schreibt Bernhard Schmid, der in Paris lebt und diese Bewegung sehr unmittelbar mitbekommen hat, Folgendes:
„Die convergence des luttes, also das Zusammengehen der Kämpfe in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, wird unterdessen von vielen Rednerinnen und Rednern am offenen Mikrophon der Platzbesetzerbewegung immer wieder beschworen. Der linke Wirtschaftswissenschaftler Frédéric Lordon, einer der prominenten Köpfe in einer Bewegung, die keine Chefs haben möchte, beschwor die Versammelten schon in den ersten Tagen, auf diverse andere soziale Milieus zuzugehen, um die Bewegung tunlichst zu verbreitern. Ein stärkerer Brückenschlag als bislang auch zu den Gewerkschaften und Lohnabhängigen sei nötig, betonen viele. Vielen abhängig Beschäftigten ist es de facto relativ schwierig, an allen Ereignissen teilzunehmen, wenn die einzelnen Kommissionen der Platzbesetzung – ‚Aktion’, ‚Kommunikation’, ‚internationale Kontakte’, ‚Logistik’ und andere – schon inmitten des Nachmittags zu arbeiten beginnen und danach die Vollversammlungen bis Mitternacht dauern.“
Ein strategischer linker Populismus?
Natürlich steht in diesem Zusammenhang immer die Frage im Raum, wie man mit den „rechtspopulistischen“ Erfolgen umgeht, sei es in Gestalt von Aufmärschen oder in der von Wahlsiegen. Und es geht auch darum, die massive, geradezu beängstigende Schwäche der Linken mitzudenken. Eine Schwäche, die sich weder auf der Straße, noch im Parlament groß unterscheidet.
Will man also machtpolitisch etwas bewegen beziehungsweise beeinflussen, wird man Bündnisse, Annäherungen an andere Positionen suchen müssen. In den 1920er und 1930er-Jahren war eine Idee, „Volksfrontbündnisse“ zu schließen, zwischen politisch ziemlich verfeindeten Parteien: auf der einen Seite die Sozialdemokratie, auf der anderen die Kommunistische Partei. Der Grundgedanke bei dieser strategischen Option war: Das noch Schlimmere (den herannahenden Faschismus), mithilfe des Schlimmen (Kapitalismus-Bewahrer) zu verhindern, also die berechtigte und notwendige Kritik an der Sozialdemokratie zurückzustellen, zugunsten eines gemeinsamen (antifaschistischen) Kampfes.
Vielleicht lag dem Vorschlag der belgischen Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe diese historische Matrix zugrunde, als sie gefragt wurde:
„Was schlagen Sie konkret vor?
- Der einzige Weg, um rechten Populismus zu bekämpfen, ist linker Populismus.“ (SZ, Neue Chancen, vom 29.12.2016)
In der Beschreibung der gesellschaftlichen Verhältnisse macht sie dabei zwei zentrale Aussagen:
„Was ich Post-Demokratie nenne, ist der Zustand, in dem alles, was mit wirklicher Teilhabe zu tun hat, bedeutungslos geworden ist.“
Das Geheimnis des Erfolgs rechter populistischer Bewegungen und Parteien sieht sie darin: „Ihre Anführer geben den Menschen wieder eine Stimme, ein Forum. Da geht es ganz klassisch um Partizipation. Und das ist eine Wiederaneignung von Demokratie.“
Sicherlich wäre sehr spannend und wichtig, diese Diagnose zu überprüfen: Geht es dort tatsächlich um „Wiederaneignung von Demokratie“, um Partizipation oder um die Vollendung der tatsächlichen Nicht-Teilhabe.
Wie könnte die Partizipation von links aussehen, wie ließe sich eine „Wiederaneignung von Demokratie“ auf den Weg bringen? Chantal Mouffe hat die spanische Partei „Podemos“ dabei vor Augen: „Sie sind der Überzeugung, dass alle Menschen von den negativen Effekten der Privatisierung und der Beschränkung des Wohlfahrtsstaats betroffen sind. Diese Menschen zu erreichen, das verstehe ich unter linkem Populismus. Einen kollektiven Willen schaffen, der die Arbeiterklasse mit den sozialen Bewegungen und den verarmenden Mittelschichten zusammenbringt.“
Fehlt es wirklich nur an der „richtigen“ Partei? War Syriza in Griechenland nicht genau das, was sich Chantal Mouffe von Podemos in Spanien erhofft? Und ist eine „gute“ Partei die Antwort auf das fast völlige Fehlen von wirklicher Teilhabe?
Der Blick auf eine bessere Partei verstellt seit Jahrzehnten den Blick auf eine schwerwiegende inhaltliche Frage, die möglicherweise eine „bessere“ Partei nur genauso schlecht beantworten kann.
Geht es wirklich darum, die Begriffe der Rechten bis Neofaschisten zu übernehmen oder „zurückzuerobern“? Es sind mehr als Begriffe: Sie markieren eine Gesellschaftsanalyse, eine mehr als schlechte, die auch links gewendet nicht besser wird. Im Gegenteil: Sie umgeht die Kernfragen der gesellschaftlichen Konflikte und Verwerfungen, deckt die Machtverhältnisse zu, anstatt sie aufzudecken.
Selbstverständlich sind (gelungene) Verkürzungen notwendig, aber sie müssen den Kern des Anliegens treffen. Stimmt es, wenn man die politische Krise des westeuropäischen Kapitalismus auf den Gegensatz von „Eliten“ und „Volk“ reduziert?
Sind wachsende Armut (durch Arbeit) und unermesslicher Reichtum einer extremen Minderheit dadurch zu bekämpfen, indem man das „Vaterland“ anruft – gegen das „vaterlandslose“ Gesetz der Globalisierung?
Ist die wachsende Ohnmacht, das Leben politisch mit zu bestimmen ein Ergebnis von „Brüssel“, also der EU-Institutionen?
Einen anderen Blick auf die Verhältnisse wirft der französische Soziologe Didier Eribon. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie, die lange kommunistisch eingestellt war und nun den Front National wählt. Er ist Foucault-Biograf und LGBT-Aktivist. Das ist der Treibstoff, der ihn zum Widerspruch treibt, den „Populismus“ links zu wenden.
Zuerst kommt er auf die révolution conservatice (konservative Revolution) zu sprechen:
„In den Achtzigern haben linke Neokonservative mit Investorengeld Konferenzen organisiert, Seminare gegeben und mediale Debatten angezettelt mit dem Ziel, die Grenze zwischen rechts und links zu verwischen. Das war eine konzertierte Kampagne. Sie wollten all das abschaffen, worauf sich linkes Denken gründet: den Begriff der Klasse, die soziale Determination, die Ausbeutung der Arbeitskraft etc. Heute sehen wir, dass sie zum größten Teil erfolgreich waren.“ (aus einem Zeit-Interview vom 4. Juli 2016)
Dem hält der Fragesteller folgende Entwicklung entgegen, die doch Hoffnung machen sollte – eine Art Gegenbewegung.
„ZEIT ONLINE: Mit Blick auf Jeremy Corbyn, Podemos, Syriza könnte man auch von einem linken Revival in Europa sprechen.
Eribon: Aber sind sie wirklich links? Schauen Sie sich die Sprache an: In Spanien benutzt Pablo Iglesias, der zentrale Kopf von Podemos, zum Beispiel ständig den Begriff la patria, die Nation. Das gesamte Programm basiert auf diesem Begriff. Er begreift nicht, dass das ein sehr gefährliches Wort ist, das historisch klar besetzt ist.
ZEIT ONLINE: Kann man nicht vielleicht links und nationalistisch zugleich sein?
Eribon: Ich kann gut verstehen, dass auch viele Franzosen für eine nationale Souveränität gegen die europäische Sparpolitik eintreten, die von einem hegemonialen Deutschland und der EZB durchgesetzt wird. Viele meiner Freunde denken so. Trotzdem ist es für mich sowohl politisch als auch theoretisch ein großer Fehler. Sobald man Begriffe wie Vaterland oder Nation im europäischen Diskurs von der Leine lässt, weiß man nicht, wohin sie einen tragen werden.“ (s.o.)
Den Versuch, die Begriffe Volk, Nation und Vaterland links zu besetzen bzw. zu wenden weist er zurück und fügt hinzu:
„Dass die Linken rechte Argumentationen übernehmen, sieht man aber leider immer häufiger: Die Rhetorik von Podemos ist genau die gleiche wie die des Front National. Ich will Pablo Iglesias natürlich nicht mit Marine Le Pen vergleichen, und wenn ich in Spanien leben würde, würde ich für Podemos stimmen. Aber die Rhetorik ist vergleichbar: Die Nation gegen die Oligarchie, die Heimat gegen die Finanzelite, das Volk gegen die da oben. Nur: Wer soll das Volk überhaupt sein?“
(s.o.)
Und in welchem politischen Projekt sieht Eribon einen Grund zur Hoffnung?
„Wenn es eine linke Partei gäbe, die für die Rechte der Arbeiterklasse genauso einstehen würde wie für die Rechte der LGBT-Community, der ethnischen Minderheiten und all den anderen, könnte das eine Instanz sein, die zwischen diesen Gruppen vermittelt und ihnen bewusst macht, wie sehr sich ihre Situationen ähneln, anstatt sie zu Gegnern zu erklären.“
(siehe oben)
Es gibt also einige faszinierende Versuche, auf die Politiken der „extremen Mitte“ (Tariq Ali) in ganz Europa zu antworten. Es gibt furchtbare Niederlagen, stilles Verschwinden und neue Versuche.
Die Debatte ist eröffnet.
Quellen und Hinweise:
Diese Debatte führten auch Didier Eribon, französischer Philosoph und die Gewerkschaftsvertreterin Christina Kaindl, unter dem Titel: Die Rückkehr der Rechten am 30.11.2016, die aufgezeichnet wurde: https://www.youtube.com/watch?v=awxAwWsJkKc&app=desktop
Einen sehr guten Beitrag zum „Linkspopulismus“ in Südamerika hat Gaby Weber geschrieben: Wohltäter der Armen oder eine bürgerliche Krankheit? Der sogenannte Linkspopulismus in Südamerika, https://www.gabyweber.com/dwnld/aktuelles/populismus.pdf
Der Aufschwung der AfD, Johannes Schillo: https://overton-magazin.de/top-story/der-aufschwung-der-afd/
Ähnliche Beiträge:
- Ist Rechtspopulismus eine Gefahr und Linkspopulismus eine Chance?
- Rechts und links = Null?
- Rechte/linke Antworten auf die Krise sind weder egal noch gleich
- Ein himmelweiter Unterschied
- Warten auf Wagenknecht



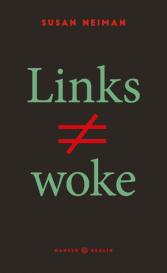
„Senatus Popolusque Romanus“, in dem Satz steckt bereits die gesamte Konstellation- bis heute. Auf der einen Seite die 1% der Sklavenhalter, auf der anderen Seite die 99% des Volkes. Und schon damals wurde jeder Vertreter der 99% als Feind des „Allgemeinen“ verächtlich gemacht. Und schon damlas gehörten die LGBTwawsweißderGeier zu den 1%. Es wird Zeit für eine Politik, die eine klare Parteinahme für die 99% ins Zentrum stellt.
Beim üblichen Herrschaftsdiskurs seit Jahrhunderten mit Realpolitik vs. Links- und Rechtspopulismus gibt es noch die Spielart der Grünen aus den 80er und 90er Jahren: Realos vs. Fundis.
Dem Großen Geld fällt es nie schwer, gut bezahlte Redner und Schreiber zu finden, die das Eine als vernünftig und das Andere als spleenige linke/rechte/fundamentalistische Idee hinstellen – die „am Ende allen schaden wird“.
Eine interessante Sonderform des Herrschaftsdiskurses ist die von identitären Akademikern betriebene LGBT-Sprachreform, die nicht vor rassistischen Sprechfiguren wie dem „alten weißen Mann“ oder „toxischen Männern“ zurückschreckt.
Eine ihrer Intimfeind*innen ist Alice Schwarzer, die sich dafür ausspricht, dass Geschlechterrollen nicht vervielfacht, sondern egalisiert werden sollten.
Man stelle sich die Implosion vor, wenn den zahlreichen LGBTIQ+-Spielarten noch die Mehrheitspielform CIS hinzu gefügt würde.
Ich such immer noch ein Gewerkschaft die meine Rechte richtig unterstützt. Oder eine Genossenschaft die mich nicht vollständig bescheißt wie meine Bank Genossenschaft.
Und wieso haben überhaupt Wohnungs Genossenschaften ein Aufnahme Stopp, heißt doch immer wir haben Platz. Oder?
Oder eine Krankenkasse die in der Lage ist Facharzttermine, Zeitnah für die eigenen Zwangsmitglieder zu erzwingen!
Nationalschwärmer und Sozialromantiker die mir eine großartige Zukunft versprechen brauche ich nicht mehr unbedingt, wie die erfolgreiche Vergangenheit bereits bewiesen hat.
Prost!
„Ein Populismus ohne Rassismus und nationale Rhetorik – geht das?“
Ohne Rassismus sollte es natürlich gehen, aber ohne nationale Rhetorik wird’s nicht gehen, damit ist der Bezug zur Nation und zum Staat gemeint. Denn wer sonst sollte eine menschengerechte und nachhaltige Wirtschaft voranbringen ? Demokratie ist halt an Volk und Nation gebunden, also muss darauf Bezug genommen werden.
„Die Troika lehnte das Votum des Referendums strikt ab und ließ Griechenland finanzpolitisch fast „absaufen“. Syriza lenkte ein und vollstreckt heute fast alle Diktate der Troika. Heute ist Syriza nur noch ein Schatten seiner selbst“
Ein typischer Fall wo die Macht des Kapitals über den Volkswillen siegte. Aber das ist neoliberale Demokratie bzw. liberaler Kapitalismus, die westliche regelbasierte Ordnung, deren Funktionsweise hier mit Griechenland aller Welt deutlich vor Augen geführt wurde. Fraglich ob die Geschichte heute, nur 10 Jahre später, wieder so ablaufen würde. Die Repräsentanten der Troika haben inzwischen einiges an Macht und Bedeutung verloren. Die Syriza-Bewegung war also keineswegs umsonst, denn die Griechenland-Krise war ein Lehrstück für die Welt (auch in Sachen Moral). Sie zeigte ungeschönt die wahren Werte des liberalen Kapitalismus (in Form des westlichen Imperialismus). Merkel ließ sich denn auch ihr schlechtes moralisches Image durch ihre Flüchtlingseinladung wieder aufpolieren.
Nun ja; nach der Kapitulation von Syriza verlor diese die Regierung, degenerierte zur liberalen Partei, zerfiel Podemos, zerfielen die 5 Sterne, degenerierte die Linkspartei zum NATO-Blinddarm.
Die Niederlage von Syriza leitete den Untergang der europäischen Linken ein und begründete den Siegeszug des Rechtspopulismus.
Der Klassenkampf findet heute global statt. Gropp betrachtet der reiche Westen in Form der neoliberalen Demokratien gegen den armen und abhängigen Süden (neuerdings auch gegen das rohstoffreiche Russland). In diesem Rahmen muss man natürlich auch die politischen Kämpfe innerhalb der Länder des reichen Westens sehen, denn der profitiert mit seiner „regelbasierter Ordnung“ (beschönigend für Neokolonialismus) in vielfältiger Weise davon. Denn die globalen Strukturen sind auf die Bedürfnisse des Kapitals ausgerichtet, das sich bekanntlich im politischen Westen angesammelt hat.
Soziale Parteien in den reichen Ländern haben es nun ermöglicht breite Schichten der Bevölkerung am Profit des Neokolonialismus teilhaben zu lassen. Das ermöglichte den sozialen Frieden, der nun allerdings durch zunehmende Krisen (inklusive politisch herbei geführter Deindustrialisierung) in Gefahr gerät. Ein politischer Kampf um die schwindenden Ressourcen entbrennt. An diesem Punkt befinden wir uns aktuell. Und nun überlegen Sie was bedeutet (die herrschende) links- oder neo-liberale Politik, und was rechtspopulistisch und was könnte linkspopulistisch bedeuten?
Für andere Politiken sehe ich aktuell keinen Spielraum: Es gibt nur das Herrschende oder Populismus?
„Die Repräsentanten der Troika haben inzwischen einiges an Macht und Bedeutung verloren“ -Tatsächlich?
Die letzten drei Jahre haben gezeigt wie eine niemals zur Wahl stehende „Präsidentin“ am Parlament vorbei durchregiert. Selbst grosse Bestechungsskandale haben nichts verändert und die massive Erpressung von Mitgliedsstaaten wird in den Medien gefeiert. Das ohne demokratische Institutionen Milliarden von europäischen Steuergelder in die US Rüstungsindustrie fliessen, um einen grausamen Krieg in der Ukraine zu führen ohne einen Ansatz einer Kritik, sind meines Erachtens keine Anzeichen dafür, dass hier Macht verloren wurde, im Gegenteil man kann noch viel Stiller und mit deutlich weniger Kritik die Agenden der Finanzindustrie durchsetzen.
Ich stimme im Wesentlichen zu. Innerhalb der EU scheint die Macht der (undemokratischen) Institutionen zugenommen zu haben. Was meiner Meinung nach auf äußeren (geopolitischen) Druck zurückzuführen ist. Es sieht fast so aus als ob sich von der Leyen (wie auch Scholz und Baerbock) ihre Direktiven aus den USA abholen, die Nato und nun auch die EU ein Instrument des US-Imperiums geworden sind. Weshalb es von äußerster Wichtigkeit ist nationale Souveränität zurückzugewinnen, was von den Herrschenden leider als Populismus deklariert wird.
ja, Tsipras und Syriza lenkten ein – Varoufakis wollte das nicht. Warum „Linksradikale“ das machten, das ist die Frage. Einfach nur sagen „Macht des Kapitals“ ist zu billig, geradezu mystisch.
Warum unterwarf sich Tsipras dem Diktat des Kapitals (der Troika)?
Darüber kann man nur spekulieren: Am Naheliegendsten ist eine schlichte Abwägung, eine Art Kosten-Nutzen-Analyse für Griechenland. Immerhin ist Griechenland EU-Mitglied, einem Klub der Reichen, da fallen dann auch für arme Mitglieder auch einige Brosamen ab. Zudem käme ein Nachgeben des Volkswillens einer Kriegserklärung an den immer noch die Welt bewegenden Kapitalismus gleich, mit sehr vielen Unwägbarkeiten. Vielleicht hatte er das Schicksal Argentiniens oder noch Schlimmeres vor Augen.
Er hatte die Verantwortung für sein Volk und sein Land, das schickt man nicht ins Ungewisse, da zählt Sicherheit mehr. Da war ihm der Spatz in der Hand mehr wert als eine Taube auf dem Dach.
Das alles traf für den Idealisten Varoufakis nicht zu. Gut möglich, dass er jedoch in dieser Verantwortung das Selbe gemacht hätte. Sie sehen, so „mystisch“ ist das nicht.
Ich verstehe auch nicht, warum im Zentrum einer linken Machtpolitik partikular Interessen stehen sollten?
Das sind doch Dinge, die entweder sehr privat sind (welche sexuelle Orientierung jemand hat, hat den Staat nicht zu interessieren. Genau so wenig, wie die Menschen sich ein Familienleben vorstellen ) oder die in Situationen verhandelt werden müssen, sei es z.b. welche Kultur der Staat fördern will oder wie der Staat auf soziologische Veränderungen reagiert. Durch die Fokussierung auf einzelne Fragen und zum Teil die absolute Erhöhung dieser, sind wir doch in der aktuellen Situation, die kaum noch eine starke Politik im Sinne der Bevölkerung zulässt.
Ich kann das z.T. gut nachvollziehen, wir waren als Jugendliche auch genervt davon, dass unsere kulturellen Ideen und Vorstellung so wenig Raum hatten. Wir wären aber nicht auf die Idee gekommen, dies als ein allgemeingültige Forderung für alle zu definieren. Im Gegenteil das Besondere zeichnet sich ja oft dadurch aus, dass es nur wenige gut finden.
D.h. wenn ich Raum für meine besonderen Bedürfnisse fordere, darf ich nicht übersehen das dem Großteil meiner Nachbarn diese völlig egal sind. Während wir Krach und Lärm wollten, haben die meisten Menschen Schlager und Volksmusik gehört. Wenn sich Politik nun auf die Außenseiter konzentriert, wird die Mehrheit irgendwann wütend.
Und ich glaube auch, dass genau das in der Weimarer Zeit zu dem geführt hat wo man heute sagt „Nie Wieder!“. Aber genau dieser Weg wird wiederholt. Die Kämpfe zwischen Rechts und Links auf den Strassen hat die Angst der Bürger geschürt und letztlich haben sie dann die gewählt, die „Ruhe“ versprochen haben. Das sollte die Linke nicht vergessen, mit Chaos und Unruhe verliert sie immer.
Wichtig wäre auf die Menschen zu zugehen und auch denen, die man in weiten Kreisen der Radikalen, gerne verachtet zu zuhören. Das was als „besorgte Bürger“ oder „Patrioten“ auf der Strasse ist, sind nicht die Menschen die Macht haben und keine Menschen die den Umsturz wollen. Die meisten wollen an diesem System partizipieren und ihren Anteil, ihre Arbeit nicht klein geredet bekommen. Die Leute die in Vereinen, freiwilligen Feuerwehren, Nachbarschaftshilfen oder „unser Dorf soll schöner werden“ organisiert sind. Das sind sicher keine Revolutionäre, aber Wissen oft besser wie man mit Solidarität eine Gesellschaft am laufen hält, als der studentische Aktivist, der diese Menschen verachtet und seine Solidarität an diffuse kulturelle Besonderheiten bindet, die oft so nicht existieren. Eine erfolgreiche Linke kann es nur geben, wenn sie die arbeitende Bevölkerung versteht und deren Bedürfnisse formuliert.
Da unser System zu einem Kastensystem geworden ist, in dem es eine dominante Kaste bestimmter Studienrichtung gibt, sind solche Forderung kaum Durchsetzungsfähig. Die Macht ist in den Händen derer die das Marketingsystem beherrschen und die mit dessen Hilfe die Definitionen von Politik je nach Bedürfnis gestalten. Wir haben erlebt wie durch Medien, „Denkfabriken“ oder parteinahe Stiftungen genau definiert wird was man zu denken hat und was nicht mehr gesagt werden soll. Das am Rande noch Ausnahmen existieren hat wenig Wirkung und wird mit immer strengeren Gesetzen auch weniger werden.
Wir Älteren können auf spannende 70-90er zurück blicken, wo es Umbrüche gab, aber leider haben diese nicht zu einer Gesellschaftordnung geführt, die das Wohl der Menschen im Sinn hat. Daher erwarte ich von Links nicht mehr viel, wo soll das herkommen?
„Der einzige Weg, um rechten Populismus zu bekämpfen, ist linker Populismus.“
Davon muss man wohl ausgehen, und idealistische Gesellschaftsmodelle erst einmal beiseite lassen. Und Begriffe wie „Volk, Nation und Vaterland“ sind vielleicht konservativ aber keineswegs rechtsextrem. Sie bezeichnen schlicht Sachverhalte. Falls man damit Probleme hat, schaue man in den Duden, der bildet. Denn lässt man sich auf die linksliberale Tabuisierung ein, dann hat man schon verloren, da man sich dann in einen moralisierenden Kontext verirrt und die reale Welt aus den Augen verliert (ist leider mit großen Teilen der Linken so passiert).
Einfach mit der Überschrift schon alles in die genehme Ecke packen – Deckel drauf, Klappe zu. Geschäft gemacht. kassieren gehen.
„Populismus“ ist de blödeste aller blöden Anwürfe.
Wenn das Wort „populistisch“ irgend einen Sinn und Bedeutung hat, dann trifft das Adjektiv auf die Parteien zu, – und zwar nur auf die – die an der Macht sind – denn ohne Populismus und Populi wären sie da nicht.
Wetzler also in gewohnter Marx-populisitscher Manier …
Wenn man überhaupt auf das Konzept parlamentarischer Erfolge einer Partei setzt, dann ist ein solcher „Populismus“ nötig. Nicht umsonst sagt die BSW, es handele sich nicht um ein „Links 2.0“. Daran mögen sich die Altgläubigen mit ihren Klassenkampfvorstellungen und der im Hintergrund lauernden sozialen Revolution abstossen. Nur, so eine Revolution ist überhaupt nicht in Sicht (nur bei linken Sektierern) – weder in Deutschland noch in Europa. (Auch dazu haben Syriza, Podemos et.al. mit beigetragen). BTW: warum lässt Wetzel eigentlich bei seiner Zeichnung der jüngsten Geschichte die Gelbwesten in Frankreich aus? Waren die zu national oder „rechtsoffen“?
Die geradezu historische Schwäche der Linken gründet m.E. einerseits darin, dass es die alte Arbeiterklasse nicht mehr so gibt, wie noch in den 60er Jahren. Und andererseits, dass spätestens mit dem Fall des Realsozialismus die Utopie vom „Sozialismus“ nur noch kleinere Gruppen von Aktivisten und unverbesserliche Sektierer mobilisieren kann. Wenn diese dann gefragt werden, wie denn ein solcher „Sozialismus“ heute jenseits altbackener Vorstellungen wie „Rätedemokratie“ funktionieren könnnte, kommt wiederum nur die Beschwörung alter Formeln zum Vorschein. Das ist für das „Volk“ jedenfalls nichts, was es überzeugen kann.
Somit bleibt erst einmal: falls man sich auch nur kleinere Änderungen in der Politik vorstellen kann, geht das halt über einen parlamentarischen Weg – oder sieht irgend jemand einen mächtigen Generalstreik aufscheinen?
Ich blick da nicht durch, Wolf Wetzel, was ist denn nun das Plädoyer, falls es eines gibt?
‚Graswurzel‘ UND Verzicht auf ‚Populismus‘
oder
‚Graswurzel‘ PLUS ‚Populismus‘
Oder habe ich nix verstanden?
(PS.: Zur Teilerklärung der Frage: Wer vom „Volk“ spricht, will für meine Begriffe etwas von ihm; das bleibt auch dann so, wenn er es für „heterogen“ erklärt, das ist keine Abschwächung, vielmehr Verschärfung des Verlangens)
Zum langen Abschied der „Linken“ von der Arbeiterklasse
will ich ein wenig Marx zitieren, „Kritik des Gothaer Progammes“ von 1875, und mit ein paar Anmerkungen versehen
Wenn schon denn schon – man muß das gründlich machen, denn was hier als „obsolet“ oder „Fingerfehler“ erscheinen kann, hat zu willentlichen, methodischen, wie unbedarften Mißverständnissen beigetragen, von denen später die Rede sein soll.
Der übergeordnete Fehler, den Marx hat wissen können:
Es ist schwer daneben, philosophisch-anthropologisch daher zu labern, wenn es um kapitalistische Lohnarbeit geht, sowie die (Ein-)Stellung der Beteiligten zu ihr.
Der erste Folgefehler:
„Arbeit(en)“ ist mitnichten „Äußerung einer (?!) Naturkraft“, vielmehr Betätigung aller kreatürlichen Lebenskräfte eines jeden Tieres*, und das hat Marx zu diesem Zeitpunkt sehr wohl gewußt – er hatte Darwin gelesen und den Mann und seine Arbeit gerühmt. Außerhalb der Traditionen der abrahamitischen Religionen ist die Teilung und Gegenüberstellung von „Arbeit“ und „Natur“ schlicht Bullshit, ein Festhalten an ihr taktischer Herkunft, was im hervor gehobenen Satz besonders deutlich wird: Daß Arbeit = Aneignung von Lebensvoraussetzungen ist, also kein anderes „Verhalten zur Natur“, als die Arbeitsgegenständlichkeit vorliegt, stand am Beginn von Marx theoretischer Arbeit („Deutsche Ideologie“)
Schauen wir zu, mit welchem Zweck Marx hier so eigentümlich taktisch redet.
1) Marx wollte darauf bestehen – und tut das später im Text gegen Lassalle gerichtet explizit – daß Grundlage aller Arbeit ein Eigentum an Grund und Boden ist, von dem und auf dem sie stattfindet. Ist dies anthropologisch bestimmte Eigentum aber zugleich Besitztum, sei es im Sinne von ausschließendem (Privat-)Eigentum, oder / und Besitztum einer Klasse (Grundherren, Feudaleigentümer, Kapitalisten, Kriegsherren) ist Ausbeutung und Klassenherrschaft eingerichtet – egal, welcher spezifisch historischen Gestalt.
2) Die pleonastische Phrase von der „Naturbedingtheit der Arbeit“ wird später im Text dazu herhalten, zu begründen, warum Marx gegen Lassalle nicht nur auf der Aufhebung der Trennung der Arbeitenden von dem Grund und Boden bestehen will, auch auf der Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, denn die ist, abstrakt- allgemein gesprochen, ein Folgeprodukt der Trennung der Arbeitenden von Grund und Boden, nicht etwa arbiträres Produkt einer „historischen“ „Entwickelung“ technischer Arbeitsteiligkeit.
Ich laß das jetzt erst mal ruhen, wenn irgend jemand daran interessiert ist, daß ich das fortsetze und die oben gemachten Versprechungen, zu erklären, was das mit einem „linken“ Abschied von der Arbeiterklasse zu tun haben soll, einlöse, soll er sich melden.
* Spielen selbstredend eingeschlossen.
ALLE Lebewesen müssen der sie umgebenden Welt ihre Überlebensmittel entnehmen. Bereits der Begriff der Arbeit enthält deshalb die Unterscheidung zwischen einem „höchsten“ Lebewesen und dem übrigen Getier. Alle Lebewesen sind mit ihren Strategien in aller Regel nur zeitweise erfolgreich. Naturereignisse und ein gleichartiges Überlebensinteresse anderer setzen ihrem Unterfangen Grenzen. Na und?
Mensch hat die Neigung diese Banalität des Lebens ständig zu überhöhen, indem er Wörter mit „-ismus“ kreiert und dazu ideologische Kämpfe austrägt. Es scheint so zu sein, dass einfacher gestrickte Tiere mit wechselnden Bedingungen über Jahrtausende, Jahrmillionen … besser zurechtkommen, als die gerne als „höher entwickelt“ bezeichneten. Na und?
Nix ist mit „Cogito ergo sum“. Ein weniger durchdachtes, eher reaktives Verhältnis zur umgebenden Welt könnte dienlicher sein fürs Überleben der Gatttung. Auch wenn viele meiner Artgenossen gerne das Fähnchen des überlegenen Menschen hochhalten: Der Satz „Als Gott die Welt schuf, übte sie nur“ enthält mehr als ein Körnchen inhaltlicher Richtigkeit. Und immer wieder unterstellt man dem „Höchsten Wesen, das wir alle verehren“ die in vollem Umfang realisierte Absicht, das Bestmögliche hervorgebracht zu haben. Es ist der Welt aber egal, ob sie gut, böse, schlau oder dumm ist.
Auch ohne jemals etwas gelesen zu haben – ganz gleich von wem – kann man den von Zeit zu Zeit erfassten Zustand des Hungers unter Menschen [https://www.welthungerhilfe.de/fileadmin/pictures/publications/de/studies-analysis/2023-welthunger-index-whi.pdf] als nicht hinnehmbar erachten und zu der Behauptung oder Einsicht gelangen, es müsse gleicher verteilt werden. Ist das jetzt rechts oder links? Populistisch? Elitär?
Manche, die so denken, entscheiden sich fürs Spenden, andere für eine Tätigkeit im Entwicklungsdienst, wieder andere arbeiten voller Überzeugung bei Bayer/Monsanto an der Entwicklung künstlich hergestellter Eiweiße und wieder andere bringen einfach ihrem Nachbarn einen Teller Suppe. Sich hinsichtlich der möglichen individuellen Handlungsweisen ein Urteil anzumaßen, halte ich persönlich weder für links noch für rechts sondern für frech.
Es gibt auch welche, denen dieser Zustand egal ist. Das sind nicht meine Freunde.
Man kann´s natürlich auch ideologisch sagen. Nützt´s was?
Beim ersten Binnen-I
habe ich aufgehört zu lesen.
Schade eigentlich.
Die Überschrift klang vielversprechend.
Sie verdient einen bewußteren Umgang mit unserer Sprache.