
Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „blubber“ hören? Und wie würden Sie die Farben der untergehenden Sonne am Himmel beschreiben? Wir neigen zu der Annahme, dass alle Sprachen auf der Welt Ideen und Objekte auf die für uns natürliche Weise beschreiben. Beim genauen Hinsehen erkennen wir jedoch, dass das nicht immer der Fall ist und dass die Sprecher verschiedener Sprachen die Welt buchstäblich anders sehen.
Denn jeder Sprachraum hat eine einzigartige Vorstellung von Zeit, Raum, Farbe und sogar Geruch. Auf einer spannenden Reise rund um den Globus erklärt der Kognitionswissenschaftler Caleb Everett in seinem Buch „1000 Sprachen, 1000 Welten“, was uns die sprachliche Vielfalt über die menschliche Kultur verrät und wie sie unser Verständnis vom Menschsein bereichert. Das Buch wurde vom New Statesman als eines der besten akademischen Bücher des Jahres 2023 gekürt. Ein Auszug.
Es ist zwar noch unklar, inwieweit die Unterscheidung der Zeitformen die tatsächliche Zeitwahrnehmung der Menschen widerspiegelt oder beeinflusst; klar ist aber, dass Sprecher verschiedener Sprachen auf unterschiedliche Weise über Zeit denken. Auch wenn alle Menschen die Zeit im Großen und Ganzen ähnlich erleben, verwenden verschiedene Bevölkerungsgruppen unterschiedliche kognitive Strategien, um das Verstreichen der Zeit zu begreifen, und diese Strategien können sprachlich kodifiziert werden und sich dadurch auf spätere Sprachenlernende auswirken. So kodiert beispielsweise selbst der Ausdruck »passing of time« [Vergehen der Zeit] – ein spezifisch englischer Ausdruck, der in vielen, aber sicher nicht allen Sprachen analog verwendet wird – eine bestimmte räumliche Denkweise über Zeit. Das »Vergehen der Zeit« stellt die Zeit so dar, als ob sie sich durch uns bewegt oder wir uns durch sie bewegen, obwohl keine dieser Möglichkeiten in einem realen, physischen Sinn zutrifft. Weder bewegen wir uns durch die Zeit, noch bewegt sie sich durch uns. Unsere Strategie, die Zeit durch bewegungs- und raumbezogene Ausdrücke wie »das Vergehen der Zeit« darzustellen, ist im Kern metaphorisch. Die entsprechende Metapher ist alles andere als eine Sprachuniversalie. In der Sprache Karitiâna zum Beispiel gibt es keine Möglichkeit, sich auf das »Vergehen« der Zeit zu beziehen.
Ein einfaches Experiment
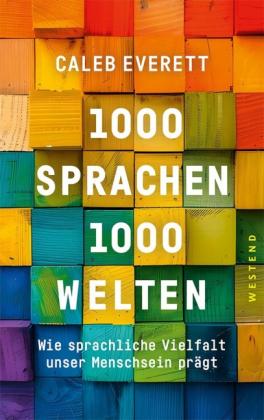 Führen unterschiedliche Metaphern für Zeit dazu, dass Menschen Zeit auf verschiedene Weise unterscheiden, auch wenn sie solche Metaphern nicht in Worte fassen? Diese Frage ist umstritten, aber die beste Antwort scheint ein einfaches Ja zu sein. Die schwierigere Frage ist, ob die sprachlich und metaphorisch motivierten Unterschiede, wie Menschen in verschiedenen Kulturen die Zeit begrifflich fassen, im täglichen Leben überhaupt eine Rolle spielen. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen einen Eindruck von den konzeptionellen Unterschieden vermitteln, die sich aus sprachlichen Unterschieden in der Zeitmetaphorik ergeben. Vor allem aber möchte ich die einfache und weniger strittige Tatsache hervorheben, dass Entdeckungen, die an Orten wie Amazonien, Neuguinea und in den Anden gemacht wurden, die zeitgenössischen Debatten der Kognitionswissenschaftler über die menschliche Konstruktion von Zeit entscheidend verändert haben.
Führen unterschiedliche Metaphern für Zeit dazu, dass Menschen Zeit auf verschiedene Weise unterscheiden, auch wenn sie solche Metaphern nicht in Worte fassen? Diese Frage ist umstritten, aber die beste Antwort scheint ein einfaches Ja zu sein. Die schwierigere Frage ist, ob die sprachlich und metaphorisch motivierten Unterschiede, wie Menschen in verschiedenen Kulturen die Zeit begrifflich fassen, im täglichen Leben überhaupt eine Rolle spielen. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen einen Eindruck von den konzeptionellen Unterschieden vermitteln, die sich aus sprachlichen Unterschieden in der Zeitmetaphorik ergeben. Vor allem aber möchte ich die einfache und weniger strittige Tatsache hervorheben, dass Entdeckungen, die an Orten wie Amazonien, Neuguinea und in den Anden gemacht wurden, die zeitgenössischen Debatten der Kognitionswissenschaftler über die menschliche Konstruktion von Zeit entscheidend verändert haben.
Bevor wir uns jedoch mit den relevanten sprachübergreifenden Daten befassen, möchte ich Sie zu einem einfachen Experiment einladen. Sie benötigen dazu drei kleine Gegenstände, vielleicht drei Stifte (Sie können aber auch mit imaginären Gegenständen Ihrer Wahl mitmachen). Legen Sie einen der Stifte auf eine ebene Fläche vor sich, vielleicht auf einen Schreibtisch. Sagen wir, dieser Stift steht für die Zeitangabe tagsüber, da dies ein Konzept ist, mit dem alle menschlichen Kulturen vertraut sind. Nehmen Sie nun einen anderen Stift, der für den Sonnenuntergang steht.
Legen Sie diesen »Sonnenuntergangs«-Stift auf dieselbe Fläche wie den Tagsüber-Stift, sodass er sich an einer Stelle befindet, die »später« erscheint als der Tagsüber-Stift. Der dritte Stift schließlich steht für »nachts«. Legen Sie auch diesen Stift auf die Fläche, sodass Sie nun alle drei Stifte, die »tagsüber«, »Sonnenuntergang« und »nachts« repräsentieren, in einer logischen Reihenfolge von »frühestens« bis »spätestens« angeordnet haben. Es gibt hier keine richtige Reihenfolge, aber es kann eine Reihenfolge geben, die sich für Sie natürlicher anfühlt. Wenn Sie wie die meisten Englisch oder Deutsch sprechenden Menschen sind, wird die natürliche Reihenfolge so aussehen, dass der Tagsüber-Stift links vom Sonnenuntergang-Stift liegt, während der Nachts-Stift rechts vom Sonnenuntergang-Stift liegt. Diese Anordnung stellt die Zeit so dar, als ob sie sich von links nach rechts bewegt. Für diese räumliche Projektion des zeitlichen Verlaufs gibt es eine klare kulturelle und sprachliche Motivation: die Leserichtung der Englisch- und Deutschsprechenden. Wenn Sie diese Wörter lesen, befinden sich zukünftige Lesemomente zu jedem Zeitpunkt rechts von Ihrem Fixierungspunkt, während sich vergangene Lesemomente links davon befinden. Die Leserichtung ist einer der vielen sprachassoziierten Faktoren, die sich darauf auswirken, wie wir uns das Verstreichen der Zeit vorstellen. Leser von Sprachen, die von links nach rechts geschrieben werden, neigen dazu, die Anordnung von Stiften und anderen Objekten von links nach rechts zu verwenden, um Momente in der Zeit darzustellen. Ganz allgemein ordnen sie die Zeit so an, als ob die Zeit sich in grundlegenden symbolischen Darstellungen des zeitlichen Ablaufs von links nach rechts bewegt, zum Beispiel in Kalendern und Zeitleisten. Leser von Sprachen wie Arabisch und Hebräisch, die von rechts nach links geschrieben werden, bevorzugen bei diesen Aufgaben die umgekehrte Reihenfolge.
Raak pung putpun
Die Arbeit einer Linguistin an einer australischen Sprache hat eine andere Art der Zeitunterscheidung ans Licht gebracht, die nicht wie die Modelle der Zeitbewegung von links nach rechts oder von rechts nach links auf den Körper einer Person ausgerichtet ist. Diese letztgenannten Modelle werden als »egozentrische« Model-le bezeichnet, weil sie sich auf die Person konzentrieren, die die räumliche Orientierung der »Bewegung« der Zeit interpretiert. Aber Modelle des zeitlichen Verlaufs müssen nicht unbedingt egozentrisch sein; sie können auch geozentrisch sein und sich auf ein Merkmal der natürlichen Umgebung stützen. Alice Gaby, eine australische Linguistin, hat eine geozentrische Art der Zeitbeschreibung dokumentiert, die bei Sprechern von Kuuk Thaayorre zu finden ist, einer indigenen Sprache, die auf der Kap-York-Halbinsel im Norden Australiens gesprochen wird. Zusammen mit ihrer Kollegin Lera Boroditsky, einer Kognitionspsychologin, deren Forschung neue Wege zur Untersuchung des Einflusses der Sprache auf das Denken eröffnet hat, hat Gabys Arbeit über Kuuk Thaayorre dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf eine alternative Denkweise über das Vergehen der Zeit zu lenken: Wie in vielen Sprachen der Welt fehlen auch in Kuuk Thaayorre einige Wörter oder Ausdrücke für Zeitabschnitte, die vielen von uns selbstverständlich erscheinen, wie »Wochen«, »Stunden« und »Minuten«.
Tatsächlich beziehen sich die meisten Sprachen nicht auf solche Konzepte, da es sich dabei um recht junge Innovationen handelt, die von bestimmten Zahlensystemen abhängig sind, und sie sind aus einer engen Abfolge sprachlicher und kultureller Konventionen entstanden und haben sich erst im letzten Jahrhundert in vielen Sprachen verbreitet. Trotz des Fehlens solcher Begriffe gibt es in Kuuk Thaayorre Wörter für zeitliche Einheiten, die mit natürlichen Phänomenen zusammenhängen und nicht kulturell bedingt sind. Dazu gehören Wörter für jahreszeitliche und tageszeitliche Zyklen sowie Wörter für einige andere grundlegende Zeitbegriffe wie »heute« und »morgen«, »bald« und »vor langer Zeit«. Noch verblüffender ist, dass die Sprecher der Sprache die Zeit auch durch Ausdrücke beschreiben, die sich auf die Bewegung der Sonne beziehen. Laut Gaby können sie raak pung putpun sagen, oder »die Zeit, wenn die Sonne oben steht«, um sich auf den späten Morgen und den Mittag zu beziehen. Oder sie bezeichnen den Sonnenuntergang als pung kaalkurrc, »die Zeit, in der die Sonne kalt ist«. Wie in einigen anderen Sprachen, darunter einer aus Amazonien, auf die weiter unten eingegangen wird, beziehen sich die Zeitangaben auf die »Bewegung« der Sonne entlang ihres Laufs durch den Tag. Dieser zeitliche Bezug ist zwar nicht so regelmäßig oder quantifizierbar wie unsere Stunden und Minuten, aber er hat eine ähnliche Funktion.
Links oder westlich?
In Sprachen wie Kuuk Thaayorre ist vielleicht das Interessanteste, dass die Art und Weise, wie die Sprecher über Zeit denken, mit der Art und Weise zusammenhängt, wie sie über den Raum sprechen, der sich um sie herum erstreckt. Die Sprecher dieser Sprache beziehen sich häufig auf Himmelsrichtungen, die mit der Bewegung der Sonne zusammenhängen. So wird beispielsweise -kaw verwendet, um die Richtung nach Osten zu bezeichnen, während -kuw die Richtung nach Westen benennt. Dieses System gilt auch für die Beschreibung der Anordnung von Objekten in kleinem Maßstab. Während man sich darauf beziehen könnte, dass ein Objekt beispielsweise »links« von einem anderen liegt, würde ein Kuuk-Thaayorre-Sprecher sagen, dass der Gegenstand »westlich« von einem anderen liegt, da Kuuk Thaayorre keine egozentrischen Begriffe für »links« und »rechts« verwendet, wie es beispielsweise im Englischen der Fall ist. Solche egozentrischen Begriffe sind in den Sprachen der Welt nicht so verbreitet, wie viele Menschen annehmen. Stattdessen sind die Himmelsrichtungen und die Bewegung der Sonne entscheidend dafür, wie die Sprecher von Kuuk Thaayorre die Lage von Objekten beschreiben, und die Bewegung der Sonne ist auch relevant für die Beschreibung der Zeit. Man könnte sagen, dass diese Sprache von ihren Sprechern verlangt, geozentrisch oder sogar heliozentrisch orientiert zu sein.
Ähnliche Beiträge:
- None Found



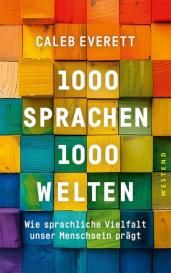
Ein wunderbarer Artikel. Vielen Dank dafür. Dass Realität und Wirklichkeit verschieden sind, übersehen wir im Alltagswahnsinn viel zu sehr.
Dazu eines meiner Lieblingszitate:
„Ein Mann blickte auf seine Gleichungen und sagte, das Universum hat einen Anfang Es hat einen Knall gegeben, sagte er. Einen Urknall, und das Universum war geboren. Und es dehnt sich aus, sagte er.
Er berechnete sogar die Lebensdauer: Zehn Milliarden Umkreisungen der Erde um die Sonne. Die Welt jubelte, Man hielt seine Berechnungen für Wissenschaft. Niemand bedachte, daß der Mann mit der Annahme, das Universum habe einen Anfang, lediglich der Logik seiner Muttersprache gefolgt war. Diese Logik verlangt den Anfang wie eine Geburt und Entwicklungen wie das Heranwachsen und das Ende wie den Tod als Darlegungen von Fakten. Das Universum hatte einen Anfang, und es wird alt, so versicherte uns der Mann, und es wird sterben, wie alles stirbt, wie auch er starb, nachdem er mathematisch
die Logik seiner Muttersprache bestätigt hatte.
Die andere Sprache
Hatte das Universum wirklich einen Anfang? Entspricht die Theorie vom Urknall der Wahrheit?
Das sind keine Fragen, obwohl es den Anschein hat. Ist die Logik, die einen Anfang, Entwicklungen und ein Ende als Darlegung von Fakten verlangt, die einzig bestehende Logik?
Das ist die eigentliche Frage.
Es gibt mehr als eine Logik.
Es gibt zum Beispiel eine, die verlangt, daß man eine
Vielfalt von Intensitäten als Fakten anerkennen muß, Nach dieser Logik beginnt nichts und endet nichts.
So gesehen, ist die Geburt kein klares, eindeutiges Ereignis, sondern eine besondere Art der Intensität.
Das gilt auch für das Heranreifen und für den Tod.
Ein Mann mit dieser Logik stellt fest, wenn er seine Gleichungen betrachtet, daß er genug unterschiedliche Intensitäten berechnet hat, um glaubwürdig sagen zu können, das Universum hatte keinen Anfang, und es wird niemals enden, aber es durchlief, es durchläuft und wird in Zukunft endlose Veränderungen der Intensität durchlaufen. Dieser Mann könnte sehr wohl zu dem Schluß kommen und sagen:
„Das Universum ist das Vehikel der Intensität. Man kann es benutzen,um sich endlos lange durch Veränderungen zu begeben.“
All das und noch viel mehr wird er erkennen, ohne vielleicht jemals zu begreifen, daß er bloß die Logik seiner Muttersprache bekräftigt.“ (aus dem Vorwort von „Das Wirken der Unendlichkeit“ von C. Castaneda
Man kann mit Sprache auch viel Schwurbeln, wenn der Tag Längen aufweist. Ich nehm’ das mal humorvoll.
„Am Anfang stand das Wort “
Aus Babylon 5 …
Halluzinogene sind geeignet, besser zu verstehen, dass jedes zu Wahrnehmung fähige Wesen die Welt anders sieht. Dass diese Einsichten vor Pflanzen und Steinen nicht halt machen, zeigt auch, wie ungeeignet sie für den Alltag sind.
@Artikel
Der starke sprachliche Bezug auf örtliche Geographie oder den Sonnenlauf funktioniert vermutlich nur, wenn die Menschen nicht hinter dicken Mauern den Tag verbringen und sichergestellt ist, dass das Gelände übersichtlich ist und nicht die einen am Meer, die anderen in der Steppe und die nächsten in den Bergen leben.
Danke, interssanter Artikel. Er bestätigt die Ausführungen anderer Forschungen, z.B.
https://www.derstandard.at/story/2000056569681/ostasiaten-nehmen-raeume-ganz-anders-wahr-als-europaeer
Und auch die von:
„Die seltsamsten Menschen der Welt: Wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde“
Welches zahlreiche Studien anführt, die das belegen (tolles Buch, leider furchtbar gegendert, die Übersetzer sollte man hochkant rauswerfen!).
Was wir als normal empfinden, ist es nicht, wir sind anders (was besonders witzig ist, weil wir ja bei jeder Gelegenheit die „Gleichheit“ aller Menschen postulieren, es aber mit unserer eigenen Forschung widerlegen).
Zum Teil liegt das vermutlich an der Sprache (wobei sich hier die Frage aufdrängt, wie herum die Kausalität liegt), zum Teil an der Bildung (je weniger gebildet eine Ethnie, desto fremder ist uns ihre Wahrnehmung). Konsens ist wohl, dass wir sehr individualistisch wahrnehmen (um nicht das negative „egoistisch“ zu benutzen), während einfachere Völker sehr viel kontextorientierter wahrnehmen.
Das hat nicht nur Nachteile, ich erinnere mich an eine Studie, in der man gefragt hatte, ob jemand bestraft werden sollte, der versehentlich eine falsche Tasche mitgenommen hat. Für Westler war das Motiv der Person entscheidend, für einfachere Ethnien war es jedoch der Kontext („hat Tasche weggenommen“), der über das Urteil entschied. Man erkennt das auch an Dingen wie „Ehrenmorden“, einem Westler ist das Konzept einfach fremd, jemand aus einer Clangesellschaft, in der der Mensch primär durch seinen Kontext, seine Aufgaben und Stellung im Clan, definiert ist, findet das aber normal und notwendig oder beugt sich den Traditionen zumindest oft.
In Afrika krankt die wirtschaftliche Entwicklung z.B. daran, dass man dort als Individuum nicht abgegrenzt ist, sondern jemand der z.B. Geld verdient, ganz selbstverständlich dann die weitere Familie zu versorgen und zu beleihen hat (eine Sache die u.a. zu massiver Korruption führt, weil natürlich auch Posten usw. als „Einkommen“ gerechnet werden und unter der Familie aufgeteilt). In der Konsequenz führt das dann dazu, dass oft nur soviel gearbeitet wird, wie man unbedingt muss, denn bei Mehrarbeit hat man ja keinen Nutzen davon (eine Spielart der „Tragik der Allmende“, wie sie so ähnlich auch im Kommunismus auftritt und jegliche Motivation killt).
Ich halte es für sehr wichtig, sich dieser Unterschiede bewusst zu werden, schon deshalb, weil es oft zu gegenseitigem Unverständnis, vor allem in der internationalen Politik, führt…
Nicht ‚jegliche‘, sondern die bei uns im Kapitalismus vorherrschende extrinsische des Arbeitens für Geld. Die intrinsische Motivation – etwas Gutes herzustellen, das von anderen gebraucht und gewürdigt wird – ist gerade nicht betroffen und könnte sich weitaus freier entfalten.
Die herrscht auch im Kommunismus vor, sie erledigt 99,99% der anfallenden Arbeitsleistung. Niemand leert zum Spaß Mülltonnen, arbeitet an einem Hochofen oder putzt mal eben ein Bürogebäude…
Theorie vs. Praxis, Kommunismus ist in der Praxis (eben durch den Wegfall ebenjener extr. Motivation) derart ineffizient, dass nicht nur beide Geschlechter Vollzeit arbeiten sollten, sondern auch insgesamt mehr Wochenstunden als im Kapitalismus. Mit anderen Worten: private Motivation und Zeit waren noch weit knapper, als im Kapitalismus. Dazu kam eine Güter-Unterversorgung, d.h. man konnte oft nicht mal eben kaufen, was man für seine Hobbies brauchte. Im Endeffekt versuchten viele dann zum Feierabend, das zu ersetzen, was ihnen selbst an Komfort mangelte, vom Kleidung nähen, bis zum Schwarzhandel mit Autoersatzteilen.
Wieso sollte sich intr. Motivation also freier entfalten können? Konnte es nicht, zumal Privatinitiative ungern gesehen wurde und kritisch beäugt, hätten ja Reaktionäre, Kirchliche oder gar westliche Agenten dahinter stecken können…
Aber ich weiß, warum du das denkst, du gehst vom Bürgergeld-Kommunismus aus, bei dem niemand mehr arbeiten muss und alle von sich aus tolle Sachen machen. Ich kann dir garantieren, dass das so nicht funktionieren würde, weil die meisten Menschen eben nicht so ticken, das ist reines Wunschdenken!
Im Übrigen kann man streiten, ob „Geld verdienen“ eine extrinsische Motivation ist oder vielmehr selbst intrinsisch, denn Geld lässt sich direkt in begehrte Güter, Lebensstil und Status umwandeln, Dinge die vielen Menschen ausgesprochen wichtig sind…
Sie wissen offenbar wenig, wenn Sie Kommunismus für etwas halten, das selbst seine Protagonisten nur etwas verschämt als ‚real existierenden Sozialismus‘ bezeichnen mochten. Am wenigsten aber, was ich warum denke.
Danke für den Einwurf, wobei ich noch ergänzen möchte, dass Kapitalismus am Ende halt auch keine Lösung ist… auch wenn sich das niemand mehr vorstellen sollen darf ; )
Nun, Komunismus ist jedenfalls keine Alternative.
Ist ja nicht so, dass er überall gescheitert wäre und es aus zahlreichen Gründen auch beim nächsten Mal wieder tun würde…
Kapitalismus mag in vielerlei Hinsicht problematisch sein, aber im Ggs. zu einem totalitär-ideologischen System wie dem Kommunismus kann er ansatzweise demokratisch korrigiert werden. Die Probleme mit selbigen sind m.E. alle lösbar, sofern das Bewusstsein dafür existiert, es wäre sinnvoller darauf hinzuwirken, als immer wieder die alten (für jeden historisch gebildeten Menschen längst eingestürzten) Traumschlösser zu bauen…
Ich bin in diesem System aufgewachsen, aber leb ruhig weiter in deiner Traumwelt.
Dass die Sache nur „Sozialismus“ hieß, lag einfach daran, weil die Stufe der totalen Eigentumslosigkeit ebensowenig erreichbar war und sinnvoll ist, wie es gelang den vollkommen altruistischen Menschen zu züchten. Die ganze Ideologie ist hochgradiger Quark von Leuten, die die menschliche Natur nicht verstehen und von Wirtschaft nur den veralteten Rudel-Quark, den Marx. Lenin und Engels produziert haben. Die Kommunisten im Ostblock (und sonstwo) waren i.d.R. bodenständig genug, um zu erkennen, was sie (noch) nicht machen können. Die durchgeknalltesten, wie die rote Khmer, befolgten „Panicmans“ Weg und töteten alle, die irgendwie aus der Masse herausstachen, was so ziemlich das Allerdümmste ist, was man tun kann.
Bei mir liegt der Sonnenuntergang-Stift rechts vom Tagsüber-Stift. Beide liegen senkrecht vor mir. Der Nachts-Stift waagerecht darunter. Hmm…
Bezüglich der Schreib- bzw. Leserichtung gibt es auch andere Beispiele wie unterschiedlich Wahrnehmung sein kann. Auch Bilder werden unwillkürlich so „gelesen“. So ist es dann auch bei Fotografen oder Malern verbreitet, den Blick des Betrachters entsprechend „führen“. Entspricht die gewohnte Leserichtung des Betrachters nicht dem Konzept des Bildes, wirkt es völlig anders.
Und das mit den Himmelsrichtungen ist uns in der modernen Zivilisation wohl ziemlich abhanden gekommen. Wenn man jemanden, der nach dem Weg fragt sagt, er müsse am der nächsten Kreuzung Richtung Norden, wird er meist auf dem Schlauch stehen.
Hach, die Philosophen schon wieder! Ob man die Sonne von links nach rechts, oder rechts nach links ziehen läßt, hängt sehr wahrscheinlich weniger vom Kulturkreis, als vielmehr vom gewohnheitsmäßigen Standort auf dem Planeten ab. Für gewöhnlich beobachtet man die Sonne (und alles andere auch) nämlich so, daß man sich dabei den Kopf nicht verrenkt, sprich sie sich zwischen 0 und 90 Grad vertikal befindet. Und mit dieser Voraussetzung blickt man auf der Nordhalbkugel (präziser: nördlich des nördlichen Wendekreises) immer nach Süden, womit sie von links nach rechts zieht, wogegen sie auf der Südhalbkugel im nördlichen Teil steht und von rechts nach links zieht. Zwischen den Wendekreisen ändert sich das im Jahresverlauf, für die äquatornahen Gruppen wäre das Experiment tatsächlich interessant, bei allen anderen dürfte die Anordnung der imaginären Stifte rein geographisch bedingt sein.
Schön für eine philosophische Mittagspause, auch einmal so einen Text hier auf Overton zu lesen. Und auch die Diskussion ist überraschend sachlich.
Seitdem die Zeit besteht https://youtu.be/nOVvEbH2GC0?si=d_W6CvifGzyQFdBy da haben welche das mal bildlich Dargestellt.
Länge oder Kürze 12 Minuten
„Woran denken Sie, wenn Sie das Wort „blubber“ hören?“
Blubber kommt jeden morgen aus meinem Internetradio, wenn ich noch nicht wach genug bin, um schon mein Zweitsprachmodul angeworfen zu haben. Den Übergang von Blubber zu verständlichen Worten finde ich immer wieder verblüffend und reizvoll.
Ansonsten finde ich es immer wieder faszinierend, wie Sprachen verschiedene Konzepte widerspiegeln und gleiche Sachverhalte auf sehr unterschiedliche Weise ausdrücken und ich finde es dann enorm spannend, eine möglichst treffende Übersetzung in der eigenen Muttersprache zu finden.
„würde ein Kuuk-Thaayorre-Sprecher sagen, dass der Gegenstand »westlich« von einem anderen liegt, da Kuuk Thaayorre keine egozentrischen Begriffe für »links« und »rechts« verwendet, wie es beispielsweise im Englischen der Fall ist.“
Stellt sich für mich die Frage, wie die z.B. Links- und Rechtshändigkeit unterscheiden, wenn sie keine egozentrischen Begriffe dafür haben. West- und Osthand kann ja nicht sein, es sei denn, die drehen sich niemals um.
Soweit ich weiß, haben solche Sprachen häufig unterschiedliche Bezeichnungen für die rechte und die linke Hand. Also sozusagen nicht zweimal „Hand“, sondern einmal „Hand“ und einmal „Hond“.
Ich habe mit mit 13 Jahren eine Diodenmatrix gebastelt für eine 7 Segment Anzeige, und als ich fertig war sagte man mir “ Dafür gibt es doch Schaltkreise“ . o)))
Ich war nicht sauer darüber, denn das Buch “ Elektronik“ DDR Verlag, zeige mir erst einmal den Historischen Kontext auf dieser Entwicklung, und Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
Da wurde ich auch das erste mal mit „Multiplexverfahren“ konfrontiert, was ja am Ende darauf beruht, Zeitliche Abläufe beherrschen zu können .
Sexagesimalsystem zb , die alten Babylonien haben das erfunden um Zeit rechnen zu können , wobei der Ursprung noch weiter zurück reicht…
Wir sagen heute “ Entwicklungsländer “ dazu , welch unglaubliche Arroganz .
Artikel finde ich gut …
Weiß zum Thema nix, Habe aber einen passenden Blues:
https://youtu.be/jZhI8NbB0zg
👍😎
wow den kannte ich von Ihm noch gar nicht… thx o))
Genau genommen ist Zeit zyklisch, also ist die Zeit ein Kreis. Dort gibt es, wie auf der Erde, keinen Anfang und kein Ende. Wie auch die Zeit weder einen Anfang noch ein Ende hat. Der Kreis ist dann auch der Inbegriff der Vollkommenheit. Denn er ist endlich unendlich, jeder Punkt ist vom Mittelpunkt gleich weit entfernt undd in der Kugel ist die Vollkommenheit dann dreidimensional.
Konsequenterweise ist das Universum als solches dann auch kugelförmig denkbar. Und wie die Kugel zum Kreis steht, wird dann der vierdimrndionsle Raum wiederum vollkommen sein und aus der Kugel hervorgehen. Außerdem ist diese Betrachtungsweise zutiefst unegoistisch, weil kein Punkt auf dem Kreis oder der Kugel bevorzugt gegenüber allen anderen ist.