
Die Wirtschaft sollte den Menschen dienen – könnte man meinen. Und obwohl die neoliberale Ökonomie so tut, als sei ihre Auffassung von Wirtschaft auf die Menschen ausgerichtet, geschieht das Gegenteil.
Der Ökonom Patrick Kaczmarczyk nennt die herrschende Ökonomie einen »Ego-Kapitalismus« – und glaubt, dass die christliche Soziallehre das Zeug hat, eine menschenwürdigere Wirtschaft zu bekräftigen. Heute erscheint sein aktuelles Buch »Raus aus dem Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaft in Dienste der Menschen«.
Roberto De Lapuente hat sich mit ihm unterhalten.
De Lapuente: Lieber Herr Kaczmarczyk, Ihr neues Buch heißt »Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaft im Dienste der Menschheit« – darin kritisieren Sie, vereinfacht gesagt, die neoliberale Marktwirtschaft. Neoliberale Ökonomen behaupten aber durchaus, dass ihr Modell im Dienste der Menschheit funktioniert. Lügen die sich selbst oder uns was vor?
Kaczmarczyk: Wenn neoliberale Ökonomen behaupten, dass ihr Modell des Ego-Kapitalismus im Dienste der Menschheit funktioniert, dann behaupten die dies aus politischem Kalkül, um ein Modell durchzusetzen, das den reichsten paar Prozent der Gesellschaft dient. Darin liegt die Krux: wenn man alle glauben macht, dass jeder nur für sich selbst verantwortlich ist, dann brauchen wir uns einerseits über systemische Zusammenhänge keine Gedanken mehr zu machen. Andererseits können wir an den Marktergebnissen nichts ändern, denn sie sind ja per se wertneutral. Der Arbeitslose ist in dieser Welt genauso für sein Schicksal verantwortlich wie der Milliardär, der seinen Reichtum allein seinem Genie zu verdanken hat.
De Lapuente: Wenn jeder auf sich selbst schaut, ist am Ende jedem geholfen – das ist der Wahlspruch der herrschenden Ökonomie. Warum halten Sie ihn für falsch?
Kaczmarczyk: Ich glaube noch nicht einmal, dass das der Wahlspruch der herrschenden Ökonomie ist. Es ist der Wahlspruch derer, die die Theoreme der herrschenden Ökonomie für die eigenen Zwecke instrumentalisieren. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Selbst im Mainstream gibt es beispielsweise das zweite Wohlfahrtstheorem, dass für einen Eingriff in die Anfangsausstattung der Marktteilnehmer plädiert. Das würden Verfechter des Neoliberalismus niemals zulassen. Wo ich in der Tat Probleme in der herrschenden Ökonomie sehe, ist, dass sie die stetigen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Akteuren und Sektoren in einer Wirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt – denn es sind gerade diese Wechselwirkungen, die dem System eine potenziell selbstzerstörerische Dynamik geben.
»Ökonomie suggeriert Wertneutralität und Präzision«
 De Lapuente:Das müssen Sie kurz anhand eines kurzen und Beispiels bildlich nachvollziehbarer machen. Welche Wechselwirkungen meinen Sie?Kaczmarczyk:
De Lapuente:Das müssen Sie kurz anhand eines kurzen und Beispiels bildlich nachvollziehbarer machen. Welche Wechselwirkungen meinen Sie?Kaczmarczyk:
Nehmen wir als Beispiel das Paradox des Sparens. Wenn Haushalte und Unternehmen anfangen, Geld auf die hohe Kante zu legen und der Staat ebenfalls versucht, seine Ausgaben zu kürzen, dann bricht die Wirtschaft zusammen. Die Ausgaben des einen sind schließlich die Einnahmen eines anderen. Wenn nun alle versuchen, höhere Einnahmen als Ausgaben zu erzielen, also zu sparen, geht die Nachfrage den Bach herunter, sodass die Unternehmen ihre Produktionskapazitäten abbauen und ihre Angestellten entlassen. Gängiger Theorie dürfte es gar nicht so weit kommen, denn durch den Aufbau an Ersparnissen müsste der Zins eigentlich fallen und damit irgendwen wieder zum Investieren, also Geldausgeben, anregen.
De Lapuente: Man hat uns jahrelang die sprichwörtliche »schwäbische Hausfrau« als Musterbeispiel gelungener Wirtschaftspolitik verkauft. Dass die nicht ganz stimmig ist für eine Volkswirtschaft, ist ja nun kein ganz großes Geheimnis mehr. Aber die Schuldenbremse ist noch aktiv – man kann die doch als Folge eines Denkens betrachten, die der schwäbischen Hausfrau zugrunde liegt, oder?
Kaczmarczyk: Definitiv. Und da sie sogar dummerweise in der Verfassung verankert wurde, kriegt man die dort auch schwer wieder raus. Das war ein gelungener Clou der Ordos und der geballten deutschen, konservativen Medienpower, dass man die Politik damals dazu getrieben hat.
De Lapuente: Sie sind Ökonom, argumentieren aber trotzdem ethisch – viele Ökonomen, besonders die der angebotsorientierten Auslegung, schieben moralische Aspekte eher weg. Muss Ökonomie ethisch sein – oder gar werden?
Kaczmarczyk: Ökonomie ist heute weitgehend so konzipiert, dass sie mechanischen Prinzipien folgt und auf diese Weise eine Wertneutralität und Präzision suggeriert, die es sonst nur in der Physik gibt. Wenn man in diesem Rahmen aufhört nachzudenken und sich der Grenzen der eigenen Weltsicht nicht mehr bewusst ist, dann wird es schwierig. Gerade im Kontext der Entwicklungspolitik merkt man dies deutlich. Dort bekommen insbesondere die ärmsten Länder der Welt immer noch zu hören, dass sie einfach nur einen möglichst freien und gut funktionierenden Markt brauchen – und der Rest erledigt sich von selbst. Belegt wird das Ganze mit schönen Gleichgewichtsmodellen, die dann, sobald die Liberalisierungs- und Sparprogramme umgesetzt werden, in eine Katastrophe münden.
»Die Soziallehre steht gegen alles, was konservative Parteien fabriziert haben«
De Lapuente:Gibt es Beispiele, wo das im Moment so praktiziert wird?Kaczmarczyk:
Was der Internationale Währungsfonds derzeit in Pakistan oder Sri Lanka veranstaltet, ist ein mustergültiges Beispiel dafür. Aber auch bei uns in Europa und in Deutschland waren es Mainstreamökonomen, die beispielsweise die irrsinnigen Austeritätsprogramme mit ihren Arbeiten unterfüttert haben, die zu einem verlorenen Jahrzehnt bei uns führten. Die Ideen der Ökonomie haben deshalb zwangsläufig gewaltige Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, sodass ethische Fragen an sich unausweichlich werden – wobei es natürlich auch unter den guten Mainstreamökonomen welche gibt, die undogmatisch über den Tellerrand hinausblicken können und dies auch tun. Das sollte man mit Pauschalisierungen vorsichtig sein.
De Lapuente: In Ihrem Buch bringen Sie auch die katholische Soziallehre vor – als Wegweiser für eine bessere Wirtschaft. Ich bin mir sicher, dass das in Zeiten schwindender Kirchenmitglieder nicht jedermann sofort einleuchtet. Wie würden Sie Skeptikern in kurzen Worten die Soziallehre beschreiben?
Kaczmarczyk: Die Soziallehre gibt die Prinzipien wieder, die sich aus dem christlichen Glauben ableiten. Sie stellt die Würde des Menschen in den Mittelpunkt, plädiert für die gesamtgesellschaftliche Teilhabe am technologischen Fortschritt, schlägt sich in der Beziehung Arbeit vs. Kapital auf die Seite der Arbeit, fordert eine andere Form der internationalen Zusammenarbeit und erinnert die Politik an die Bewahrung der Schöpfung, die sich aus dem zweiten Schöpfungsbericht ergibt. Kurz: die Soziallehre steht im Grunde gegen alles, was insbesondere konservative Parteien und Politiker, die sich gerne des »Cs« in ihrem Namen rühmen, fabriziert haben. Für mich ist sie ein wunderbarer, weil ganzheitlicher Ansatz, der an das Wertefundament unserer Gesellschaft anschließt, welches wir durch den ganzen Schutt des Ego-Kapitalismus aus den Augen verloren haben.
De Lapuente: Seit wann gibt es die katholische Soziallehre eigentlich? Und hat sie in Vergangenheit bereits Reformer oder Ökonomen beeinflusst?
Kaczmarczyk: Papst Leo XIII. setzte zum Ende des 19. Jahrhunderts mit der Enzyklika Rerum Novarum den formalen Startschuss für die Soziallehre. Damals war es vor allem die Situation der Arbeiter in der Industrie, die die katholische Kirche zur systematischen Ausarbeitung der christlichen Prinzipien für die Wirtschaftspolitik trieb. Seither veröffentlichte der Vatikan regelmäßig diverse Enzyklika, in dem für gewöhnlich der Finger immer in die Wunden gelegt wurde, in der es gerade am meisten blutete. So stelle die Soziallehre beispielsweise dem totalitären Kommunismus das Prinzip des Privateigentums entgegen. Seit den 1980er Jahren kritisiert sie zunehmend die Hyperindividualisierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Und zuletzt bearbeitete sie vermehrt den Aspekt der Nachhaltigkeit.
»Eine gewisse Bescheidenheit täte vielen Ökonomen gut«
De Lapuente:Laut eines Slogans leben wir im besten Deutschland aller Zeiten – gleichzeitig nehmen viele von uns, auch ich, eine massive Verarmung in der Gesellschaft wahr. Neuerdings sehe ich in Frankfurt viele ältere Mitbürger betteln oder auch »nur« Flaschen sammeln. Ist es so, dass die herrschende Ökonomie die soziale Spaltung als Nebenprodukt sieht – oder ist der Klassismus gar ihr Ziel?Kaczmarczyk:
Ich würde nicht so weit gehen, ihr zu unterstellen, dass Klassismus ihr Ziel sei, aber ihre Ideen und Theoreme lassen sich enorm gut instrumentalisieren, wenn man in der Wirtschaft am längeren Hebel, also in einer Machtposition, sitzt. Wir sehen das nicht nur in Deutschland, wo beispielsweise Lobbyverbände und primitiv-marktliberale Stiftungen auf Basis von Mainstreamannahmen gegen Mindestlöhne oder Gewerkschaften hetzen. Oder den Niedriglohnsektor rechtfertigen, da der Lohn nur das Ergebnis des Grenzproduktes der Arbeit ist. Auch in der internationalen Wirtschaft dienen vereinfachte Prinzipien der Mainstreamökonomik oft als Instrument für die Durchsetzung von Interessen. Die Theorie des komparativen Vorteils, die der Nobel-Gedächtnispreisträger Joseph Stiglitz mal als »Theorie der komparativ Bevorteilten« bezeichnete, unterliegt als Rechtfertigung einer äußerts dysfunktionalen Handels- und Finanzordnung, die die Länder des globalen Südens benachteiligen.
De Lapuente: Jetzt haben wir wieder so einen Begriff, lieber Herr Kaczmarczyk – seien Sie bitte so nett, erklären Sie mir und den Lesern in kurzen und bildhaften Worten, was der »komparative Vorteil« ist.
Kaczmarczyk: Die Idee des komparativen Vorteils besagt vereinfacht, dass der Freihandel für alle Länder vorteilhaft ist, weil jedes Land die Güter und Dienstleistungen produzieren wird, in denen es relative Kostenvorteile hat. Die absoluten Vorteile werden irrelevant. Wenn beispielsweise Portugal im Handel mit England sowohl Wein als auch Tuch günstiger herstellen kann, aber relative Kostenvorteile beim Wein hat, so würde es für beide Länder von Vorteil sein, wenn Portugal sich nur auf die Produktion von Wein beschränkt, die Produktion von Tuch jedoch den Engländern überlässt. Sofern beide Länder miteinander Handel betreiben, können sie insgesamt mehr produzieren und konsumieren als es unter Autarkie der Fall wäre. Diese schöne Idee funktioniert in der Praxis allerdings nicht, in der die Unternehmen von sich aus ihre absoluten Vorteile ausnutzen und bei Engpässen ihre Kapazitäten durch Investitionen erweitern. Zudem fehlt ein stabiles internationales Währungs- und Finanzsystem, auf dessen Basis ein für alle Seiten vorteilhafter Handel ablaufen könnte.
De Lapuente: Sie sprachen vorhin von der vermeintlichen Präzision der Ökonomie, die quasi wie eine exakte Wissenschaft bewertet wird. Sollten Ökonomen denn – auch um bei den Menschen glaubwürdig zu bleiben – den sokratischen Ansatz kundtun, also auch sagen, dass sie wüssten, nichts (oder nicht alles) zu wissen? Wäre dieses Eingeständnis nicht auch eine Form ethischer Ökonomie?
Kaczmarczyk: Ja, ich glaube eine gewisse Bescheidenheit täte vielen Ökonomen gut. Prognosen werden erstellt und ständig revidiert, da die Parameter und Annahmen, die den Prognosen zugrunde liegen, sich stetig ändern. Man sollte die Vorhersagekraft entsprechend vernünftig einordnen und die Unsicherheiten, die mit Prognosen einhergehen, klar kommunizieren. Die Zukunft ist eben fundamental unsicher und die Entwicklung der Ökonomie steht in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis von den Entwicklungen in der Politik, Gesellschaft und Umwelt. Wer sich in wissenschaftlicher Präzision und Unfehlbarkeit wähnt, der macht sich am Ende nur lächerlich.
»Ob sich die Einseitigkeit in der Lehre irgendwann auflöst, ist nicht abzusehen«
De Lapuente:Glauben Sie, es wäre vernünftig, Ökonomie als Schulfach einzuführen? In der Theorie hieße das ja, dass Menschen die Prozesse besser durchschauen könnten. Andererseits, welche Ökonomie würde da gelehrt? Die Lehrstühle dieser Republik machen ja nur in angebotsorientierter Wirtschaft. Gibt es Hoffnung, dass sich diese Einseitigkeit irgendwann auflöst?Kaczmarczyk:
Ja, wenn die Angebotsökonomik sich früh in die Köpfe der Kinder und Jugendlichen brennt, wäre das eine Katastrophe. Selbst im Studium bereitet diese unkritische Hegemonie Probleme. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich nach dem ersten Semester VWL meinem Vater anhand von Angebots- und Nachfragekurven erklärt habe, warum ein Mindestlohn bestenfalls wirkungslos und schlimmstenfalls ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm ist. Es hat eine Zeit gedauert, bis ich auf andere Theorieschulen stieß, die eine viel stärkere Erklärungskraft für gesamtwirtschaftliche Entwicklungen hatten. Ob sich die Einseitigkeit in der Lehre irgendwann auflöst, kann ich nicht absehen, auch wenn es erste Anzeichen gibt, dass die Studenten selbst damit ihre Unzufriedenheit äußern und Druck ausüben, um andere Inhalte durchzuarbeiten.
De Lapuente: Ich bat Sie ja vorhin schon um Spezifikationen, weil den Menschen gewisse Termini aus den Wirtschaftswissenschaften einfach nicht geläufig sind. Führt diese »Geheimsprache« nicht dazu, dass Menschen sich eher von ökonomischen Diskursen ausgeschlossen fühlen? Und müsste die Ökonomie als Wissenschaft nicht nur die Ethik besser im Blick haben, sondern eben auch eine leichtere Verständlichkeit?
Kaczmarczyk: Ja definitiv. Hinter vielen sehr technisch und anspruchsvoll klingenden Begriffen stehen oftmals sehr einfache Zusammenhänge. Allerdings ist der Gebrauch gewisser Fachtermini nicht zu vermeiden – und beispielsweise die Coronakrise zeigte uns, dass sich viele Menschen da gerne hineinfuchsen, wenn sie ein Thema umtreibt. Zudem ist es immer eine Gradwanderung zwischen leichter Verständlichkeit und einer angemessenen Tiefe im Argument, das der Komplexität unserer Welt gerecht wird. Gerade rechtskonservative Kreise machen es sich ja zunutze, dass sie mit plumpen Bildern und Schlagwörtern arbeiten und so die Massen verführen wollen. Inhaltlich liefern sie dabei Torschüsse, die im Seitenaus landen. Aber das juckt dort niemanden, solange die Botschaft zieht. Hier ist es für progressive Kräfte wichtig, dass sie daran arbeiten, auf dieser Gradwanderung nicht zu stolpern und dem Rechtspopulismus sowohl Inhalte wie auch Verständlichkeit entgegensetzen.
Dr. Patrick Kaczmarczyk ist Entwicklungsökonom. Zuletzt arbeitete er als Berater für die Vereinten Nationen zur Finanzmarktstabilität im globalen Süden sowie zur wirtschaftlichen Entwicklung in Ostafrika. Derzeit ist er als wirtschaftspolitischer Referent in Berlin tätig. Er promovierte als Stipendiat des Economic and Social Research Council (ESRC) am Institut für politische Ökonomie der Universität Sheffield. Im Westend Verlag erschien zuletzt „Kampf der Nationen“ (2022). Das Buch landete auf der Shortlist des renommierten Hans-Matthöfer-Preises für Wirtschaftspublizistik 2023.
Ähnliche Beiträge:
- Die Ursprünge der Neoklassik
- Zentrale Regelungen und Institutionen einer anstrebenswerten nachkapitalistischen Wirtschaft
- Die fortschreitende Potenzierung der Produktivkräfte
- Deng Xiaoping und die Wende zum Kapitalismus
- Wirtschafts- und Militärmacht China



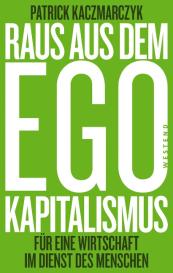
Schon der Begriff „Wirtschaftswissenschaft“ist falsch.Richtiger müsste es Voodoo-Zauber heißen.Das ganze Gebiet,in dem sich diese „Ökonomen“tummeln,hat mit Wissenschaft gar nichts zu tun.Es ist eine reine Propagandashow für Neoliberale Ideologie.
Vor einigen Jahren habe ich mal einen Professor für „Wirtschaftswissenschaft“ nach Daniel Friedrich List gefragt.Diese Mann ist in den Kreisen der „Wirtschaftwissenschaft“weitgehend unbekannt.Dafür können sie fast alle Machwerke der „Chicago -Schule“ aus dem ff aufsagen.
„… und glaubt, dass die christliche Soziallehre das Zeug hat, eine menschenwürdigere Wirtschaft zu bekräftigen.“
Diese christliche Soziallehre war bekanntermaßen im wesentlichen mit für den Antisemitismus und seinen Auswüchsen verantwortlich.
„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist“ und – von Paulus – „wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ fällt mir da spontan noch ein.
In der Tat sehr menschenwürdig…
@ „wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“
Hatte das nicht auch Franz Müntefering (SPD) übernommen um die „arbeitsfaulen HartzIV-Empfänger“ an die Arbeit (die es nicht gab) zu bekommen?
@Otto0815
Genau…. von Paulus, über die Nazis – hin zu den Spezialdemokraten.
Das mit dem Antisemitismus finde in der jetzigen Zeit, cwo jeder offensichtlich gerne dieses Totschlag Argument benutzt, sehr gefährlich. Dazu gehören nachweisbare Fakten. Behaupten kann man alles. Und Paulus – naja, da gibt es in der realen Ökonomie ganz andere Kaliber als nur nicht essen dürfen. Und auch hier gilt, erst die nachweisbaren Fakten ergeben den Beweis. Das das in der Bibel steht, ist noch lange nicht der Beweis, dass die Soziallehre dies als grundlegendes Prinzip hat. Es ist, wie vieles in der aktuellen Situation, nur ein Gegenentwurf zum totalitären Ausbeutersystem. Mehr nicht, aber das wäre in der heutigen Zeit schon mal eine radikale Kehrtwende. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, hat als Gegenentwurf: Haltet Euch an Gott und verehrt nicht den Kaiser. Der bekommt nur Eure Steuern, nicht Eure Seele und Euren Gehorsam. Dann wird das „Kaisersystem“ letztlich zusammenbrechen. Aber solange man den System alles gibt, weil dieses verspricht, für einen da zu sein, dann wird das System weiter leben, bis alles zerstört ist. Kehrt um, macht die Kehrtwende, aber nicht um 360°, verstanden?
„Das mit dem Antisemitismus finde in der jetzigen Zeit, cwo jeder offensichtlich gerne dieses Totschlag Argument benutzt, sehr gefährlich. Dazu gehören nachweisbare Fakten. Behaupten kann man alles….“
Da möchte man nur in die Tischkante beißen…
„Die Wirtschaft sollte den Menschen dienen …“
Sagt oder glaubt WER?
Ja, ja…und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Märchen-Ende!
@„Die Wirtschaft sollte den Menschen dienen …“
Seit der Zeitenwende heißt es nur noch: „Im Gleichschritt marsch, auch für die Wissenschaft“
Ui….ich weiß zwar nicht, auf welchen exakten Zeitpunkt jeder Einzelne diese „Zeitenwendung“ datiert, aber faktisch liegt diese wesentlich weiter zurück! 🤫
Dazu kann man doch nur sagen:
WER SEINE MITARBEITER MIT ERDNÜSSEN BEZAHLT – DER DARF SICH AUCH NICHT WUNDERN WENN ER SPÄTER LAUTER AFFEN UM SICH HAT!‘
Es ist ja allemal ein Skandal wie man mit studentischen Hilfskräften mit ständigen Befristungen und kleinem Gehalt umgeht.. Fachkräftemangel? Wohl mehr Propaganda als Wahrheit!
Auch bei anderen Beschäftigten ist jeder 8. bis 10. nur befristet angestellt. Da muss man sich doch fragen warum die angesichts des Fachkräftemangels nicht fest eingestellt werden.
———————-
Jung, akademisch, prekär
Unbezahlt weiterarbeiten, obwohl der Vertrag schon vor Wochen ausgelaufen ist – was unvorstellbar klingt, ist für beinahe jede fünfte studentische Hilfskraft Realität. Hinzu kommt, dass die Vertragslaufzeit durchschnittlich nicht einmal ein halbes Jahr beträgt und sich die Studierenden von einer Befristung zur nächsten hangeln – ebenso wie auch viele wissenschaftliche Mitarbeiter an den Hochschulen. Das sind einige der Ergebnisse der Studie »Jung, akademisch, prekär?«
https://www.giessener-anzeiger.de/stadt-giessen/jung-akademisch-prekaer-92340027.html
https://www.iaw.uni-bremen.de/f/b1d9874527.pdf
Das war auch schon in den 80er so. Ich habe mich damals 5 geschlagene Jahre zwischen (1) Beschäftigung auf Stundenbasis, (2) Werksverträge, (3) Zeitverträgen von 3 – 6 Monate Dauer mit 50% Beschäftigungsvolumen und (4) Arbeitslosigkeit an der Uni rumgetrieben. Dabei habe ich so gut wie keinen Urlaub gemacht, sondern ständig durchgearbeitet. Durch die Punkte 1 und 2 fehlen mir jetzt 3 Beitragsjahre der Rentenversicherung. Die beiden letzteren haben auch nicht gerade wirkungsvoll zur Rentenhöhe beigetragen.
Da versuche ich das Gespräch mit der realen Situation abzugleichen und komme zu den Schluss, das düsterer Zeiten auf die Leute zukommt.
Denn Ethik müsste ein grosser Anteil wieder erlernen, da meine ich weniger die älteren unter uns, als vielmehr eine Jugend deren Hirne mit jeglichem Müll vollgestopft werden.
Herr Kaczmarczyk aussagen sind definitiv schon richtig, zumindest als Ansatz für Überlegungen was man innerhalb eines Kreises umsetzen kann.
Auch wenn viele von der ‚Kirche‘ enttäuscht sind, bleibt das Haus Gottes eben auch ein Ort um sich zu finden. Oft sind es die Kleinigkeiten die zu grösseren Erkenntnisse führt.
Danke Roberto!
Patrick Kaczmarczyk liegt weit daneben, wenn er den Ego-Kapitalismus zwar zu Recht, anprangert, ihm aber gleichzeitig die Schuld an der Misere zuweist. Wenn es so einfach wäre, könnte die christliche Soziallehre die Probleme lösen. Sie scheitert aber schon an der Vatikan-Bank. Egoisten wie Jeff Bezos, Billy Gates und Elon Musk wird es immer geben. Die Frage ist, welche Strukturen ermöglichen es diesen Egoisten, ihre Milliarden-Vermögen anzuhäufen, mit denen sie dann die Wirtschaft dominieren und sogar versuchen, die Politik beherrschen?
Schon die Überschrift des Artikels ist irreführend:
Ökonomie, die sich in wissenschaftlicher Präzision und Unfehlbarkeit wähnt, macht sich lächerlich.
Dieser Slogan richtet sich gegen die herrschende Ökonomie, richtig, macht aber gleichzeitig wissenschaftliche Präzision lächerlich. Die herrschende Ökonomie ist falsch, aber wissenschaftliche, genauer gesagt, mathematische Präzision im Denken ist grundrichtig, um die Strukturen zu erkennen, die den Ego-Kapitalismus erst ermöglichen. Mathematik ist angesagt, weil Geld immer eine Zahl ist.
Das, was den Ego-Kapitalismus fördert, ist der bestehende Finanzfeudalismus, der den Banken feudale Rechte einräumt, die älter sind als die katholische Soziallehre. Den Begriff Ego-Kapitalismus hatte ich vor ein paar Jahren auch schon benutzt, aber wieder verworfen, weil er den Kern des Problems nicht trifft. Das Problem sind die fundamentalen Grundregeln des Bankensystems, die mit mathematischer Sicherheit zum Geldüberfluss, zur Umverteilung nach oben und zur Finanzoligarchie führen. Mehr ist in einem kurzen Kommentar nicht möglich, zu sagen mit einem Hinweis auf mein Buch und auf die ausführliche Buchvorstellung:
Titel: Hunderttausend Milliarden zu viel
Untertitel: Finanzfeudalismus aus rationaler Sicht
https://kritlit.de/kob/htmzv.htm
Die größte Fähigkeit derer, die sich gerne als Ökonomen sehen oder bezeichnen, besteht in erster Linie in der SChaffung von neuen Begriffen, die zwar nichts erklären, aber den Anschein erwecken, als wären Finanzsystem und Kapitalismus in eine neue Phase eingetreten, in der die alten Mechanismen nicht mehr gelten und durch ganz neue ersetzt wurden. Hier sei erinnert an Begriffe wie „Lohn-Preis-Spirale“, „New economie“ und in jüngster Zeit die sogenannte „Kerninflation“. Zwischendurch war dann mal die Rede von Turbo-Kapitalismus, Casino-Kapitalismus und ähnlich Klangvollem ohne Substanz. Nun hat jemand den Ego-Kapitalismus erfunden, Rob Kenius will mit dem Finanzfeudalismus sich zum Finanzexperten mausern. All diese Begriffe erklären NICHT, wofür sie denn eigentlich stehen. Sie beschreiben ERscheinungen, die dann in den meisten Fällen in den Rang von Erklärungen erhoben werden. Zucker ist Zucker, weil die vorliegende Substanz weiß und körnig ist. ERst wenn man sie in den Kaffee geschüttet hat, merkt man, dass auch Salz weiß und körnig ist. Will sagen, man muss genau untersuchen, worum es sich bei den vorliegenden Veränderungen im Kapitalismus wirklich handelt. Was soll da angeblich an den Mechanismen und den Wirkungsgesetzen des Kapitalismus anders geworden sein? Haben diese sich wirklich verändert oder bringen sie nur neue ERscheinungen hervor? Wenn ein Patient hustet, kann das auf eine Allergie wie Pollenreizung zurückzuführen sein oder grippalen Infekt. Er kann sich aber auch an etwas verschluckt haben, das noch immer in der Luftröhre sitzt und nicht rauskommt. Es kann aber auch Schlimmeres sein wie Lungenentzündung oder sonstige Lungenerkrankungen bis hin zum Krebs. Obwohl die Ursachen verschiedene sind, ist bei allen die Erscheinung dieselbe: Der Patient hustet. Was macht der Arzt? Er untersucht, was die URSACHE der Erscheinung ist.
Dabei ist aber wichtig, dass die Annahmen als Voraussetzungen der Untersuchung richtig sind. Es wäre also falsch bei Husten von Fußpilz auszugehen.
Die mittlerweile weitverbreitete Sichtweise, „die Ausgaben des einen sind schließlich die Einnahmen eines anderen“ ist eine Binsenweisheit, die zu einer weltbewegenden Erkenntnis aufgebauscht wird. Andererseits aber offenbart sie ein statisches Bild von Wirtschaft. Nach diesem Denken gibt es keine Entwicklung. Es ist richtig, dass nur dort Umsatz gemacht wird, wo Käufer sind, also die Ausgaben des einen die Einnahmen des anderen sind. Aber diese Summen sind nicht gleich, sie wachesen und bleiben nicht konstant. Es handelt sich also um sehr vereinfachtes Bild von Wirtschaft, ein idealisiertes, das weltfremde Bild der Elfenbeintürme, wo Welt und Wirtschaft allein durch die Brille von Theorien betrachtet wird, denen das Entscheidende fehlt: Die Überprüfung an der Wirklichkeit.
In diesem Bild von Wirtschaftstätigkeit wird nicht danach gefragt, ob diese aus den Verkäufen geschaffenen Einnahmen auch Gewinne darstellen. Einnahmen alleine bedeuten nicht viel. Auch wer mit Verlust verkauft hat Einnahmen. Aber diese Form von Einnahmen führt in den Untergang eines Unternehmens. Einnahmen sind ein Trugschluss. DAs weiß jeder Handwerker ohne Studium der Wirtschaftswissenschaften. Wichtig ist, was am Ende übrig bleibt. Da kann Sparen z.B. sehr sinnvoll sein, ehe Unternehmen gewaltige Summen investieren, denen am Ende keine Käufer gegenüberstehen bzw nur solche, die nicht gewillt oder in der Lage sind, den Preis für ein Produkt zu zahlen, der unter den gegebenen Produktionsbedingungen erzielt werden muss, damit ein Gewinn entsteht. Da ist das Sparen und Zurückhalten des Geldes oftmals die bessere Entscheidung für ein Unternehmen statt der Investitionen, die keinen Gewinn erwirtschaften. Und ohne Gewinn kann kein Unternehmen und keine Gesellschaft überleben, auch wenn das den Kritikern des Kapitalismus nicht gefallen mag. JEDE Wirtschaftsform ist auf Gewinn ausgerichtet. Auch die christliche Soziallehre kommt ohne Gewinn nicht aus. Da ist es dann nur halt der Gewinn der anderen, die die christlichen Ideen finanzieren und umsetzen.
Da sie mich gleich zu Anfang
Rob Kenius will mit dem Finanzfeudalismus sich zum Finanzexperten mausern
persönlich angreifen, nochmal ganz kurz: Mit den Lehren von Karl Marx und dem Kapitalismus-Begriff kann man heute nicht mehr das System beschreiben, weil die Finanzwelt die gesamte Wirtschaft um ein Vielfaches dominiert, etwas das Marx sich nicht hat vorstellen können.
Ihre veraltete Sichtweise bietet zwar Schreibstoff, aber keine Lösungen, sondern nur die alte Leier: Da müsst ihr erst einmal den Kapitalismus abschaffen.
Oh ja, die Glaubensirrsaetze der schwaebischen Hausfrau oder die „Ruecklagenbildung“ – wobei niemals gesagt wird womit bzw wer fuer diese Ruecklagenbildung dann naemlich in die Verschuldung geht. Der verbreitete Irrglaube, dass wir nur alle die Loehne senken muessen, um im Binnenmarkt Ueberschuesse zu erwirtschaften, von denen wir dann unseren Lebensunterhalt bestreiten usw. Das stammt alles noch aus einer Zeit, als man die eigenen Probleme einfach den Nachbarn vor die Tuer gekippt und die Tuer hinter sich zugezogen hat. Nun sind wir aber in der Eurozone finanztechnisch gesehen ein einziges Land und da geht das eben nicht mehr so einfach, weil der Summe aller Ueberschuesse in diesem Binnenmarkt, Defizite in exakt gleicher Hoehe gegenueber stehen. Nicht nur das. Diese Zeit der schwaebischen Hausfrau hat Europa um Jahre zurueckgeworfen, weil nicht nur nicht in die Zukunft investiert, sondern auch der gemeinsame Boden regelrecht erodiert wurde mit der Folge dass die Sozialsysteme zerstoert, vielen Menschen die Einkommensicherheit genommen und damit der Nationalismus regelrecht befeuert wurde. Der Wunsch nach einem „Aufraeumer“ liess die Umfragen fuer Rechtsaussen in die Hoehe schnellen. Deutschland ist da ja eher Schlusslicht.
Patrick Kaczmarczyk hat bereits mit seinem ersten Buch sehr eindruecklich beschrieben, wie wir durch diese Politik unseren eigenen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Boden zerstoeren. Wenn das zweite so gut ist, wie das erste, dann ist es sehr lesenswert.
Noch ein Hinweis. In diesem Zusammenhang faellt mir ein grossartiger Artikel des einstigen FAZ-Vordenkers Frank Schirrmacher ein, den er im August 2011 nach der Finanzkrise schrieb:
Ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. (Uebrigens hat auch Schirrmacher seinerzeit ein Buch „EGO – Spiel des Lebens“ herausgebracht, in dem er sich mit dem Monster in der Oekonomie auseinandersetzt.
https://www.diepresse.com/686329/ich-beginne-zu-glauben-dass-die-linke-recht-hat
(Anm.: Die damalige Linke ist m.E. nicht mehr vergleichbar mit der heutigen Linken, das sollte man im Hinterkopf behalten)
@so gesehen
„weil der Summe aller Ueberschuesse in diesem Binnenmarkt, Defizite in exakt gleicher Hoehe gegenueber stehen“ Ist das so oder ist das nur theoretisch so, also eine theoretische Ableitung der Binsenweisheit, dass „die Ausgaben des einen sind schließlich die Einnahmen eines anderen“ seien.
Und selbst, wenn dem so wäre, was bedeutet das denn? Bei Ihnen und denen, die ähnlich denken und sich mit denselben Sätzen umgeben, hört sich das so an, als wäre das eine unveränderbare Tatsache, quasi ein Naturgesetz. Was leiten Sie denn daraus ab? Wofür, für welche Entwicklung ist das wichtig? Was erklärt das?
Stets das Beispiel mir England und Portugal, wenn der komparative Vorteil erklärt werden soll. Machen wir es uns doch einfacher und nehmen das Gerät, das vor uns steht, ein PC üblicherweise. Er enthält Komponenten aus allen fünf Kontinenten und er hat eine wirklich sagenhafte Entwicklung hinter sich: seit über 40 Jahren wird er immer besser und leistungsfähiger und leichter und dabei noch billiger.
Um mal konkret zu werden: der komparative Nachteil ließe sich durchaus eindrucksvoll demonstrieren. Dazu müssten wir versuchen, den PC ausschließlich mit Teilen aus Deutschland zu fertigen. Wir kriegen schon einen hin, aber er ist deutlich teurer und schlechter als der vom Weltmarkt. Woran auch eine zehnjährige Aufholjagd nichts ändern würde. Gegen den Weltmarkt hast Du keine Chance.
Der Kapitalismus hat hier eine echte Schokoladenseite, die die meisten so wertvoll einschätzen, dass sie dessen Abschaffung nicht befürworten. Andererseits schafft das natürlich auch Abhängigkeiten: ein Abkoppeln vom Weltmarkt kommt fast einer Kriegserklärung gleich. Nennt sich Sanktionen und wird mit dieser Absicht eingesetzt.
Der komparative Vorteil ist aber nicht an den Kapitalismus gebunden, er existiert in grundsätzlich jeder Wirtschaftsform. Insofern ist die Globalisierung zu begrüßen und überhaupt fördert sie die Bereitschaft zur friedlichen Konfliktbeilegung. Die einstigen Globalisierer sind jetzt aber zu Protektionisten geworden. Hingegen jetzt sind die Chinesen die Globalisierer, die eine zweite, diesmal gerechtere Gestaltung des Weltmarkts anstreben. Baerbock kann mal wieder nicht anders, als Xi durch einen geschmacklosen ad-hominem Angriff zu brüskieren. Das wird Folgen haben.
Vielleicht ist das Thema inzwischen durch. Aber als Übung taugt es allemal, um sich mit den gängigen Irrtümern in der Deutung des Kapitalismus auseinander zu setzen. Vllt steigt ja der ein oder andere noch ein und es kommt zu neuen Erkenntnissen.
Das Grundproblem der derzeitigen intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Thema ist seine Theorielastigkeit, besser noch Theoriegetriebenheit. So sagt Kaczmarczyk selbst: „Gängiger Theorie dürfte es gar nicht so weit kommen, denn durch den Aufbau an Ersparnissen müsste der Zins eigentlich fallen und damit irgendwen wieder zum Investieren, also Geldausgeben, anregen“ Das sind die Theorien! Dumm nur, wenn die Wirklichkeit sich nicht nach der Theorie richtet. Die Antworten der Experten sind einfach: Die Wirklichkeit ist falsch! Denn unsere Theorien sind unfehlbar. Damit ist das Thema anscheinend erledigt.
Diese Haltung überlebt aber nur dank des Desinteresses im Rest der Gesellschaft und der Bedeutungslosigkeit der Erkenntnisse der sogenannten Wirtschaftswissenschaft selbst. Anders ausgedrückt: Was die sogenannten Wissenschaftler sich in ihren Elfenbeintürmen zusammen theoretisieren, interessiert letztlich kein SChwein – weder die Bevölkerung noch die Wirtschaft. Denn beide handeln nach ihren eigenen Interessen und Meinungen. Aber diese Theorien stiften Verwirrung.
Das führt dann zu Äußerungen wie: „die Ausgaben des einen sind schließlich die Einnahmen eines anderen“, was in dieser Allgemeinheit nicht falsch ist, aber gerade deshalb nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber damit wird auch etwas anderes noch unterschwellig mit ausgedrückt. Nach einigen intellektuellen Windungen in der Theoriebildung kommt es zu Äußerungen wie: „weil der Summe aller Überschüsse in diesem Binnenmarkt, Defizite in exakt gleicher Höhe gegenüber stehen“.
Meine Frage, ob diese Feststellung überhaupt stimmt, wurde vom Urheber dieser Aussage bisher weder bestätigt noch überhaupt aufgegriffen. Denn die Überschüsse einer nationalen Wirtschaft entstehen ja nicht nur aus dem Handel auf dem EU-Binnenmarkt. Ein sehr großer Anteil der dt. Überschüsse z.B. erfolgt aus dem Handel mit den USA und China, wobei im Handel mit China eine negative, mit den USA eine positive Handelsbilanz aufweisen kann. Wie will man all das auseinanderdividieren, um zu der Feststellung zu gelangen, dass die dt. Überschüsse den Defiziten anderer EU-Wirtschaften entspricht. Ich weiß nicht, ob diese Aussage durch Zahlen belegt werden kann. Zudem ist vollkommen unklar, was denn überhaupt mit dieser Behauptung ausgesagt werden soll. Was folgert aus dieser Aussage? Es kann doch auch ohne weiteres sein, dass jene EU-Staaten, die im EU-Binnenhandel Defizite aufweisen, im internationalen Handel Überschüsse erzielen. Bedeutet das, dass ein Land mit EU-Binnendefizit wirtschaftlich in Gefahr ist, obwohl es im Handeln mit anderen Ländern über Überschüsse verfügt, die die Defizite im EU-Handel nicht nur ausgleichen sondern gesamtwirtschaftlich sogar zu einem positiven Wirtschaftsergebnis führen?
Die Verwendung des Begriffs „Defizit“ ist nicht so neutral wie der Begriff „Ausgaben“, den Kaczmarczyk verwendete. Defizit bedeutet, dass die Ausgaben höher sind als die Einnahmen. Aber diese Sichtweisen der Null-Summen-Theorien spiegeln ein statisches Bild von Wirtschaft wider, wobei es doch kaum etwas Dynamischeres gibt in den Gesellschaften als die Wirtschaft. In der Wirtschaft geht es auf und ab. Nokia galt über Jahre als der Handyhersteller schlechthin. Innerhalb weniger Jahre verlor es diese beherrschende Stellung und ist heute auf dem Markt bedeutungslos, wohingegen Apple genau die entgegengesetzte Entwicklung genommen hat.
Wer aber die Einnahmen des einen als die Defizite des anderen darstellt, übersieht in seiner statischen Sichtweise, dass Defizite der Ausgangspunkt neuer strategischer Entwicklungen sein können. Das ist auch eine Frage der Sichtweisen. Eine Spirale aus den luftigen Höhen der Elfenbeintürme betrachtet erscheint als ein Kreis, der sich scheinbar endlos um die eigene Achse dreht. Aus den Niederungen des Alltag aber erkennt der Mensch, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dass sich dieser scheinbare Kreis immer weiter nach oben entwickelt. Wer Einnahmen und Ausgaben als Nullsummen-Spiel deutet, kann an Entwicklung nicht teilnehmen. Die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Das ist richtig, aber als Erkenntnis wertlos. Der Erkenntniswert ist gleichbedeutend der Feststellung, dass jeder Schimmel weiß ist. Die Ausgabe für eine neue Maschine ist die Einnahme des Maschinenbauers und gleichzeitig die Ausgabe eines Warenherstellers. Aber das Geld ist doch nicht futsch, wie das Nullsummenbild den Eindruck erweckt. Der Warenproduzent hat zwar fürs erste Geld verloren, schafft aber mit der neuen Maschine die Grundlage für weit höhere Einnahmen. Das bringt das statische Bild der Nullsummen aus dem Gleichgewicht. In einer Entwicklung wie der Wirtschaft gibt es keine Nullsummen. Das gibt es nur in den festgefahrenen Theorien sogenannter Wirtschaftswissenschaftler.