
Warum der Brand in Hong Kong ein globales Alarmsignal ist.
Der Brand im Hongkonger Wohnkomplex Wang Fuk Court ist kein lokales Unglück. Er ist ein Systembruch, ein Moment, in dem ein einzelnes Ereignis plötzlich sichtbar macht, wie zerbrechlich die urbane Zivilisation tatsächlich geworden ist. Dass ein Hochhaus in einer der modernsten Städte der Welt binnen Minuten zu einer brennenden Falle wurde, hat Ursachen, die weit über Asien hinausreichen. Die Katastrophe vom 26. November 2025 ist ein Spiegel für eine globalisierte Welt, die verdichtet, beschleunigt und ausgelagert hat und dabei aus dem Blick verlor, dass Menschen in diesen Gebäuden leben. Die Fakten sind eindeutig und stammen ausschließlich aus bestätigten Berichten: Reuters, The Guardian, Le Monde, SRF, HuffPost und weiteren internationalen Nachrichtenseiten.
2.000 Wohneinheiten, enge Flure, begrenzte Fluchtwege
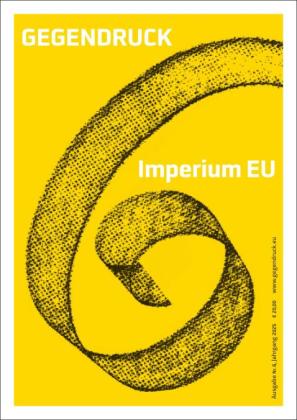
Mindestens 36 Menschen starben nach ersten Angaben, später wurden 44 Tote bestätigt, manche Medien sprechen bereits von über 50. Fast 300 gelten weiterhin als vermisst. Das Feuer breitete sich entlang der Fassade aus, die vollständig eingerüstet und mit brennbaren Schutznetzen verkleidet war, ein Konstruktionsfehler, der in Hong Kong seit Jahren bekannt ist. Experten beschrieben gegenüber Reuters die Bambusgerüste als „vertikale Brandleiter“, die das Feuer begünstigten. Was hier als Renovierungsmaßnahme begann, endete als tödlicher Katalysator. Die Katastrophe entsteht also nicht aus Chaos, sondern aus Normalität. Und genau das macht sie so gefährlich.
Wang Fuk Court ist keine Ausnahmeerscheinung. Es ist ein typischer Wohnkomplex eines dicht bebauten Megapol-Raumes. 1983 gebaut, rund 2.000 Wohneinheiten, enge Flure, begrenzte Fluchtwege. Laut mehreren Berichten leben hier vor allem Haushalte mit geringem Einkommen, Familien, Rentnerinnen, Arbeitsmigranten. Menschen, die keine Wahl haben. Solche Orte sind die Resultate einer jahrzehntelang beschleunigten Urbanisierung, in der Wohnraum nicht länger als Grundrecht, sondern als Marktprodukt organisiert ist. Man wohnt dort, wo es gerade noch bezahlbar ist, selbst wenn das bedeutet, auf einer Baustelle zu leben.
Die Baustelle war entscheidend. Die Fassade war eingerüstet, eingepackt, verdeckt. Diese Einhausungen, grüne Schutznetze, angebracht zur Sicherung von Baumaterial und zur Vermeidung von herabfallenden Gegenständen, sind in Hong Kong üblich. Sie sollen eigentlich schützen. Doch in Verbindung mit Bambus, der traditionell als günstiges und flexibles Gerüstmaterial verwendet wird, entsteht eine fatale Kombination. Bambus brennt. Die eng gewebten Kunststoffnetze brennen ebenfalls. Und wenn sie brennen, entsteht ein Kaminzug entlang der Fassade, der Flammen nach oben saugt wie ein Verbrennungsrohr.
Festnahmen: Ein symbolischer Akt
Dass man diese Konstruktion an einem bewohnten Hochhaus anbringt, wäre in Europa undenkbar, zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. Auch in deutschen, französischen oder britischen Städten werden Fassaden oft über Monate eingerüstet, eingehüllt und mit provisorischen Materialien versehen. Die Brandkatastrophe des Grenfell Towers 2017 war ebenfalls das Ergebnis einer schlecht gewählten Fassadenverkleidung. Damals versprach man eine europaweite Debatte über Brandschutz. Sie blieb aus. Der tai-po-Brand führt drastisch vor Augen, wie wenig man aus früheren Fehlern gelernt hat.
Die Behörden in Hong Kong reagierten spät und unkoordiniert. Laut The Guardian berichteten Angehörige, dass Informationen unpräzise und verspätet kamen. Viele erfuhren über soziale Netzwerke mehr über das Ausmaß der Katastrophe als über staatliche Stellen. In einem System, das Kommunikationskontrolle höher gewichtet als Transparenz, wird Information zur Mangelware. Dabei sind Informationen in einer Katastrophe Teil der öffentlichen Sicherheit. Wer nicht informiert, verhindert nicht Panik, er verhindert Aufklärung.
Die Polizei nahm drei Personen fest, die für die Fassadenarbeiten verantwortlich gewesen sein sollen. Ein symbolischer Akt. Die wahren Fehler liegen nicht bei ein paar Arbeitern, sondern im gesamten Regelwerk einer Stadt, die ihre eigenen Risiken verinnerlicht hat, ohne sie zu adressieren. Hong Kong lebt seit Jahren in einem Zustand permanenter Renovierung. Viele Gebäude stammen aus den 1970er und 1980er Jahren und befinden sich in einem strukturellen Verfall, der nur durch ständige Fassaden- und Innenbauarbeiten stabilisiert wird. Doch anstelle eines umfassenden Sanierungsprogramms setzt die Stadt auf punktuelle Eingriffe, oft vergeben an Subunternehmen, die unter Kostendruck stehen.
Bekannte Ursachen
Diese Situation ist kein asiatisches Phänomen. Es ist ein globales Muster: Privatwirtschaftliche Logik im Wohnungsbau, staatliche Überforderung bei der Kontrolle, Sparzwang in der Verwaltung, Fragmentierung der Verantwortung. Austragungsort: die Stadt. Opfer: Menschen, die sich die Lage nicht aussuchen können.
Zwar darf man die Verantwortlichkeit nicht mit europäischer Überheblichkeit betrachten, aber man sollte sich nichts vormachen: Großstädte in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien sind strukturell kaum stabiler. Berlin hat ganze Wohnblocks, die seit Jahren untergerüstet sind. Paris hat marode Banlieues, deren Instandhaltung seit Jahrzehnten vernachlässigt wird. In Hamburg-St. Georg, in Köln-Chorweiler, in Marseille oder Neapel sind Fassadenarbeiten ähnlich chaotisch organisiert wie in Tai Po.
Der Unterschied liegt weniger im Material als im politischen Willen zur Kontrolle. Und dieser Wille fehlt weltweit.
Die Ursachen dafür sind bekannt:
Städte wachsen schneller, als Staaten sie verstehen.
Wohnraum wird teurer, also wird überall gespart.
Kontrollen sind komplex, deshalb delegiert man sie an private Firmen.
Die Menschen, die in riskanten Gebäuden leben, haben keine Lobby.
Das Ergebnis ist eine stille Normalisierung von Gefahr.
Doch der Tai-Po-Brand macht etwas sichtbar, das in urbanen Gesellschaften oft übersehen wird: Gefahr verteilt sich sozial. Wer arm ist, stirbt zuerst. Nicht, weil Armut brennt, sondern weil schlechte Wohnungen brennen.
Bauen wir Städte für Menschen oder für Märkte?
Dieser Zusammenhang ist keine Polemik, sondern empirisch belegt. Bei den Opfern des Grenfell Towers lag der Anteil von Migrantenfamilien bei über 80 Prozent. Bei Tai-Po sind es überwiegend Einkommensschwache. Wer am Rande der Stadt wohnt, wohnt oft auch am Rand staatlicher Aufmerksamkeit.
Der Brand zeigt auch, wie eng technische, soziale und politische Risiken heute miteinander verflochten sind. Ein Fassadennetz ist kein politisches Thema, bis es eines wird. Ein Bambusgerüst ist keine soziale Frage, bis es Menschen den Fluchtweg abschneidet. Und eine Renovierungsfirma ist kein Symbol für systemische Instabilität, bis ein Feuer beweist, wie dünn die Grenze zwischen Alltag und Katastrophe ist.
Es ist eine Ironie unserer Zeit, dass wir in einer Welt leben, die in Echtzeit miteinander verbunden ist, aber deren grundlegende Sicherheitsfragen aus dem Blick geraten sind. Man kann heute in Sekundenschnelle Informationen aus Hong Kong abrufen, doch dieselben Staaten schaffen es nicht, verbindliche Standards für Fassadenmaterial festzulegen. Man kann Städte digital modellieren, aber keine transparente Kontrollstruktur durchsetzen. Man kann die größten Datenmengen der Welt verarbeiten, aber hat keine Antworten auf die einfachste Frage: Wie verhindern wir, dass Menschen in ihren Wohnungen sterben?
Der Tai-Po-Brand sollte deshalb mehr sein als ein tragischer Nachrichtenabschnitt. Er sollte Anlass sein zu einer ehrlichen Diskussion darüber, wie wir Urbanisierung verstehen. Bauen wir Städte für Menschen oder für Märkte? Für Lebensqualität oder für Rendite? Für Sicherheit oder für Geschwindigkeit? Diese Fragen klingen abstrakt, aber sie entscheiden, ob die nächste Katastrophe verhindert wird oder nicht.
Es gibt eine weitere Dimension, die oft unterschätzt wird: die psychologische. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn die Orte des Alltags, die Wohnungen, die Flure, die Fassaden, potenzielle Gefahrenorte werden? Was bedeutet es, wenn Menschen in dem Gefühl leben, dass die Stadt nicht sie schützt, sondern sie überwacht oder verwaltet, aber nicht mehr stabil hält? Die Antwort lautet: Es entsteht ein Klima der Entfremdung. Menschen verlieren das Vertrauen in die bauliche, soziale und politische Umgebung, in der sie leben.
Was ist nötig, damit eine Katastrophe wie diese nicht wieder geschieht?
Hong Kong ist in dieser Hinsicht ein extremer Fall. Doch die strukturelle Ähnlichkeit zu anderen Städten ist unübersehbar. Auch in Deutschland fühlen sich viele Menschen von politischen und wirtschaftlichen Akteuren im Stich gelassen, wenn es um Wohnraum geht. Überteuerte Mieten, schlecht sanierte Gebäude, unendliche Bauverzögerungen, all das ist Teil einer urbanen Realität, die sich langsam gegen ihre Bewohner richtet.
Was wäre also nötig, damit eine Katastrophe wie die in Tai Po nicht wieder geschieht?
Zunächst braucht es verbindliche internationale Standards für Renovierungsarbeiten an bewohnten Gebäuden. Kein Land sollte erlauben, dass brennbare Einhausungen monatelang an bewohnten Fassaden hängen. Es braucht klare Haftungsregeln und strenge Kontrollen, die nicht an Subunternehmen ausgelagert werden dürfen. Städte müssen ihre eigenen Risiken kennen und sie aktiv adressieren und nicht erst handeln, wenn das Feuer bereits sichtbar ist.
Zweitens muss Wohnraum wieder als öffentliche Verantwortung begriffen werden. Der Tai-Po-Brand zeigt exemplarisch, was geschieht, wenn staatliche Kontrolle schwindet und Marktlogik dominiert. Privatisierung allein schafft keine Sicherheit. Im Gegenteil: Sie erzeugt Anreize, Risiken zu verbergen und Kosten zu externalisieren. Eine sozial verantwortliche Stadtpolitik erkennt, dass Wohnraum mehr ist als ein Wirtschaftsgut.
Drittens braucht es Transparenz. Katastrophenschutz beginnt mit offener Kommunikation. Wer Informationen zurückhält, gefährdet nicht nur Menschen, er zerstört Vertrauen. Die Behörden Hong Kongs haben diese Lektion nicht verstanden. Europa sollte sie verstehen.
Man kann diesen Brand als Tragödie begreifen. Man kann ihn aber auch als Lehre begreifen. Als Mahnung, dass moderne Städte technisch beeindruckend, aber politisch unterreguliert sind. Als Warnsignal, dass Sicherheit nicht automatisch entsteht, sondern erkämpft werden muss. Und als Zeichen dafür, dass der Mensch in der Stadt heute weniger geschützt ist, als es die Fassaden vermuten lassen.
Tai Po war nicht die Ausnahme. Es war der Hinweis. Die Frage ist, ob wir ihn hören wollen.
Quellen
Reuters – Fire engulfs residential building Hong Kong, 36 dead, 279 missing
https://www.reuters.com/world/china/fire-engulfs-residential-building-hong-kong-2025-11-26/
The Guardian – Death toll in Hong Kong tower block fire rises to 44
https://www.theguardian.com/world/2025/nov/26/hong-kong-fire-tai-po-towers
Le Monde – Deadly Hong Kong fire kills at least 55 amid concern over renovation safety
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/11/27/deadly-hong-kong-fire-kills-at-least-55-amid-growing-concern-over-renovation-safety_6747876_4.html
SRF – 36 Tote, 279 Vermisste bei Brand in Hongkong – drei Festnahmen
https://www.srf.ch/news/international/wohnanlage-in-flammen-hongkong-36-tote-und-279-vermisste-bei-brand-in-hochhauskomplex
HuffPost ES – Al menos 36 muertos y 279 desaparecidos…
https://www.huffingtonpost.es/global/al-36-muertos-279-desaparecidos-que-incendio-complejo-rascacielos-hong-kong.html




@Burbach
Waren Sie schon mal in Hongkong? Haben Sie die vorsintflutlichen Baugerüste aus Bambus dort mal gesehen? Und das in einer modernen Stadt, die den unregulierten Kapitalismus huldigt und deshalb von den Medien hier als letzter Hort westlicher Freiheit gesehen wird
In der Volksrepublik sind solche Baugerüste verboten, Stahlgerüste zwingend vorgeschrieben. Aber dort herrscht bekanntlich die extreme Unfreiheit
Korruption gibt es auch in der Volksrepublik. Aber dagegen geht Präsident Xi streng vor, was ihn bei den Chinesen beliebt gemacht hat. Die regulierte Marktwirtschaft der Volksrepublik ist reguliert, nicht frei und deshalb wäre ein solcher Großbrand dort wahrscheinlich nicht möglich gewesen
Naomi
Selten so ein Schieß gelesen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesischer_Milchskandal
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionskatastrophe_von_Kunshan_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosionskatastrophe_von_Tianjin_2015
Zuviel Falun Ding Dong auf der dunklen Rückseite der Epoch Times
Zehn Jahre alte Infos. Vor zehn Jahren sah China nach ganz anders aus
Aber Fakt ist, Bambusgerüste sind in der Volksrepublik verboten und das ist gut so. Diesen Fakt können sie nicht wegreden
Die Zukunft von Hamastan-Stadt (The Line) im Gazastreifen https://de.wikipedia.org/wiki/Kowloon_Walled_City
Hongkong ist aber nicht die VR China und ob das auf dem Festland immer so eingehalten wird, ist auch fraglich. Gesetzespapier ist geduldig. Und davon ab halten korrekt aufgebaute Bambusgerüste auch so gut wie Stahlrohre und sind dabei leichter. Nachteil ist der erhöhte Wartungauafwand, weil man die Bambusstangen öftet kontrollieren muss auf Schäden einfach weil es letztlich Gras ist. Und das kann verrotten oder feucht werden. Pandabären die den Bambus anknabbern gibt es Hongkong ja nicht. 😉
Aber wenn natürlich billig billig billig alles geschalmpt wird, bricht auch so ein Bambusgerüst zusammen. Stahlgerüste rosten aber auch weg. Hongkong liegt schließlich in einer Meeresbucht mit Salzluft.
Also in der Volksrepublik hab ich noch nie ein Baugerüst aus Bambus gesehen und war überrascht das es sowas altmodisches in Hongkong noch gibt. Aber da herrscht ja die Logik des freien, unkontrollierten Marktes. Die Hongkonger Stadtregierung ist jetzt unter Druck. Die Mieten in Hongkong sind fast unbezahlbar geworden und das war einer der Gründe für die Proteste 2019. Hier reden Leute vom Schreibtisch aus über Dinge von denen sie keine Ahnung haben. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Ist wieder Zeit für Chinabashing was…
„Bamboo scaffolding is treasured as an important part of the local heritage, and is something that distinguishes Hong Kong from mainland China, where steel scaffolds are widely used in construction.“https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/27/hong-kong-fire-arrests-dead-killed-hundreds-missing-housing-complex-blaze
Eine liebgewonnene Tradition, oder diskrete Einflussnahme, um die billigste Lösung zu erhalten.
Möglichst billig, um höhere Gewinne zu erzielen, geschieht überall, wo es keine Kontrolle gibt.
Deshalb will die Bundesregierung ja auch die Prüfabteilung beim Bundesrechnungshof einsparen.
Keine Kontrolle, keine Verschwendung, keine Korruption.
Die chinesische Regierung ist an Stabilität interessiert, deshalb bekämpft sie die Korruption, die das Vertrauen zerstört. Vielleicht könnte man ja was von China lernen?
It’s not a bug, it’s a feature. Wenn das Problem noch nützlich sein könnte, warum was dran ändern? DAS ist die Einstellung unserer „Eliten“. Es findet sich sicher wer, der da irgendwelche Argumente mit „Sicherheit“ (=Überwachung) oder „der Markt“ (=Profite für Superreiche) vorlesen kann.
Kritik ist gesichert rechtsgedehnt – erleben sie die Fäulnis eines Systems, das kein Interesse an der Realität hat. Treten Sie zur Seite, damit sie beim Fall des Systems nicht noch ein paar Trümmer abbekommen, der Countdown läuft.
Mir fehlt ein wenig der Glaube, dass hier wirklich das Bambus-Gerüst den Ausschlag gab. Brennbare Netze schon eher. Aber in den Nachrichten war gestern auch von Dämmmaterial am Haus die Rede, das brennbar sei. Das wäre dann der gleiche Effekt, wie beim Grenfell-Tower in London. Wobei dort die Aluminium-Verkleidung (!!!!!) der enorme Brandbeschleuniger war.
Bei solchen Bränden kommt vieles zusammen.
Aber Honkgong leidet unter den systematischen Fehler des unregulierten Kapitalismus, den es so in der Volksrepublik nicht gibt. Das sind harte Fakten
So schade, dass sie ihre China-Begeisterung nicht auf der staatlichen Überwachungsplattform WeChat mit chinesischen Konformisten teilen können. Sie hätten so viele neue Freunde.
Es geht um Fakten und nicht um ihr hier permanent zur Schau gestelltes China-Bashing und peinliches Schubladendenken.
Wenn Sie nichts sachliches beitragen können, sparen Sie sich doch einfach die Zeit zu posten. Das ist für alle angenehmer und steigert die Forumqualität.
👍
Ich kenne WeChat, kann das System aber wegen nicht vorhandener Grundkenntnisse chinesischer Schriftzeichen nicht bedienen. Auf WChat, das berichten übereinstimmend viele Chinesen, gibt es täglich ziemlich viele kritische Äußerungen. Im Extremfall werden einige Posts gelöscht, was ja der freie Westen auch will und macht. Eine KI liest mit und informiert wahrscheinlich die Regierung/Behörden. Ist der Unmut zu groß, stellt die Regierung das Problem ab. Das würde ich mir auch hierzulande wünschen. Hierzulande ist es doch scheißegal was du sagst, online oder auf politischen Versammlungen, denn unsere „demokratisch“gewählte Volksvertreter/Regierung macht doch was sie wollen
In Hongkong wird demnächst eine neue Stadtregierung gewählt aber unsere Tagesschauexperten wissen schon im Voraus, das diese selbstverständlich nicht demokratisch sind. Demokratisch ist nur, was der Westen macht
Ja es ist ja auch UnSEre DemoKRtiE™!!
Dachte ich mir auch. So schnell brennt Bambus nämlich gar nicht. Abgesehen davon und @chinabegeisterte Naomi: wie viele Hochhausbrände der letzten 50 Jahre waren auf Bambus zurückzuführen?
Logisch im Westen werden Bambusgerüste nicht benutzt
Weltweit natürlich.
Bambusgerüste sind bei Hochhäusern eigentlich besser als Stahlgerüste. Vor allem
in Gegenden mit plötzlichen heftigen Wetterumschwüngen. Sie sind flexibel und ziehen
keine Blitze an. Und sie sind sehr leicht. Die Frage ist, wie oft kommt es zu schweren Unfällen
mit Bambus und mit Stahlgerüsten. Ich habe in den Jahren als Techniker in der Hausverwaltung
viele Fassadensanierungen durchführen lassen. Ich habe mit Gerüstbauern „meines Vertrauens“
zusammengearbeitet. Es gab aber immer wieder Eigentümer, die Fremdunternehmen beauftragten
um ein paar Euro zu sparen oder weil die Firmenchefs mit ihnen befreundet waren. Mir blieb dann
auch ein paar Male nichts Anderes übrig, als das Amt für Arbeitschutz oder die Berufsgenossen-
schaft zu informieren, weil die Gerüste so schlecht waren. Ich vermute, dass in Honkong der Brand
eher von den Materialien beschleunigt wurde, die in der Fassade verbaut waren. Auch die Konstruktion
der Fensterausschnitte scheint keine feuerhemmenden Materialien und keine Brandsperre zu haben.
Mein weiß auch nicht, was auf dem Gerüst gelagert wurde. Oft lagern sogar die Mieter Hausrat
darauf. Dieser Brand ist eine sehr böse Sache. Aber ich denke man sollte auch bedenken wie oft
so etwas vorkommt. Da halte ich etwas wie die Corona Pimpfung mit den Millonen Toten für weitaus
schlimmer und vermeidbarer.
„Mir fehlt ein wenig der Glaube, dass hier wirklich das Bambus-Gerüst den Ausschlag gab. Brennbare Netze schon eher. “
Ja, geht mir genauso. Erinnere mich gerade, ein post-event-Video gesehen zu haben, wo die geschwärzten Bambusgerüste strukturell völlig intakt zu sehen waren und dazwischen hängende Reste und Fetzen der Sicherheitsnetze. Wurde auch erwähnt, daß Bambus nur schwer entflammbar ist (aber dann gut brennt).
Ein Video des Brandes selbst zeigt eine über die gesamte Höhe der Fassade laufende Feuersäule in einer Hausecke, die durch den Kamineffekt entstanden ist. Da war möglicherweise Fassadenmaterial in Brand geraten.
Elberadler
„Mir fehlt ein wenig der Glaube, dass hier wirklich das Bambus-Gerüst den Ausschlag gab.“
Mir auch.
In der Sicherheit gibt’s den Merksatz!
„Unfälle passieren nicht, sondern sie werden gemacht“
Ganz einfach eigentlich
Stings 60 Mio- Wohnung im 15. und 16. Stock besteht aus zwei Stockwerken mit Panorama-Aussicht über den Central Park und keiner schreibt, wie gut die brennen könnte. Oder ist es da besser?
@ Blinkfeuer : endlich ein die Debatte öffnender Beitrag ! !!!!!!!!!!
Na ja.
Ja, aber erstens müsste das nicht so sein, die Mieten wären viel niedriger, wenn wir keine unbegrenzte Zuwanderung hätten, aber gerade die Linken können ja nicht genug Menschen geschenkt bekommen.
Und ausgerechnet Hongkong mit Deutschland zu vergleichen, ist irgendwie daneben. Ein Grund für Bauverzögerung und hohe Kosten sind überbordende bürokratische Vorschriften, wie viel darfs denn noch sein…?
Ja, warum nicht gleich das globalistische Rad drehen, es gibt keinerlei Grund, weshalb das nicht jedes Land selbst beschließen kann. Internationale Regeln sind undemokratisch und es braucht i.d.R. Jahrzehnte, bis man sich drauf geeinigt hat und die Kontrolle muss am Ende ja doch national erfolgen (und wenn sie es nicht tut, sind die Regeln für die Katz).
Ich plädiere für intelligente Politiker, aber woher nehmen und nicht stehlen?
Ich wüsste nicht, dass wir in Deutschland da ein Problem haben. Aber klar, wir können auch alles mit Steuergeldern bauen, dann dauerts halt dreimal so lange und wird so verpfuscht, wie der BER. Der Staat besteht aus bräsigen Behördenmitarbeitern, die Dienst nach Vorschrift machen und oft kaum Ahnung von der Materie haben.
Ja, offene Kommunikation und Transparenz, wer sollte da dagegen sein?
Deutsche Städte sind weit überwiegend weder unterreguliert (im Gegenteil!) noch modern oder beeindruckend. Die Zeiten sind lange vorbei! Wir sind längst nicht mehr Speerspitze…
„ ch wüsste nicht, dass wir in Deutschland da ein Problem haben. Aber klar, wir können auch alles mit Steuergeldern bauen, dann dauerts halt dreimal so lange und wird so verpfuscht, wie der BER. Der Staat besteht aus bräsigen Behördenmitarbeitern, die Dienst nach Vorschrift machen und oft kaum Ahnung von der Materie haben.“
Nur zu ihrer Information, 95 % der Bauvorhaben der öffentlichen Hand werden an private Unternehmen vergeben. Von der Planung bis zur Durchführung! Also irgendwie scheint ihre Argumentation zu hinken. Und im Gegensatz zur Privatindustrie sind Bund, Land und Kommunen zwingend an die HOAI und Vergaberichtlinien gebunden, die die Politik verabschiedet. Wenn Sie dann noch die sich ständig ändernden Anforderungen der Beteiligten und Gesetzesänderungen beachten müssen, die viele Private einfach mit einem kleinen Bußgeld übergehen, müssten Sie mal erklären, wer es besser kann.
„Bauen wir Städte für Menschen oder für Märkte?“
Das dürfte einfach zu beantworten sein, die Bedürfnisse der Menschen sind lediglich das Vehikel, mit dem die Märkte bedient werden. Kann in der Warenproduktionsgesellschaft nicht anders sein und der Widerspruch kann innerhalb derer nicht gelöst werden. Der Wert bestimmt die Produktionsverhältnisse, ist deren erstes und alle anderen Verhältnisse bestimmendes.
In der Fragestellung ist leise implementiert, dass der Mensch anders handeln könnte, wenn er wollte.
Denkste!
Um von einem systemischen Versagen sprechen zu können sollte man mal den Vergleich ziehen.
Wie viele Menschen leben in Hochhäusern? Wie viele Menschen fallen Bränden in Hochhäusern zum Opfer?
Wie viele Menschen leben in niedriger Bebauung und fallen dort Bränden zum Opfer?
Wenn es da eine signifikante Abweichung gibt, kann man und muss man sich das System anschauen. Kann mir nicht vorstellen, dass sich der Herr Burbach diese Recherche angetan hat.
Bei solchen Unfällen gilt das gleiche wie bei Flugzeugkatastrophen. Sie sind spektakulär, weil bei den wenigen Ereignisse immer hohe Opferzahlen zu beklagen sind. Tatsächlich sind die Flugreisen, eine der sichersten Reiseformen.
Die x Unfälle mit Kfz und y Todesopfer die sich daraus ergeben, sind aber keine Schlagzeile wert obwohl sie in der Summe mehr Opfer fordern.
Denke mal, dass sich hier ein systemisches Versagen im Forum herausgestellt hat, sich direkt auf den Bambus o.ä. als Übeltäter zu stürzen, statt den Artikel kritisch anzusehen. Naja, der Journalist will eben auch leben.
Ottono, da stimme ich Ihnen doch glatt einmal zu!
Wer hätte das gedacht, es geschehen also doch Wunder auf dieser Welt. 😂
Aber jetzt nicht übermütig werden!
in Deutschland sieht es nicht anders aus ….
Da müssen nun 2 Brandmelder in Wohnungen von 36m² zu finden sein, aber Abluftanlage in solchen Wohnsilos , gehen nicht, nun dann gehen Sie halt nicht . 2 Melder dieser Art in solch kleinen Wohnfläche, ergibt keinerlei Sinn
Diese Teile am den Decken von Zimmern, man fühlt sich wie in einer Gefängnisszelle überwacht..
Es gibt auch da Systeme die weniger auffällig sind, aber an denen verdient man wohl nicht genug, denn es ist Miete zu zahlen für diese teile .
Ich wüsste nicht das jemand DDR Zeiten in den Teilen verbrannt ist, aber ich wüsste einige die an kruden Balkontüren Bodenabschlüssen zu Fall gekommen sind nach der Wende, und an den Folgen dann starben . Interessiert aber niemand.
Nicht eine Betonplatte hier im Osten Wärmegedämmt, aber CO2 Abgaben nun, wovon der Vermieter aber fast gar nichts tragen muss.
Es geht schon lange nicht mehr um Mieter, überall das gleiche , nur in Wohnsilos dieser Art sind die Folgen eben viel schlimmer ..
Übrigens Bambus brennt schnell, aber verbrennt auch schnell . Bei diesen Bränden hier muss auch einiges andere nicht gestimmt haben. Die Schutznetze sind wohl schon eher ein Problem, aber auch das erklärt mir nicht vollständig diese Feuersäulen die man sehen konnte in diesem Gebäuden . DIe Abluftanlage würde mich interessieren, denn mein EIndruck, diese Feuer wurden direkt in die Gebäude gesaugt, und dann sterben viele nicht an Feuern dieser Art, sondern Rauchvergiftungen als Begleiterscheinung solcher Brände. In solchen Fällen können Luftströme dieser Art für das Gegenteil von Brandschutz stehen . Diese müssten umkehrbar sein im Brandfall, aber das sind Sie nicht, zu teuer solch Technik.
Ein Brandermittler erzählte mir einmal, dass die meisten Todesopfer bei Bränden
an einer Rauchvergiftung sterben. Zur Todesfalle wird oft eine abgeschlossenen
Haus- oder Wohnungstür. Auch wen der Schlüssel steckt, bis man ihn im Qualm
findet und dann oft auch noch 2 Mal umdrehen muß, hat man den 2. Athemzug getan,
der zur Bewußtlosigkeit führt. Er hatte einmal in einem 4 Familienhaus 3 Erwachsene
und 2 Kinder innen vor der Haustür gefunden. Alle tot. Die Tür war immer noch abgeschlossen!
Obwohl es einfache Tricks gibt..Harnstoffe zb binden Gase eine bestimmte Zeit relativ gut ..
Haben Russen im W2k gemacht, wenn Sie in eine mobile Vergassunganlage gesteckt wurden, die waren ja als normale Busse getarnt. Das haben echt einige damit überlebt …
Am Ende, Handtuch oder was anderes , Nass machen und dann um den Kopf. Damit hält man ein Stück länger durch .
Ich habe das mal Fabrik Halle erlebt, Gefängniss Karl Marx Stadt damals, MZ Werk hatte die da, Gefangene musste die ganze Drecksarbeit machen, Aluminium Schleiferei Staubexplosion . Die Absaugung mit Kessel hat es da zerlegt. Zum Glück stand da niemand in der Nähe des Großen Kessels, Ich war so 15 meter entfernt. War halt dann nur 1 -2 Stunden schwerhörig .. o)))
Ein typischer Burbach Artikel. Kritische Plattitüden im atemlosen Stakkato, kurz an einander getackert. Empörungsjournalismus. Systemkritisch? Nicht wirklich.
So ist es. Sie nehmen mir die Arbeit ab – have a nice weekend.
Gleichfalls. Schönes Wochenende!
In London gab es keine Bambusgerüste.
Da waren es wie fast überall, ungeeignete und nicht zugelassene Dämmungen.
Ein mir bekannter Dachdecker hatte auch mal einen Brand auf einer Baustelle ausgelöst und war unschuldig.
Das wurde dann auch vor Gericht bestätigt. Das Brandgutachten war eindeutig.
Der Grund für den Brand, die Fassadendämmung war falsch ausgeführt und es wurden falsche Materialien verwendet, was natürlich nicht dokumentiert war.
Solche gefährliche Schlamperrei gibt hier auch und das nicht mal selten.
Der CO2 Wahn hat bei der Fassadendämmung mit Polestyrol katastrophale
Blüten geschlagen. Bis zu 25cm Dämmung wurde verklebt. Wieviel davon
noch entflammbares Material ist und wie oft bei den brandhemmenden Teilen
im Bereich der Fenster und der Deckenübergänge geschlampt wurde, ist hinter
dem Putz oder den Riemchen heute nicht mehr zuerkennen. Die Ideotie des Ganzen
ist dann auch noch, dass durch die Wände nur ca. 12% der Enegie verloren geht,
durch das Dach aber 82%. Und gerade die Dächer der Bestandsbauten werden
auch heute noch nicht entsprechend gedämmt, während alles auf die Fassade
geklatscht wurde.
„“Bauen wir Städte für Menschen oder für Märkte““?
**Leben wir Menschen zur Freude oder für Märkte?**
Das passiert aus dem gleichen Grund, warum bei Boeing auch die Türen wegfliegen „“KAPITALISMUS““!
Weil die Firmen unter Konkurrenzdruck stehen alles billig billig machen müssen während sich ihre Bosse die Knete einverleiben.
Mal ganz davon abgesehen das „Großstädte“ eigens dafür geschaffen wurden um den Lohnarbeiter näher an die Produktionsstätten zu bringen.
Tschernobyl
Tschernobyl passierte in einer Zeit der Konkurrenz zweier Systeme, die der damaligen Sowjetunion alles abverlangte.
Die mussten nämlich so einiges billig billig bauen, einfach weil sie ansonsten dem Kapitalismus gegenüber nicht konkurrenzfähig waren.
Allerdings sind sie bei der Bewältigung des Unglücks, nach der Üblichen Verschleyerungstaktik in der Anfangsphase, vergleichsweise fast heroisch umgegangen.
Schaut euch unbedingt die 6teilige Serie “ Tschernobyl “ dazu an …nur zu empfehlen.
DEN Kapitalismus für alles verantwortlich zu machen, ist albern.
14. August 1972
Veralbern kann ich mich selber. 😉
Und gut überlegen, was du schreibst: Mein nächstes Beispiel ist der 5.September 1666!
War am 30.11.1984 nicht der Wüstenrot Tag……..
Ist also erst morgen 😉
Hab ich ja gar nicht, aber es ist signifikant, das mit abnehmender Erreichung des Mehrwehrts zunehmend die Qualität der im Kapitalismus produzierten Gütern abnimmt.
Bezüglich Informationen hat die South China Morning Post massiv berichtet, es gab fast nur noch Artikel, die sich mit dem Feuer beschäftigten. Man konnte sich also auch ohne Unsocial Media informieren. Und Behörden, naja, das kennt man aus vielen, vielen Ländern. Unkoordiniert, zu langsam, Ahrtal, war da was?
Wie heute die Stadtregierung der Sonderverwaltungszone Hongkong mitteilt, erhält jeder von der Brandkatastrophe betroffene Haushalt 60.000 Hongkong Dollar. 1 Euro entsprechen ca. 8,5 Hongkong Dollar. Alle Betroffenen seien kostenlos in Notunterkünften untergebracht. Der Bauunternehmer, der Rennovierungsarbeiten an den Hochhäusern durchführte, sei vorbestraft und in Skandale verwickelt gewesen. Mehrere Männer seinen festgenommen worden. Die Polizei der Sonderverwaltungszone ermittelt.
Die Zentralregierung in Beijing mischt sich nicht in die inneren Angelegenheiten der Sonderverwaltungszone ein. Präsident Xi hat den Opfern sein Beileid ausgesprochen.
https://www.globaltimes.cn/page/202511/1349329.shtml
Vom humanitären Gesichtspunkt her ist das ganze nur ein totales Desaster. Da sind viele Menschen einfach verbrannt, erstickt, vielleicht aus dem dem Fenster in den Tod gesprungen, um nicht zu verbrennen.
Was diese Baugerüste aus Bambus anbelangt: Im Prinzip ist Bambus in Asien da schon das geeignete Material, weil sehr viel leichter als Stahl oder gar Aluminium, sehr viel preisgünstiger, ein üppig nachwachsender Rohstoff aber eben auch extrem brennbar und hitzeempfindlich. Wer das ausprobieren möchte, besorge sich vielleicht einmal Bambusrohr im Gartencenter, sofern erhältlich, und lege davon eine geschlossene Lamelle in den Backofen. Irgendwann detoniert das einfach unter deutlicher Geräuschentwicklung. Solch gewaltige Gebäude ohne Brandschutzkonzept damit einzurüsten und zu allem Überfluss mit hochentflammbaren Kunststoffnetzen zu bekleiden, ist technisch betrachtet keine geistige Meisterleistung aber das billigste Verfahren, das der Markt hergibt.
Früher hatten die Bauarbeiter oft gar keine Baugerüste sondern nur Leitern. Ich kann mich lebhaft an einen Arbeitgeber erinnern, dem Baugerüste offenbar grundsätzlich zu teuer erschienen. Das Wohlbefinden ihrer Arbeitskräfte war denen regelmäßig so was von egal, dass der Hahn drauf scheißt. Insofern ist das jetzt in Asien auch kein Alleinstellungsmerkmal. Irgendwer, der trotzdem noch den genialen Gerüstbauer gibt, findet sich immer. Die Netze sollen verhindern, dass irgendwelcher Schutt auf die Straße kracht, aber sie verhindern nicht, dass dir irgendwelcher Schutt die Hand zerschmettert, wenn über dir jemand Scheiße baut.
Diese Gerüstbauer sind auch oft eher nervöse Menschen, die von einem Tag in den anderen leben. Eine falsche Bewegung, und sie sind tot. Das unterscheidet sie wesentlich vom Rest der Menschheit.
Vielleicht sollten Sie mal zugucken, wie in Homgkong solche Gerüste gebaut werden! Für uns Europäer und für mich mit Höhenangst unvorstellbar! Aber ein Erlebnis sondergleichen! Schade, dass man hier keine Bilder posten kann.
Die Arbeiter wissen genau was sie tun. Aber wie so oft wissen die Deutschen es besser.
Hier kann man sich das angucken:
https://m.youtube.com/watch?v=BSIqpsZHcSw
„Hongkongs Bambusakrobaten“
„Warum der Brand in Hong Kong ein globales Alarmsignal ist“: Nach 24 Stunden Brand stehen die Dinger da immer noch verkohlt und nutzlos herum.
Gebäude 7 in New York 9/11/2001 hatte nach nur 7 Stunden Feuerchen brav den Löffel abgegeben und ist filmreif auf den eigenen Grundriss eingesunken. Mitsamt Finanz-Asservatenkammer, den Akten über den ENRON Betrug und andere unangenehme Beweise…
So geht Abriss.