
Haben Sie es bemerkt? Weitab vom Getöse der weltweiten Chaospolitik, wurde in einem kleinen Land an der Westküste Südamerikas, in Ecuador, gewählt. Den Medien hierzulande war das Ergebnis immerhin ein paar Zeilen wert. Mehr aber auch nicht. Und doch hält der kleine Andenstaat der Welt einen Spiegel vor; einen Spiegel, in dem sich das große Bild zeigt: eine geopolitische Landkarte im Mikrokosmos.
16 Kandidaten standen am Wahlsonntag zur Verfügung. In Ecuador kann sich jeder, der das notwendige Kleingeld und das dazugehörige Selbstbewusstsein besitzt, zum Kandidaten küren. So treten dann die Schlangenölverkäufer, die selbst ernannten Propheten, die Gaukler, Scharlatane und Wahrsager an. Ihre Programme reichen von der Wiedereinführung der Todesstrafe über alchimistische Wirtschaftskonzepte bis hin zu waghalsigen Infrastrukturentwürfen. Lokale Wahlkämpfe finden statt. Megafone scheppern bei Umzügen in Dörfern, bunte Bilder und Videos in den sozialen Medien. Von T-Shirts, Hauswänden und Laternenmasten lächeln sie, werben um die Gunst des Volkes, welches sie regieren möchten. Am Sonntag, dem 9. Februar, sollen nicht nur Präsident und Vizepräsident neu bestellt werden, sondern auch 151 Abgeordnete und fünf Andenparlamentarier zur Wahl stehen. Kein leichtes Unterfangen für die Stimmberechtigten. Wer soll sich in diesem Wust von Namen, Listen, Parteien und Ämtern zurechtfinden? Was für gestandene Politologen bereits eine Herausforderung ist, ist für den einfachen Bürger ein Labyrinth von Farben und Zahlen.
Doch man unterschätze den Wähler nicht. Radikal trennt er die Spreu vom Weizen. Ohne viel Federlesens werden die Krakeeler von der Bildfläche gewischt und übrig bleiben die beiden großen Kontrahenten des Ringens um die politische Zukunft des Landes. Nach dem ersten Durchlauf durch den Willen des Souveräns bleiben nur die zwei wichtigsten Protagonisten im Rennen. Die beiden Präsidentschaftskandidaten: Luisa González, 43,83 % und Daniel Noboa, 44,31 %.
Er liegt gerade mal eine Nasenhaarlänge vor seiner Rivalin. Ein Resultat, welches bei einer Nachzählung der Stimmen unschwer umkippen könnte.
Das Ziel, ein absolutes Mehr der Stimmen einzuheimsen, wurde nicht erreicht. Also kommt es zur Stichwahl. Aber erst im April. Solange dauert es, bis die Logistik der Wahlmaschinerie auch in den abgelegensten Dörfern der Hochanden und den Niederungen des ecuadorianischen Amazonasgebietes wieder aufgebaut ist.
Luisa González
Geboren 1977, ist sie die Präsidentschaftskandidatin der Revolución Ciudadana (RC). Die RC ist eine politische Bewegung, welche auch mehr als zehn Jahre nach der Regierungszeit des international bekannten Präsidenten und Reformers Raffael Correa, noch großen Rückhalt in der Bevölkerung genießt. Unter Correa entstand die moderne Verfassung Ecuadors, in welcher die Natur als juristische Person festgeschrieben wurde, und das indigene Gemeinschaftsmodell „Sumak Kawsay, das gute Leben“ in der Präambel als richtungsweisend aufgenommen worden ist.
Als Anwältin hat Luisa Gonzáles eine lange Karriere im öffentlichen Dienst während der Regierungszeit von Rafael Correa hinter sich. Sie wirbt für staatliche Kontrolle über strategische Sektoren wie Energie und Bergbau. Die sozialen Programme aus der Zeit von Rafael Correa sollen wiederbelebt werden. Dazu gehören Subventionen und Investitionen in Bildung und Gesundheit. Zentrales Thema ihrer Kampagne ist die Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Ecuador ist in den letzten fünf Jahren zu einer Drehscheibe des internationalen Drogenhandels geworden. Bandenkriege sind eskaliert, politische Morde gehören zur nationalen Tagesordnung. Polizei und Justiz sind zu reformieren, gleichzeitig die sozialen Ursachen von Gewalt zu bekämpfen.
Luisa González wird von ihren Gegnern als Ziehtochter von Correa bezeichnet. Tatsächlich steht sie bis heute loyal zu ihrem damaligen Arbeitgeber. Dies bringt ihr die Unterstützung von den Anhängern der RC. Ihr gegenüber stehen Kritiker, die Correas Regierungszeit als autoritär und korrupt bezeichnen.
Daniel Noboa
Geboren am 30. November 1987 als Sohn einer der einflussreichsten Unternehmerfamilien Ecuadors. Sein Vater, Álvaro Noboa, war mehrfach erfolgloser Präsidentschaftskandidat. Er gilt als vermögendster Mann des Landes. Die Familie ist vor allem durch ihre Unternehmensgruppe Noboa Corporation bekannt, die im Agrarexport tätig ist. Daniel Noboa hat einen Abschluss in Business Administration von der New York University (NYU) und einen Master in Public Administration von der Harvard Kennedy School. Noboa ist Doppelbürger von Ecuador und den USA. Ein Neoliberaler, ein Neokonservativer.
Noboa trat 2023 als Präsidentschaftskandidat der Partei Acción Democrática Nacional (ADN) an. Als Mitgründer dieser neuen politischen Bewegung, die sich auf Themen wie Wirtschaftswachstum, Sicherheit und Jugendbeschäftigung konzentriert. Im Oktober 2023 gewann Noboa die Stichwahl. Schon damals gegen Luisa González und wurde damit zum jüngsten Präsidenten Ecuadors.
Er verfolgt eine klassische, neoliberale Linie und setzt sich für eine unternehmerfreundliche Politik ein, die private Investitionen fördert. Die Steuerlast für Unternehmen soll verringert, die Bürokratie reduziert und die Wirtschaft gefördert werden. Sonderwirtschaftszonen wurden geschaffen, um ausländische Investitionen anzuziehen. Dazu schlägt er eine Verfassungsrevision vor, bei der, wenn wundert es, die Gewerkschaften entmachtet, Steuern für Unternehmer gesenkt werden sollen. Zentrales Thema seiner bisherigen Amtszeit ist die Bekämpfung der Kriminalität. Ein erklärter, nationaler Krieg gegen den „Terrorismo“ der Narcos führte zu monatelangen Ausgangssperren. Das Militär übernimmt zivilrechtliche und polizeiliche Aufgaben und erhält die Lizenz zum Töten. Verschiedene Fälle erschütterten das Land. Unter anderem im Dezember 20 die Ermordung von vier Jugendlichen, welche von den Militärs verhaftet wurden. Die Anzahl spurlos verschwundener Menschen steigt. Humanitäre Organisationen und Beobachter der Menschenrechte schlagen Alarm.
Noboa ist ein per Dekret regierendes Staatsoberhaupt, das sich wenig um Verfassungs- oder internationale Rechte kümmert. Um einem politischen Gegner, der in der mexikanischen Botschaft Zuflucht sucht, habhaft zu werden, lässt er diese kurzerhand stürmen und den Mann ins Gefängnis werfen. Obwohl die Verfassung die Stationierung ausländischer Truppen auf dem eigenen Territorium verbietet, verschachert er die Galapagosinseln an die USA, die dort im Südpazifik eine Marine- und Airforcebasis aufbauen wollen. Monatelange Stromrationierungen von bis zu 14 Stunden täglich ruinierten zahlreiche Kleinbetriebe. Es wurde staatlicherseits einfach verpasst, die Anlagen imstande zu halten, oder aber, mit den Nachbarstaaten Kolumbien oder Peru Stromlieferungsabkommen zu verhandeln. Ein lächerlicher, kindischer Kleinkrieg mit seiner Vizepräsidentin belustigte zwar die Boulevardpresse, ist aber vor allem peinlich. Er wurde über persönliche Kontakte in den USA zu Trumps Inauguration in Washington eingeladen, was er zu einem politischen Erfolg ummünzen möchte. Nachdem die USA illegalen Emigranten, unter denen es viele Ecuadorianer gibt, abschiebt, reagiert er mit hündischer Ergebenheit auf die Vorgaben aus Washington. Die Flieger mit Abgeschobenen sollen in Quito natürlich landen dürfen. Welcome back! Ein paar magere Wiedereingliederungsprogramme werden angekündigt.
Ja, er regiert. Mitten im Wahlkampf dann noch das: Daniel Noboa erlässt ein Dekret, wonach Heimtierfutter nicht mehr der Mehrwertsteuer unterliegt. Die Maßnahme wird ab dem 1. Februar 2025 in Kraft treten. Noboa hat gern edle Hunde, noble Pferde und schnelle Autos. Er ist Weinliebhaber, angeblich ausgebildeter Sommelier und lässt sich gern in der Badehose fotografieren. Schließlich wurde er von der Boulevardzeitung „Extra“ bereits als sexyester Kandidat aller Zeiten gefeiert.
Klassengesellschaft
Der Unterschied wischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten wird in Ecuador auf prekäre Art und Weise und vor dem Hintergrund der kolonialen Vergangenheit bis zur Schmerzgrenze deutlich. Während in den Speckgürteln der größeren Städte die Oberschicht ein Leben führt, bei dem Hafermilchcappuccino und Glutenunverträglichkeit eine größere Rolle spielen als soziale Ungerechtigkeit oder Ausbeutung der natürlichen Reserven, lebt ein zahlreicher Teil der Bevölkerung knapp am Rande des Existenzminimums.
Der Treibstoff des großen Wirtschaftsmotors besteht aus einem unkontrollierten Zufluss von Drogengeldern. Die kaum sichtbare de facto aufgehobene Grenze zwischen legalen und illegalen Finanzierungen ermöglicht einer kleinen Oberschicht ein internationales Weltbürgertum im Luxus. Die Armen werden nicht mehr wahrgenommen. Eine Sklavenwirtschaft, verschleiert durch Gleichgültigkeit. Wer in den Bandenkriegen umkommt, ist selbst schuld. Wer aus Armut kriminell wird, gehört genauso ausgerottet wie die echten Täter, die zumindest in gewissen Kreisen der vernachlässigten Gesellschaft einen abenteuerlichen Robin-Hood-Ruf genießen. Es ist eine Art verlotterter Feudalismus, der sich dank einer geduldeten Gier nach Geld und Macht am Ruder hält.
Die ideologischen Drahtzieher der ganzen Misere leben in Miami, in London oder Brüssel und treffen sich in Davos.
Korruption ist kein Zufall. Es ist eine gewollte Abwesenheit von Recht und Ordnung, die es den mächtigen Blutsaugern erlauben, mit den Menschen umzuspringen, wie es ihnen gerade passt. Hunderte von überflüssigen Gesetzen schaffen die Moloch-Bürokratie, an denen sich die Bevölkerung die Zähne ausbeißen kann. Insider der Machtstrukturen brauchen sich an diese Gesetze nicht zu halten. Gern wird von Demokratie schwadroniert. In Wahrheit kümmert sich keiner darum. Wahlen und Wähler werden manipuliert und wenn das Ergebnis nicht passt, hagelt es Klagen und Expertenschelten. Längst haben sich die Politiker vom demokratischen Ideal weggestohlen. Sie füllen vor allem die eigenen Taschen. Ernannte Beamte erhalten Pfründe, die sie beliebig ausbeuten können, ohne Strafe zu befürchten. Das Justizsystem ist ausgehöhlt. Zur unreinen Institution verkommen. Feste feiern die Plutokraten, die weder Wahrheit noch Moral als notwendig erachten. Ein Kronprinz wie Noboa regiert ein ganzes Land wie seinen Privatbesitz, setzt seine engsten Verwandten und Günstlinge in Schlüsselpositionen, wo ihre Unfähigkeit im Lärm der Katzenmusik untergeht, die uns täglich vorgespielt wird. Ein Trauerspiel.
Anlass zur Hoffnung
Doch es gibt einen, wenn auch schmalen Silberstreif am Horizont. Es ist eine Pattsituation entstanden. Während die Armeen der jeweiligen Partei losmarschieren, um die Zeit bis zur Stichwahl mit Versprechungen und gegenseitigen Beschimpfung unterhaltsam zu gestalten, suchen die Kandidaten nach möglichen Verbündeten, deren Stimmen sie an sich ziehen können. Da der Vorsprung von Noboa nasenhaarfein ist, braucht es nur ein paar tausend Stimmen, um die Waage nach der einen oder anderen Seite zu schaukeln. Da gibt es den kämpferischen Führer der Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE), der Organisation der indigenen Gruppen Ecuadors. Leonidas Iza ist der erfolgreichste unter den erfolglosen Kandidaten und konnte 5,23 % der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. Sollte er Partei ergreifen und sich an die Seite eines der Kandidaten stellen, so stehen die Chancen für diesen gut. Iza, als Vertreter der größten Volksgruppe mit einer einigermaßen treuen Gefolgschaft und ein erfahrener Politiker, ist sich bewusst, was das Zünglein an der Waage bedeutet. Und das es seines ist.
Zwar hat die RC bei den Indigenen keine guten Karten. Damals hat der Übervater Correa einige diktatorische Fehler im Umgang mit der Urbevölkerung gemacht. Doch Iza wird auch wissen, dass sich der wirtschaftsfreudige Klüngel um Noboa kaum für die indigene Kultur und deren Interessen erwärmen wird. Das Öl muss aus dem Boden. Auf diesem Boden leben die Shuar, die Secoya, die Napo Runas, die Zaparos und weitere, durchaus selbstbewusste Stämme. Das Modell des Sumak Kawsay, welches bei den Industriebaronen Schnappatmung auslöst, weil sie dahinter kommunistische Umtriebe vermuten, wäre ein gangbarer Weg, sich endlich von dem kolonialen Erbe zu befreien und einen eigenständigen Weg zu gehen.
Das weiß auch Luisa González. Für sie steht ein anderes Hindernis auf dem Weg in den Präsidentenpalast. Ihre absolute Loyalität zu Rafael Correa der via soziale Medien immer wieder mit großen Worten in den Wahlkampf eingreift. Seine famose bürgerliche Revolution hat bei aller Sympathie einige heftige Entgleisungen verbrochen. Diese müssen aufgearbeitet werden. Die RC ist trotz des Wahlergebnisses vom letzten Sonntag eine gespaltene Partei. Es stehen linientreue Correistas einer Gruppe von einflussreichen Protagonisten gegenüber, die eine Neugestaltung der ursprünglichen Ideologie fordern. Wenn diese glaubwürdig erfolgt, Iza sich an die Seite Luisas stellt, dann besteht die Chance, dass Ecuador eine spannende und wegweisende Zeit erlebt, mit einer starken Frau an der Spitze.
Wenn die Vision der multipolaren Welt verwirklicht werden soll, darf Noboa nicht gewinnen. Seine Vasallentreue zu den USA ist ungebrochen. Stramm in den Reihen derjenigen stehend, die einer „regelbasierten Weltordnung“ folgen, kann er einer positiven, selbstständigen Entwicklung in ganz Südamerika dicke Steine in den Weg legen. Investoren aus den USA und Europa werden ihm dabei zur Seite stehen. Ecuador wird dabei seine nationale Souveränität einbüßen und droht, in einem größeren Konflikt zwischen den globalen Machtblöcken, ganz einfach unterzugehen. Bevor nun die demokratischen Grundregeln ganz außer Kraft gesetzt werden, kann man nur an die Menschenliebe und an die Vernunft der politisch Verantwortlichen glaubend sein Vertrauen den ecuadorianischen Frauen und Männern schenken, die im April ihre Kreuze auf den Stimmzetteln machen.
Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land
Und werden in den Schatten treten
Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür
Und legen ihn in Ketten und bringen vor mir
Und fragen: Welchen sollen wir töten?
Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen
Wenn man fragt, wer wohl sterben muss.
Berthold Brecht, Seeräuberjenny, Dreigroschenoper 1926




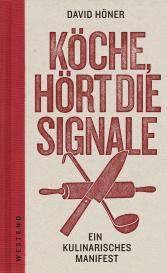
Das wurde am 14.02.2025 bezüglich der Gefangenen in Gaza publiziert:
https://vimeo.com/1056948321
Ein jüdischer Gefangener darf nach draussen und angelt.
Naja, ich sage nur Theresienstadt als schöne Heimstatt für Juden mit netten Theateraufführungen, Fußballspielen und Konzerten.
Dieses Filmchen beweist lediglich, dass der Mann, so er denn ein israelischer Gefangener ist, in guter körperlicher Verfassung ist. Dass überhaupt jemand in Gaza es sich so gemütlich machen könnte, ist wohl eher zweifelhaft.
Nichtsdestotrotz liegen meine Sympathien bei den Palästinensern.
Danke für diesen interessanten Bericht.
Jetzt müssen die USA gar nicht mehr putschen, sie schicken einfach ihre Zöglinge, gerne auch Doppelstaatler, ins Rennen. Klappt ja auch immer wieder bei ehemaligen Staaten der SU.
Wollen wir hoffen, dass Luisa Gonzalez gewinnt, im Sinne von Pacha Mama und ihren indigenen Kindern.
Apropos Wahlen. Wie geht es eigentlich in Rumänien weiter?
Zur Erinerung: Präsident Correa war derjenige, der Julian Asange Asyl in der Londoner Botschaft gewährte. Er wurde abgelöst durch Lenin Moreno von derselben Partei, der aber die neoliberale Wende in Gang setzte. Was dann zu dem jetzt beschriebenen Zustand führte.
Haben die Equadorianer nicht allen Grund, sich Correa zurück zu wünschen? Jedenfalls war Equador damals nicht der weltweit einmalige Drogenstaat wie jetzt. Hängt das zusammen, Neoliberalismus und Drogenbanden? Dafür gibt es Anzeichen. Im benachbarten Argentinien dasselbe:
https://www.handelsblatt.com/politik/international/argentinien-drogengewalt-wird-zum-problem-fuer-schock-reformer-milei/100029692.html
Rischtisch…
es kommt darauf an nach dem motto „er ist zwar ein Schurke, aber unser Schurke“
man kann die Leute auch kaufen
https://amerika21.de/2019/04/225089/ecuador-weltbank-iwf-moreno-assange
Danke, wusste ich so nicht. Aber auch da haben wir die Parallele zu Argentinien. Das Land hat mit 63 Milliarden den größten jemals ausbezahltren IWF-Kredit bekommen. Und Milei bettelt um mehr, weil seine Politik einen Absturz der Wirtschaft verursacht hat. Ganz entgegen der Prognosen unserer „Wirtschaftsweisen“.
Nicht nur in Argentinien: der Staat muss weg der Staat muss weg, wo ist der Staat wo ist der Staat wo ist der Staat wo ist der Staat.
Tja und dann?
Nicht nur in Argentinien: der Staat muss weg der Staat muss weg, wo ist der Staat wo ist der Staat wo ist der Staat wo ist der Staat.
1. Staat weg
2. ???
3. Paradies
Ist das so in etwa der Plan?
Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Bericht. Tatsächlich hatte ich zuvor nicht bemerkt, dass in Ecuador gewählt wurde. Beim Lesen ist mir aufgefallen, dass es dort auch schon im Oktober 2023 Präsidentschaftswahlen in der gleichen Konstellation gab. Nun würde mich noch interessieren, warum diese Wahlen jetzt schon wiederholt werden müssen. Gibt es dafür einen wichtigen Grund?
Präsident Lasso wurde 2023 nach einem Misstrauensvotum, worauf er kurzerhand das Parlament auflöste, zum Rücktritt gezwungen. Da er seine Amtszeit von vier Jahren nich erfüllen konnte wurden Neuwahlen ausgeschrieben und Daniel Noboa auf zwei Jahre zum zum Interimspräsidenden gewáhlt. Damals verlor Luisa Gonzales knapp die Stichwahl. Bei den Wahlen vom 11. Februar geht es jetzt um eine reguläre neue Periode von vier Jahren