
Die erste europäische Postdemokratie ist viel älter, als man gemeinhin vielleicht annehmen möchte.
Postdemokratie: So tun als ob es demokratisch wäre – und dabei den Schein wahren, indem man die Rituale demokratischen Umganges aufrechterhält, sie aber nicht mit Leben füllt. Postdemokratie ist die Aufhebung der Streitkultur und die Überführung in ein enges Korsett, in dem die einfachsten demokratischen Prozesse nichts mehr hergeben, nicht mehr funktionieren – ja, auch gar nicht mehr funktionieren sollen.
Der US-Politikwissenschaftler Sheldon Wolin nutzte den Begriff der Postdemokratie schon einige Jahre, bevor ihn der britische Soziologe Colin Crouch einem breiteren Publikum bekanntmachte. Wolin soll ihn sich vom französischen Philosophen Jacques Rancière entliehen haben. In Crouchs Buch von 2004, das ganz schlicht Post Democracy hieß, wird das Phänomen geschärft – vereinfacht gesagt: Postdemokratie ist Spektakel, das in Apathie münden soll. Ein Popanz, der sediert – im Grunde ist sie als eine Entpolitisierung der Politik zu begreifen.
Wir Zeitgenossen sollten das kennen – zu lange begleitet uns diese »Staatsform« nun schon. Für die jungen Leute ist sie die einzige Normalität, die sie kennen. Ältere Beobachter spüren die Aushöhlung demokratischer Abläufe – sie merken, dass die Show an die Stelle tritt. Während der kürzlich erfolgten Koalitionsverhandlungen zwischen zwei Parteien, die sich vermeintlich spinnefeind gegenüberstehen, konnte man vom postdemokratischen Naturell dieser Republik wieder Notiz nehmen.
Die erste ihrer Art
Wie neu ist diese Idee, demokratische Bestrebungen durch eine Scheindemokratie auszuhebeln? Ist das eine neuere Entwicklung? Brauchten die Machteliten mehrere Dekaden, bis sie wussten, wie sie die »demokratische Bedrohung« ihrer Angelegenheiten so abbremsen konnten, dass sie sie nicht mehr gefährdeten, ohne gleich offen in die Diktatur abgleiten zu müssen, die ihrem Wesen nach ja auch ziemlich kosten- und zeitintensiv ist?
Neu ist das Konzept mitnichten, die erste Postdemokratie war schnell installiert: Wer sich vielleicht mit der neueren spanischen Geschichte etwas auskennt, mit der Zeit des Restaurationssystems, um es genauer zu sagen, der hat vielleicht den Begriff »Pardo-Pakt« oder »Pacto del Pardo« schon mal gehört. Er ist die Überschrift zu einer parteiübergreifenden Scheindemokratie, die ab 1885 das restaurative Spanien prägte.
Als König Alfonso XII. im genannten Jahr starb, war sein Sohn noch nicht mal geboren. Seine Witwe Maria Christina übernahm bis zu dessen Amtsfähigkeit die Regentschaft. Um die Monarchie in dieser schweren Zeit zu sichern, kamen die Liberalen und die Konservativen, die beiden großen Parteien dieser Epoche, zu einer Vereinbarung. Sie beschlossen, ihren Parteienstreit und jeglichen Wahlkampf einzustellen. Der Pakt, der im königlichen Palast El Pardo geschmiedet wurde, sah vor, die Wahlergebnisse so zu fälschen, dass es bei jeder Wahl einen Regierungswechsel zwischen den beiden »Vertragspartnern« gibt. Die Liste der Regierungspräsidenten dieser Zeit liest sich dann auch monoton einfach: Antonio Cánovas, Práxedes Mateo Sagasta, Antonio Cánovas, Práxedes Mateo Sagasta, Antonio Cánovas …
Diese zwischenparteiliche Vereinbarung, sich gar nicht erst mit verschiedenen politischen Positionen und Ansichten aufzuhalten, sondern sich aus Gründen einer übergeordneten Sache zu einigen, kennen wir heute gewissermaßen auch. Oder anders gesagt: Das Spanien des Pardo-Paktes war vielleicht die erste Postdemokratie, die dieser Kontinent je gesehen hat.
Lang lebe der König!
Natürlich war das Spanien vor diesem Pakt keine Musterdemokratie gewesen, an die wir den Maßstab der Gegenwart legen könnten. Es gab ein Zensuswahlrecht, das nur wenige Wahlberechtigte zuließ – und auch Wahlfälschungen leichter von der Hand gehen ließ. Später etablierte man dann ein Männerwahlrecht und vergrößerte so die Zahl derer, die wählen durften. Dieser »kleine Wählerwille« wurde aber gleichwohl verfälscht. Wobei klar ist, dass man die Manipulation des Wahlergebnisses von damals nicht mit der heutigen Leichtfertigkeit verwechseln darf, mit der man das Votum – insbesondere durch Demoskopie – »austrickst«. Um die Monarchie geht es heute zudem auch nicht mehr. Heute handelt es sich um das gekrönte Haupt einer ökonomischen Lehre, die wir Neoliberalismus nennen und der man zuruft: Lang lebe der König!
Cánovas‘ Konservative und Sagastas Liberale vereinbarten also, dass dieses bisschen an Demokratie, welches innerhalb jener Ära namens Zweite Restauration zugestanden wurde, auch noch zugunsten einer übergeordneten Sache von außerordentlicher Wichtigkeit geopfert wurde. Und das ohne, dass man den Menschen ihre kleine demokratische Freude vermieste und ihnen das Wahlrecht entzog. Sie durften ja wählen, auch wenn sie keine Wahl hatten. Das Gefühl, endlich in der Demokratie angelangt zu sein: Irgendwie durften die Wähler es für sich bewahren.
Lars Klingbeil ist sicher kein Sagasta und Friedrich Merz keine Cánovas – die Geschichte ist zu komplex, als dass sie auch nur Episoden zuließe, die sich ähnlich sind. Aber diese Idee einer demokratischen Struktur, die erhalten bleiben und die trotzdem nicht als Störenfried vorgeordneter Interessen fungieren soll, die ist unserem zeitgenössischen Konzept von »Demokratie« schon ähnlich. Man kann sich als moderner Mensch immer noch gut vorstellen, wie Cánovas einigen Hofberichterstattern in den Notizblock diktierte, dass der Konstitutionalismus eine Art von monarchiekonformer Demokratie sein muss – so wie damals, die ewige Kanzlerin, die die Monarchie durch den Markt ersetzt hat, um so dem König der Stunde zu huldigen.
Brandmauer: Ein Stück postdemokratische Wirklichkeit
Der Pardo-Pakt hielt mehr oder weniger bis Anfang der Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Liberale und Konservative wechselten sich in der Regierung ab und unterdrückten allerlei moderne Entwicklungen innerhalb der spanischen Gesellschaft, konservierten miteinander ein System, das schon lange am Ende war. Dann glitt man in die Diktatur Primo de Riveras ab. Das Spanien des Pardo-Paktes hat stumpf gemacht, die spanische Bevölkerung entpolitisiert und durchaus auch den Boden bereitet für Romantizismen von der einen starken Hand, die das Durcheinander des Staates regeln sollte. Die Apathie hatte so stark um sich gegriffen, dass man »Demokratie« als zahnlos wahrnahm, als ein System, in dem die Belange der Bürger nicht mehr vorkamen.
Ein kurzes Zwischenspiel genannt Zweite Republik führte dann doch in Bürgerkrieg und – abermals in eine Diktatur. Die war dann auch langlebiger.
Der Pakt, der die politische Streitkultur aufhob und eine Anpassung der beiden etablierten Parteien aneinander fast vorschrieb, hat den Widerstand gegen diktatorische Tendenzen nicht nur faktisch aufgehoben, sondern sogar noch begünstigt. Denn was nach dem Pakt von Pardo kam, bestätigt dies. So weit sind wir in unserer postdemokratischen Wirklichkeit auch schon – auch die Brandmauer darf als ein Stück postdemokratischer Kultivierung betrachtet werden. Denn sie simuliert einen demokratischen Prozess, der sich hinter abwechselnden Regierungen mit immer denselben Inhalt verbirgt. Wenn diese Praxis sich auch noch einmauert, ist der Übergang von Postdemokratie ins Diktatorische fließend. Ein Aufheben der Brandmauer würde, um das auch noch klarzumachen, die Postdemokratie nicht ins Demokratische hieven. Die besagte Partei, die man ächtet, ist letztlich auch nur als eine postdemokratische Größe zu verstehen.
Ähnliche Beiträge:
- Über einige Elemente des Zerfalls demokratischer Vernunft …
- Demokratie-Demontage
- Korrumpiert
- Mut statt Hoffnung
- Vom rheinischen zum schweinischen Kapitalismus




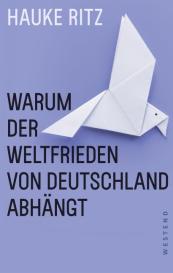
Im Großen und Ganzen haben Sie meine Zustimmung Herr Lapuente.
Nehme ich nicht so wahr und spiegelt sich auch nicht in Staatsquote usw. wieder… der „Neoliberalismus“ (der in der VWL m.E. „Neoklassik“ heißt und eine dümmlich unvollständige ökonomische Sichtweise darstellt) ist, meiner Wahrnehmung nach, vor allem noch als Feindbild-Glaubensbekenntnis in linken Kreisen präsent. Was ist z.B. an Massenzuwanderung (teilweise in unsere Sozialsysteme) denn neoliberal? Oder an einem Krieg? Oder an einer Plandemie, in der man die Leute knebelt, zwangsimpft und danach mit Staatsgeldern die Wirtschaft notdürftig wieder aufzupeppeln versucht? Das hat mit „Neoliberalismus“ alles längst nichts mehr zu tun.
Eine Partei ist an sich niemals demokratisch, es ist halt eine Partei, das Parteiensystem kann man postdemokratisch nennen, sofern eben der Wählerwillen nicht mehr abgebildet wird und nur noch Scheinalternativen existieren. Ich denke wir müssen da nicht streiten, aber ohne Brandmauer würde der Wählerwillen mit Sicherheit besser abgebildet, als derzeit, die AfD ist (egal ob einem das gefällt oder nicht) eine Alternative zum bisherigen „weiter so“, sonst würde sie nicht widersprechen und dafür diskriminiert werden…
Davon abgesehen kann man sich natürlich streiten, ob Parteiensysteme überhaupt „demokratisch“ sind, so oder so, selbst unter optimalen Bedingungen, sind sie bestenfalls eine Minimalversion von dem, was möglich wäre…
@Scheinregen, Sie sagen es: „Davon abgesehen kann man sich natürlich streiten, ob Parteiensysteme überhaupt „demokratisch“ sind, so oder so, selbst unter optimalen Bedingungen, sind sie bestenfalls eine Minimalversion von dem, was möglich wäre…“
Wenn „Demokratie“ heißt, dass Bürger und BürgerInnen selbst Politik machen, also auch Lebensbedingungen und Gesetze im Sinne des Gemeinwohls entwickeln, , dann ist das, was die vorherrschende Parteien-Demokratie vorführt vor allem eines: „Fassade“. Prof. R. Mausfeld läßt grüßen.
Kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass nicht wenige Medien, auch sog. alternative, ihre Existensgrundlagen vor allem aus Klagen und Lamentieren übers schlecht Bestehende ziehen. Hoch und runter werden die Herrschaftsverhältnisse analysiert und seziert. An die Menschen im Lande wird von nicht wenigen Seiten appelliert gegen alle möglichen Verwerfungen aufzustehen und manche wohlmeinenden Analysten suggerieren ein Hoffnungsmoment mit der Empfehlung „die richtige Partei zu wählen“. Heißt also, es bleibt alles wie gehabt!
Hörenswert dazu: Ulrike Guerot: Postdemokratie/simulative Demokratie:
https://www.youtube.com/watch?v=cyNrQ264aR8
„Was ist z.B. an Massenzuwanderung (teilweise in unsere Sozialsysteme) denn neoliberal? Oder an einem Krieg?
Oder an einer Plandemie, in der man die Leute knebelt, zwangsimpft und danach mit Staatsgeldern die Wirtschaft notdürftig wieder aufzupeppeln versucht? Das hat mit „Neoliberalismus“ alles längst nichts mehr zu tun.“
–
Wenn Sie die mit diesen Dingen verbundenen Geldströme und Machtzuwächse betrachten, also von wo nach wo Vermögen fließt, wer Zuwachs an Handlungsfreiheit hat, wer andersrum Einschränkungen in seinem Leben hinnehmen muss, wer von Verantwortung und gesetzlichen Regelungen befreit wird, wer andersrum gesetzlich gegängelt wird,dann werden Sie sofort verstehen, was das mit Neoliberalismus zu tun hat.
Vorsicht, das könnte manche😉 verwirren, denn es führt geradewegs zu den Financiers und weg vom Popanz „böser Ausländer“.
Postdemokratie ist erneut ein falsch gesetzter Begriff, es kann nicht weg sein, was nie da war und die so bezeichnete Brandmauer fällt ebenfalls in den Bereich der Reduktion von Demokratie auf den parlamentarischen Budenzauber. Es war doch stets so und ist heute besonders offenkundig, daß im Kapitalismus die wesentlichen Entscheidungen außerhalb dieser von oben installierten Gremien getroffen werden:
Paul Schreyer über Corona, Demokratie und Macht
Meet Your Mentor
https://www.youtube.com/watch?v=iKW_EZMOSps
Auf die angesprochenen Studien verweist Paul Schreyer auch im folgenden Artikel:
„Westliche Demokratie“ ist hohl: Reichtum regiert
02. April 2018 Paul Schreyer
Gedanken zu einer wenig beachteten und explosiven Regierungsstudie, die auf den Widerspruch zwischen Demokratie und konzentriertem Reichtum hinweist
Manche Zusammenhänge sind so simpel und banal, dass sie leicht übersehen werden. Louis Brandeis, einer der einflussreichsten Juristen der USA und von 1916 bis 1939 Richter am Obersten Gerichtshof, formulierte es so: „Wir müssen uns entscheiden: Wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger – aber nicht beides.“
Hinter dieser Aussage stehen Erfahrung und Beobachtung, aber auch eine innere Logik: Wenn in einer Gesellschaft die meiste Energie darauf verwandt wird, Geld und Besitztümer anzuhäufen, dann sollte es niemanden überraschen, dass die reichsten Menschen an der Spitze stehen. Was wir als führendes Prinzip akzeptieren, das beschert uns auch entsprechende Führer. Und wo sich Erfolg an der Menge des privaten Vermögens bemisst, da können die Erfolgreichen mit gutem Grund ihren politischen Einfluss für recht und billig halten.Gedanken zu einer wenig beachteten und explosiven Regierungsstudie, die auf den Widerspruch zwischen Demokratie und konzentriertem Reichtum hinweist
Manche Zusammenhänge sind so simpel und banal, dass sie leicht übersehen werden. Louis Brandeis, einer der einflussreichsten Juristen der USA und von 1916 bis 1939 Richter am Obersten Gerichtshof, formulierte es so: „Wir müssen uns entscheiden: Wir können eine Demokratie haben oder konzentrierten Reichtum in den Händen weniger – aber nicht beides.“
Hinter dieser Aussage stehen Erfahrung und Beobachtung, aber auch eine innere Logik: Wenn in einer Gesellschaft die meiste Energie darauf verwandt wird, Geld und Besitztümer anzuhäufen, dann sollte es niemanden überraschen, dass die reichsten Menschen an der Spitze stehen. Was wir als führendes Prinzip akzeptieren, das beschert uns auch entsprechende Führer. Und wo sich Erfolg an der Menge des privaten Vermögens bemisst, da können die Erfolgreichen mit gutem Grund ihren politischen Einfluss für recht und billig halten.
(…)
Aber Moment: Stimmt die grundlegende Annahme hier überhaupt? Regieren reiche Menschen? Existiert nicht schon seit Jahrzehnten ein frei gewähltes Parlament mit Abgeordneten aus der Mitte der Gesellschaft? Ist Bundeskanzlerin Angela Merkel, Tochter eines Pfarrers und Enkelin eines Polizisten, nicht das Musterbeispiel für einen bodenständigen, bescheidenen Menschen ohne größeren privaten Besitz? Kann man Ähnliches nicht auch über Frank-Walter Steinmeier (Sohn eines Tischlers) oder Martin Schulz (Sohn eines Polizisten) sagen?
Und bei aller berechtigten Kritik am Einfluss von Lobbyisten: Versucht die Bundesregierung mit „Mutti“ Merkel an der Spitze nicht immer wieder, das Wohl der einfachen Leute im Auge zu behalten, sich fürsorglich an den Bedürfnissen der breiten Masse zu orientieren?
Regierungsstudie untersucht Einfluss von Armen und Reichen
Forscher vom Institut für Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück sind 2016 dieser Frage in einer aufwendigen empirischen Untersuchung nachgegangen. Ihre 60 Seiten lange Antwort lautet auf den Punkt gebracht: leider nein.
Das Besondere daran: Die Studie wurde nicht von der Linkspartei, Attac oder den Gewerkschaften in Auftrag gegeben, sondern von der Bundesregierung selbst. Arbeitsministerin Andrea Nahles hatte 2015 den Anstoß gegeben. Sie wünschte sich eine solide Faktengrundlage für den damals in Vorbereitung befindlichen 5. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, in dem auch der politische Einfluss der Vermögenden wissenschaftlich untersucht werden sollte.
(…)
Je mehr Arme dafür sind, desto eher ist die Regierung dagegen
Dass solche Beispiele, die man in der Studie nachlesen kann, keine Einzelfälle oder Ausnahmen sind, fanden die Forscher in akribischer Kleinarbeit heraus. Die Ergebnisse sind eindeutig. So heißt es in der Untersuchung:
„Je höher das Einkommen, desto stärker stimmen politische Entscheidungen mit der Meinung der Befragten überein. (…) Was Bürger mit geringem Einkommen in besonders großer Zahl wollen, hatte in den Jahren von 1998 bis 2013 eine besonders niedrige Wahrscheinlichkeit, umgesetzt zu werden.“
Mehr noch: Eine politische Regelung wurde nicht nur umso eher von der Regierung umgesetzt, je mehr Reiche sie unterstützten. Das hatte man ja fast schon erwartet. Nein, ein Vorschlag wurde von der Regierung auch umso eher abgelehnt, je mehr Arme dafür waren! Die Forscher sprechen hier von einem „negativen Zusammenhang“. Sie schreiben wörtlich, dass „die Wahrscheinlichkeit auf Umsetzung sogar sinkt, wenn mehr Menschen aus der untersten Einkommensgruppe eine bestimmte politische Entscheidung befürworten.“ Das bedeutet, dass die Regierung die Armen nicht einfach nur ignoriert, sondern praktisch aktiv gegen sie arbeitet.
https://web.archive.org/web/20230114151707/https://www.telepolis.de/features/Westliche-Demokratie-ist-hohl-Reichtum-regiert-4009334.html?seite=all
Zur Herkunft der modernen Illusion von Demokratie:
Demokratieverhinderung durch die Erfindung der »repräsentativen Demokratie«
Den Schöpfern der amerikanischen Verfassung, so unterschiedlich ihre politischen Auffassungen auch gewesen sein mochten, galt im Großen und Ganzen das athenische Beispiel als eines, das gescheitert war und und von dem sie sich distanzieren wollten. Die Ursache dieses Scheitern lag für sie in dem großen Einfluss, den das als launisch und irrational betrachtete Volk auf die Regierung hatte. James Madison, einer der einflussreichsten Gründerväter der Vereinigten Staaten, gab seinem Abscheu vor der Athener Demokratie so Ausdruck:
»Solche Demokratien boten immer den Anblick von Unruhen und Streitigkeiten. Sie wurden immer als unverinbar mit der persönlichen Sicherheit oder den Rechten des Eigentums angesehen. Und sie waren grundsätzlich in ihrem Leben kurz, wie sie gewaltsam in ihrem Verfall waren.«
(…)
Und Alexander Hamilton, der zusammen mit Madison eine führende Rolle bei der Formulierung und Durchsetzung der Verfassung der Vereinigten Staaten spielte und dabei 1777 erstmals den Begriff der »repräsentativen Demokratie« verwendete, fand es unmöglich, die Geschichte der Athenischen Demokratie zu lesen, »ohne Gefühle des Entsetzens und des Ekels zu empfinden« angesichts des ständigen Hin und Hers »zwischen den Extremen von Tyrannei und Anarchie«
(…)
Doch über diese Ablehnung der Athenischen Demokratie hinaus einte die Schöpfer der amerikanischen Verfassung noch sehr viel mehr. Das lag bereits an der soziologischen Zusammensetzung des Verfassungskonvents, der 1787 für etwa vier Monate in Philadelphia mit dem ursprünglichen Auftrag zusammentrat, die auf dem Prinzip einzelstaatlicher Souveränität beruhenden Konföderationsartikel zu überarbeiten, um die Zersplitterung des Staatenbundes zu überwinden. An diesem Konvent nahmen 55 Delegierte teil, die von zwölf der dreizehn Gründerstaaten als Repräsentanten entsandt worden waren. Alle lassen sich soziologisch Eliteschichten zurechnen, seien es politische Funktions- oder Besitzeliten. Mehr als die Hälfte hatte militärische Laufbahnen absolviert, zumeist in leitenden Funktionen. Fast alle hatten bereits staatliche Funktionen inne, viele waren Gouverneure von Bundesstaaten gewesen. Mehr als die Hälfte der der Delegierten waren Juristen, viele im Hauptberuf Anwälte. Viele waren Gläubiger, Geschäftsmänner, Bankiers oder Landspekulanten und fast die Hälfte waren Sklavenbesitzer und viele bezogen ihr Einkommen aus Sklavenarbeit. Alle Delegierte des Verfassungskonvents einte also das Interesse einer Sicherung ihres beträchtlichen bis weit überragenden materiellen Wohlstandes – der Vorsitzende George Washington gehörte zu den vermögendsten Männern des Landes. Daraus ergab sich naturgemäß auch eine geteilte Abneigung gegen alles, was – wie die pennsylvanische Verfassung – irgendwie mit demokratischen Vorstellungen in Beziehung gebracht werden konnte. Der Rechtshistoriker Michael Klarmann schreibt in seinem Standardwerk The Framers‘ Coup, in welchem er die Entstehung des Verfassungskonvents, die in seinem Verlauf stattgefundenen Dynamiken und den anschließenden Ratifizierungsprozess im Detail nachzeichnet und analysiert: »Die vorherrschende Tendenz des Konvents war nicht nur nationalistisch, sondern auch unmissverständlich antidemokratisch – selbst nach den Maßstäben der damaligen Zeit.«
(…)
Den größten inhaltlichen Einfluß auf die Verfassung übte sicherlich James Madison aus. Madison, der als der komplexeste und feinsinnigste politische Denker unter den Gründervätern gilt, hatte, geprägt durch Montesquieu, ein Modell staatlicher Organisation auf der Basis einer horizontalen Gewaltenteilung vorgeschlagen, sodass sich die teilsouveränen Gewalten gegenseitig kontrollieren. Ein solches Modell steht in scharfem Gegensatz zu dem einer Demokratie mit einer ungeteilten gesetzgebenden Volkssouveränität und strikter vertikaler Gewaltenteilung. In der Tat war das konservative Gewaltenteilungsmodell Montesquieus ausdrücklich sowohl gegen absolutistische monarchische Souveränität als auch gegen Volkssouveränität gerichtet. Madisons zentrales Anliegn war es ebenfalls, eine »Pöbelherrschaft« zu verhindern. Nach seiner Auffassung würde ein übermäßiger Einfluss des Volkes die Eigentumsordnung gefährden.
(…)
Die Föderalisten verwirklichten Madisons Vision einer Elitenherrschaft, sie schufen ein politisches System, »das mit Sicherheit zu Ungleichheit führt« und errichteten Institutionen, bei denen »der Zugang zu öffentlichen Ämtern vor allem für diejenigen besteht, die es bereits geschafft haben, Teil der wirtschaftlichen Elite zu werden« und bei denen »die untersten Wirtschafts- und Statusgruppen praktisch ausgeschlossen sind.« Sie konzipierten ein Institutionsarrangement, das eine »enge Verflechtung von wirtschaftlicher und politischer Macht« garantierte, und gestalteten die Verfassung so, dass möglichst verhindert wird, dass die Mehrheit eine politische Macht erhält, die allen einen »gleichmäßigen Anteil an den Segnungen des Lebens« garantiert. Der Historiker Terry Brouton stellt in seinem Buch Taming Democracy fest:
»Man täusche sich nicht: Die Gründungselite schränkte die Bedeutung und Praxis der Demokratie auf grundlegende Weise ein, die unsere Regierung und Gesellschaft bis heute prägt. […] Indem sie die Demokratie in ein Konzept umwandelte, das eher die ungehemmte Anhäufung von Reichtum als die Gleichheit des Reichtums förderte, zähmte die Gründungselite (und nachfolgende Genarationen von Eliten), was sie nicht besigen konnte.«
(…)
Für diese Zähmung war die von Hamilton 1777 engeführte Bezeichnung »repräsentative Demokratie« von besonderer Bedeutung.
(…)
Madison stellte fest, dass auch die Reichen nur über eine Stimme bei der Wahl verfügen, zugleich durch ihre »glückliche Situation« in der lage seien, die Meinungen anderer zu beeinflussen. »Durch diesen unmerklichen Kanal werden die Rechte des Eigentums in die öffentliche Vertretung übertragen.«
(…)
Die Idee der »repräsentativen Demokratie« diente von Anfang an der Demokratieabwehr und wurde als Mittel verstanden, um das Volk von dder Politik fernzuhalten und eine Oligarchie mit der Unterstützung der Masse der Bevölkerung über Wahlen an der Macht zu halten.
(…)
Eine solche Konzeption von Demokratie, die diese als eine Art Wahl-Autokratie versteht, mit der Elitegruppierungen ihre Herrschaft scheindemokratisch zu legitimieren suchen, findet natürlich positive Resonanz in einem breiten Spektrum antidemokratischer Gesinnungen. Zur Illustration nur eine Anekdote aus einem 1919 geführten Gespräch zwischen Erich Ludendorff – einem zutiefst totalitären Charakter und Erzfaschisten – und Max Weber, der in einer Rede am 04.01 desselben Jahres kurz vor der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg unter stürmischen Beifall bekundete: »Liebknecht gehört ins Irrenhaus und Rosa Luxemburg in den Zoologischen Garten«:
»Ludendorff fragte Max Weber: Was verstehen Sie dann unter Demokratie? Weber: In der Demokratie wählt das Volk seinen Führer, dem es vertraut. Dann sagt der Gewählte: >Nun haltet den Mund und pariert.Demokratie< kann mir gefallen!«
(Rainer Mausfeld, Hybris und Nemesis – Wie uns die Entzivilisierung von Macht in den Abgrund führt – Einsichten aus 5000 Jahren, S. 262-263/266-269/298)
@ Gracchus Babeuf
„Manche Zusammenhänge sind so simpel und…“
„Hinter dieser Aussage stehen Erfahrung und…“
Diesen beiden Absätzen folgen direkt genau die gleichen Textblöcke…
Ein einziges „copy & paste“? Vielleicht mal besser darauf achten, was man bereits kopiert und eingefügt hat – und was nicht?
Oder besser noch: Selbst formulieren, dann passiert so etwas nicht und man wird vom Leser eher für voll genommen… Oder?
So aber entpuppt sich Ihr hochtrabender Kommentar schlicht als „abgekupfert“, um es in meine eigenen Worte zu fassen… Somit erübrigt es sich für mich auch, den Inhalt „Ihres Kommentars“ zu berücksichtigen oder gar zu würdigen… Aber es passt in die Zeit, sich mit fremden Federn zu schmücken; zu einem Altlandrebell werden Sie mit „copy & paste“ jedenfalls nicht!
Ach Theo, jemand wie du braucht doch sein Unvermögen nicht zu entschuldigen. Wie solltest du einer inhaltlich korrekten und mit Quellen versehenen Wiedergabe in irgendeiner Form widersprechen. Das neben dem Duktus den du üblicherweise an den Tag legst. Dazu muß man eine Suchmaschine eigener Wahl bemühen, da die Zensur hier zu deinen Gunsten eingeschritten ist.
Dein eigenes Zensurbemühen wurde registriert und der Rundablage übergeben.
Bei der Lektüre Ihres Romans bin ich eingenickt, eine Stellungnahme kann ich somit leider nicht abgeben. Vielleicht klappt`s ja beim nächsten mal…
Für was man heute alles seinen Doktor bekommt. Die einzig eingenomme Stellung scheint ohnehin die Schlafhaltung zu sein.
Wurde die Bewerbung für’s Kriegsminsterium angenommen:
Dr. Klöbner sagt:
14. Januar 2025 um 11:43 Uhr
Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht hin – dann kommt der Krieg zu dir !
https://overton-magazin.de/dialog/im-gespraech/marcus-kloeckner-und-irgendwann-schicken-sie-unsere-kinder-an-die-front/#comment-198251
Ja, wie immer, im Westen nichts Neues! Die seit Jahren immer wieder gleichen Artikel über die postdemokratischen Zustände in den westlichen Ländern.
Leider sind sie immer noch notwendig, ganz besonders in Deutschland!
Aber, ich würde mir wünschen, dass sich der Diskurs endlich mal weiterentwickelt hin zu einem Diskurs über ein neues System, ein System, das in der Praxis die vollkommene Erneuerung und Weiterentwicklung sämtlicher systemischen Institutionen und Strukturen einschließlich der systemischen und gesamtgesellschaftlichen Kommunikations- und Beteiligungsstrukturen bedeutet!
In den konservativen Medien der „Alternativen Medien“ wird diese Debatte bereits geführt. Allerdings wollen sie ganz klar ein wirtschaftsliberales bis libertäres System, also so wenig Staat wie möglich, was zeigt, dass diese Medien durchweg nur rein ideologisch unterwegs sind und damit einen sachlichen Diskurs nicht führen können und wollen.
Auch Radio München und Manova sind auf die libertären „Heilsversprechen“ reingefallen und propagieren ebenfalls so wenig Staat wie möglich, was die intellektuelle Schwäche der dortigen Verantwortlichen offenbart.
Ein immer wieder nur bloßes Kritisieren wird uns nicht weiterbringen, solange nicht gleichzeitig konstruktive und praktikable Alternativen, die eine echte Weiterentwicklung bedeuten, diskutiert werden.
Mein Diskursbeitrag ist die Wertstufendemokratie: https://martinbesecke.de/wertstufendemokratie.htm
@ Georg
2. Mai 2025 um 11:44 Uhr
Wenn ich Sie recht verstehe, zielen sie nicht so sehr auf die Analyse des Ist-Zustandes, was allerdings auch interessant wäre, denn schließlich ist es inzwischen kaum mehr übersehbar, dass wir es heute mit dem Heraufdämmern eines neuen Systems zu tun haben, das mit den Begriffen der Vergangenheit bestenfalls eingeschränkt und teilweise zu erfassen ist.
Nein, Sie zielen, wenn ich Sie recht verstehe, auf den Entwurf einer neuen alternativen Ordnung. Nun, auch das ist interessant und passt in die Zeit.
Ob man im konservativen Spektrum der alternativen Medien im Hinblick auf die Skizzierung einer neuen alternativen OIrdnung aber wirklich weiter ist, kann ich nicht recht beurteilen, doch würde es mich überraschen.
Vielleicht können Sie hierzu einmal zwei oder drei Beispiele nennen?!
Wo das konservative Spektrum meines Erachtens aber in der Tat weiter ist, das ist die Analyse des Ist-Zustandes und der vorhandenen Trends.
Dass man dort im Hinblick auf libertäres Denken etwas zu unkritisch ist, sehe ich auch. .
Ein vielleicht gewichtiger Unterschied zwischen eher frei-linken und konservativen alternativen Medien dürfte sein, dass letztere in ihrer Analyse eher zu einer ungedämpften und teils sogar extrem pessimistischen Perspektiv- und Ausweglosigkeit neigen, während erstere – dem linken Wunsch nach Gesellschaftsveränderung noch nicht ganz entwachsen – sich etwas schwerer mit der schonungslos-nüchternen Ist-Beschreibung tun.
@Wolfgang Wirth
Ja, es geht mir ganz konkret um ein neues System!
Und wenn Sie sich die Analysen besonders der letzten 15 Jahre vergegenwärtigen, dann sind diese Analysen im Inhaltlichen sowie in ihren Schlussfolgerungen im Prinzip gleich. Seit mindestens 15 Jahren reden wir fundiert analysiert von einer Scheindemokratie.
Hat diese Kritik, dieses bloße Kritisieren, irgendetwas gebracht, irgendetwas zum Besseren verändert? Nein, natürlich nicht!
Ganz allgemein zusammengefasst, haben die hinlänglich bekannten gesamtsystemischen Negativentwicklungen und vor allem, dass sich diese so ungehindert vollziehen konnten bzw. so ungehindert vollzogen werden konnten, die systemischen Dysfunktionalitäten sowie die strukturellen Defizienzen in den gesamtgesellschaftlichen Kommunikations- und Beteiligungsbedingungen der bestehenden Demokratiesysteme offenbart.
Und genau deswegen halte ich die grundlegende Erneuerung und Weiterentwicklung der gesamtsystemischen Rahmenbedingungen hin zu einem volldemokratischen System für unumgänglich.
@ Georg
2. Mai 2025 um 17:29 Uhr
Ich kann Ihre Bemühungen durchaus nachvollziehen, doch gebe ich zu bedenken, dass sich eine neue politische Ordnung nie deswegen etabliert, weil sie besser ist, weil sie erfolgreicher Probleme löst oder weil sie von vielen gewollt wird, sondern deshalb, weil sie im Kräfteparallelogramm der relevanten gesellschaftlichen Gruppen sozusagen die resultierende Kraft ist.
Man kann zwar in diese Richtung hinarbeiten, aber planbar ist das letztlich nicht.
Ein schonungslos-nüchterner Wirth? Mal schnell schonungslos-nüchtern für die Agenda des Geldadels zur Bewahrung ihres Status quo annektiert:
Wolfgang Wirth sagt:
19. Dezember 2024 um 18:11 Uhr
1. „Halten Sie die Demokratie in Deutschland für gescheitert?“
Die parlamentarische Demokratie ist besser als andere politische Ordnungen, aber die gesellschaftlichen Voraussetzungen für ihr Funktionieren sind zunehmend weniger und teilweise sogar gar nicht mehr gegeben:
-> Vorhandensein eines gut ausgeprägten und selbstbewussten bürgerlichen Mittelstands, der den Machtansprüchen von Oligarchen ebenso Widerstand entgegensetzen kann wie sozialrevolutionären und utopischen Tendenzen aus der Unterschicht, (…)
https://overton-magazin.de/dialog/umfrage/umfrage-dachten-sie-schon-mal-ans-auswandern/#comment-189861
Nennt sich wohl auch Realpolitik:
Die Götzen der Religion des Kapitals sind allgegenwärtig und werden auf nahezu allen Kanälen gepredigt. Als alternativlos oder unantastbar gilt eine absurde Reichtumsverteilung: „Da lässt sich nichts machen …“ Oder: In höchste Staatsämter kann in vielen Ländern (z.B. in der BRD) faktisch nur gelangen, wer dem Heilsversprechen der Atombombe glaubt oder jedenfalls zu Diensten steht. Der nicht zu überbietende Irrsinn, der die gesamte Menschheit bedroht, wird somit als „Realpolitik“ ausgegeben. Alles, was nachweislich den Menschen und dem Zusammenleben dient, wird förmlich kaputtgespart, um der Kriegsgottheit, die nachweislich nur Leiden und noch mehr Krieg hervorzubringen vermag, mit endlosen Milliardenopfern zu huldigen …
Aus:
„Teilen statt töten“
10. November 2024 Peter Bürger
Subversive Frühlingszettel eines Mitglieds der letzten noch im Parlament vertretenen sozialistischen Partei: Internationalismus, Ökopazifismus, Demokratie, Klassenkampf und eine in das Leben verliebte Kulturrevolte (Teil 2).
https://overton-magazin.de/top-story/teilen-statt-toeten/
Passend zum Thema:
https://tkp.at/2025/05/02/macht-der-wahnsinn-ploetzlich-sinn/
@ Veit_Tanzt
Danke für den interessanten Link.
@ Wolfgang Wirth
Gern geschehen.
Ich hab noch einen Artikel, auf den ich zufällig gestossen bin. Beurteilen kann und will ich den Inhalt allerdings nicht. Das scheint mir eine schwer verdauliche Kost zu sein, haut allerdings ungefähr in die gleiche Kerbe.
https://thepredatorsversusthepeople.substack.com/p/the-project-for-world-domination
@Veit_Tanzt
2. Mai 2025 um 16:56 Uhr
Ich hab´ da mal reingelesen, doch ist es mir wirklich entschieden zu spekulativ.
Es geht insbesondere im Hinblick auf die historische Dimension der Sache und ihre Treiber noch weit über den ersten Artikel hinaus.
@ Wolfgang Wirth
Schrieb ich doch, dass es harter Tobak sei.
Frei nach dem NDS-Motto:
Glaube wenig.
Hinterfrage alles.
Denke selbst.
Nix für ungut. Schönes Wochenende!
Kein Wunder daß der Wirth applaudiert. Passt ihm sehr gut. Beginnt bereits unter der Überschrift mit einer Lüge, von globalen Mächten die eine „freie Gesellschaft“ von innen heraus zu zerstören. Die kapitalistische Gesellschaft, die sich unter der Ägide der Großkapitalisten und ihrer willfährigen Dienstboten formte, ist nicht erst kürzlich global und meinte schon stets nur die Freiheit der Kapitaleigner. Die Bedingung, der Einsetzung von oben vorselektierten Repräsentanten, für die man dann Anscheinwahlen abhält und an denen man sich abarbeiten soll, ist ebensowenig neu. Die beklagte Kontrolle durch den Staat, läßt außen vor daß diese Staaten ebenfalls schon zuvor dem Willen der Kapitaleigner unterworfen waren und dem entsprechend geformt wurden. Der Migrantenstadl schließlich ist ohnehin das beliebteste Ablenkziel eines gerüttelt Teil der Geldknechte, wobei kolportiert wird, daß deswegen Sozialsysteme kollabieren würden und nicht etwa weil man ganz oben den Hals nicht voll bekommt.
In dem Zusammenhang noch von einer definanzierten Strafverfolgung zu reden, wo das institutionalisierte und verrechtlichte Raub- und Mordsystem seit je Alltag ist, alltäglicher Lohnraub für leistungslose Maximaleinkommenen am oberen Ende, Veruntreuung öffentlicher Gelder, Veruntreuung öffentlicher Einrichtungen, Pharma- und Rüstung und weitere Branchen, entbehrt dann nicht einer gewissen Komik. An dieser Stelle wurde noch nie strafverfolgt.
Gracchus Babeuf
„Kein Wunder daß der Wirth applaudiert. Passt ihm sehr gut. Beginnt bereits unter der Überschrift mit einer Lüge…“
Er hat sich lediglich für einen Link von Veit_Tanzt bedankt – nicht mehr und nicht weniger! Kein Grund, um hier eine derartige Negativity Show abzuziehen!
Als „Copy & Paste Master“ besser an die eigene Nase fassen! Just a thought…
Denk weiter Theo, während du(!) die eigene Nase befingerst. Ich hab dir bereits weiter oben geantwortet, hängt aber noch in der Zensur.
🐻🐏
„er ist nicht für das volk, er ist für die globalisten!!! mamaaaaaa!!!!“
wie könnt ihr fucking idioten eigentlich immer noch den gleichen fucking schwachsinn rausposaunen wie dümmsten schafe 1930 über die jüdische weltverschwörung? jetzt heisst sie einfach die globalistische weltverschwörung, aber die ist immer noch genauso gemein zum volk wie die „jüdisch-bolschewistische“ damals. ist mir wirklich ein rätsel wie ihre leute 60 jahre lang oder wie alt ihr auch immer seid, den gleichen einen einzigen gedanken denkt, wie eine fucking ameise. null geschichtsbewusstsein. null verständnis vom kapitalismus. einfach ein ganz fettes recht darauf, als volk und darum als individuum zum erfolg zu kommen. so behindert kann man doch nicht sein, dass man nicht merkt, dass man wie eine schallplatte mit sprung unterwegs ist und sich von irgendwelchen analysen davon wie es wirklich zugeht oder sagen wir mal was überhaupt geld oder lohn oder kapital ist komplett verabschiedet hat und nur noch jeden tag mit voller kraft ruft: DEUTSCHLAND. nutzvieh seid ihr!
Interessante Parallele. Nur gefällt mir der Begriff „Postdemokratie“ nicht. Er hat sich zwar eingebürgert, aber da steht ja immer noch der Begriff Demokratie drin. Wie wäre es mit „Postendemokratur“?
Wenn es nicht wirklich (mehr) um etwas geht, greift Apathie um sich – und auch Langeweile… übrigens auch im Fußball: Immer nur Real oder Barça… damit will ich natürlich nicht sagen, dass es in Dland diesbezügl. interessanter zugeht. Es ist halt die fast absolute-Bayern-Monarchie, von Mini-Ausrutschern abgesehen. Oder bei Pink Floyd: „I‘ve grown older and you have grown colder and nothing is very much fun anymore“ (One of my turns).
„Postdemokratie?“ Die Demokratie ist seit 2200 Jahren tot. Das zentrale Prinzip ist, dass Sitze in Räten ausgelost und eben nicht gewählt werden. Die Einsicht dass jede Form von Personenwahlen immer nur der Seite mit dem meisten Geld hilft war zwar den amerikanischen und französischen Revolutionären bekannt… aber nur um ihre absolute Verachtung der Demokatie in bürgerliche Republiken zu giessen und das dann „Demokratie“ zu nennen. Ein Etikettenschwindel und Betrug der eine ganze Epoche definiert.
Eine moderne Demokratie wäre eine zukünftige Kulturstufe, die aber nach dem Bankrott in der Antike erst noch zu entwickeln wäre.
Ein weiterer wesentlicher Pkt. ist auch, daß die ermittelten Repräsentanten jederzeit abberufen werden können, wenn sie denn gegen ihr Mandat verstoßen.
@Emil: „Eine moderne Demokratie wäre eine zukünftige Kulturstufe, die aber nach dem Bankrott in der Antike erst noch zu entwickeln wäre.“
Zustimmung.
Ideen dazu sind unterwegs, z.B. mit der Gründung einer Losdemokratie-Partei, die im Sinne paradoxer Intervention Parteien-Herrschaft verunmöglichen bzw. den ‚etablierten Parteien‘ Beine machen will.
https://www.youtube.com/watch?v=ADnQqOebwjA
Wie wäre es mit dem Begriff Prädemokratie.
Auch wenn es jetzt nicht so aussieht als käme sie bald. Es bliebe der Hoffnungsschimmer.
@Georg: „Wertstufendemokratie“ habe ich mir angeschaut. Klingt nach „Auslese der sog. Besten „, was letztlich auch ein aristokratisches Konzept darstellt, in dem gewußt wird, was für die vermeintlich unwissende, ungebildete Bürgerschaft gut ist. Kann sein, dass ich das missverstehe?
„Der riesige blinde Fleck von allem, was heute als „politisch“ gilt: Der strukturelle Aristokratismus“
https://www.youtube.com/watch?v=llnjk_yVVfk
@Ute Plass
Ja, das missverstehen Sie!
Die Wertstufendemokratie ist kein „Experten-Parlament“! Aber, und ich finde, das ist ein existenzieller Punkt, die Wertstufendemokratie befördert und unterstützt vom Auswahlverfahren (bereichsspezifische Sachthemenwahlen) sowie von den systemischen Kommunikationsstrukturen, d.h. institutionell und strukturell, reell Wissen, Kompetenz und Sachverstand, Vernunft, Sachlichkeit sowie Integrität.
Und sollte es in der Politik nicht genau darauf ankommen?
Die Wahlen sind bereichsspezifische Sachthemenwahlen. D.h., die einzelnen Kandidaten stellen sich mit ihren Vorstellungen zu den einzelnen Sachthemen zur Wahl, es kann sich grundsätzlich jeder zur Wahl stellen, und die Bürger entscheiden dann, wen sie in den einzelnen Sachfragen für am Kompetentesten halten und wem sie am Meisten vertrauen.
In der Praxis bedeutet das also eine Sachthemenwahl sowie zugleich die Wahl der Person meines Vertrauens. Und das ist die konstruktive, innere Synthese von direkter und parlamentarischer Demokratie.
Es werden also einzelne Kandidaten gewählt. Aber in der Praxis wird es natürlich so wie im richtigen Leben sein, dass mehrere Kandidaten mit denselben Vorstellungen zu einzelnen Sachthemen gewählt werden und diese sich dann zu dann bereichsspezifischen Sachparteien zusammenschließen werden.
Im Wirtschaftsparlament könnte es dann z.B. u.a. eine Gemeinwohlökonomie-Partei, eine Solidarische Ökonomie-Partei und eine Wirtschaftsliberale-Partei geben.
Und durch die Differenzierung in die vier Teilparlamente, die eine direkte Ableitung aus den vier interpersonalen Reflexions- und Kommunikationsebenen darstellen, d.h. ein direktes Abbild der universellen Sozialität des Menschen sind, ist auch das verwässernde Mehrheitsprinzip abgelöst, und zwar durch einen strukturell vorgegebenen sachlichen Diskurs.
„Die Wahlen sind bereichsspezifische Sachthemenwahlen. D.h., die einzelnen Kandidaten stellen sich mit ihren Vorstellungen zu den einzelnen Sachthemen zur Wahl, es kann sich grundsätzlich jeder zur Wahl stellen, und die Bürger entscheiden dann, wen sie in den einzelnen Sachfragen für am Kompetentesten halten und wem sie am Meisten vertrauen.“
Passt doch dann auch zu der Idee von „Geloster Demokratie“: KandidatInnen zu Sachthemen stellen sich mit ihren Vorstellungen gelosten Bürgerversammlungen vor, und diese entscheiden, wen sie in einzelnen Sachfragen für kompetent erachten. Und wenn sich das als Irrtum erweisen sollte, dann gehört der Irrtum korrigiert, sprich
die entsprechenden Personen müssen Platz machen für nächste Kandidaten.
Von welchem Entscheidungs/Wahlprocedere geht die Wertstufendemokratie aus?
@Ute Plass
Der Unterschied im „Wahlprocedere“ ist elementar!
In der Wertstufendemokratie wählen alle Bürger und nicht nur eine „geloste Bürgerversammlung“.
Die Kandidaten stellen sich zur Wahl und werden von den Bürgern gewählt, d.h. der Bürger entscheidet und nicht das Los!
Soviel zum „Wahlprocedere“.
In der Wertstufendemokratie werden durch die vorgegebenen systemischen Kommunikationsstrukturen auf institutioneller Ebene, d.h. auch in den Parlamenten, freie Debattenräume geschaffen und vor allem garantiert, die wiederum u.a. Irrtümer korrigieren und Ideologien beseitigen können.
Es wird ja immer wieder zu Recht gesagt, das Gemeinwesen solle von den Menschen gestaltet werden, es sollte vom Menschen ausgehen. Durch die Differenzierung in die vier wert-gestuften Teilparlamente, die, wie gesagt, die direkte Ableitung aus den vier interpersonalen Reflexions- und Kommunikationsebenen des Menschen darstellen, wird das Gemeinwesen, das gesellschaftliche Miteinander direkt aus der universellen Sozialität des Menschen gestaltet. Mehr „vom Menschen“ kann man nicht ausgehen!
So, jetzt ist noch den Sommerabend genießen angesagt, deswegen ein schönes Wochenende!
@Ute Plass
Noch eine kurze Nachfrage:
Eine „geloste Bürgerversammlung“, die dann die Kandidaten auslost: Was hat das noch mit Demokratie zu tun?
Soweit ich es überblicke geht es bei „gelosten Bürgerversammlungen“ nicht darum z.B. mögliche ‚Kanditaten für entsprechene Sachthemen zu losen‘.
An gelosten Versammlungen gefällt mir, dass BürgerInnen in all ihrer Verschiedenheit leibhaftig zusammen kommen würden, (hoch notwendig mit zunehmender Digitalisierung) um sich mit einem Sachthema gründlich auseinander zu setzen. Meine Vorstellung ist, dass , sollten Entscheidungen anstehen, z.B. ob und welche Kandidaten für diverse Aufgaben als geeignet erscheinen, von gelosten Versammlungen evtl. unter Anwendung der Methode des systemischen Konsensierens zustande kommen könnten .
Doch wie gesagt. nichts ist in Stein gemeisselt.
„Geloste Demokratie“ ist ja kein fertiges Konzept, sondern ich verstehe sie als eine Art von ‚Work in Progress‘.
Biin gespannt ob die in Gründung sich befindende „Losdemokratie-Partei“ auf viele noch offenen Frage konkrete Antworten hat.
In „Gegen Wahlen“ von D.v.Reybrouck können Interessierte sich zur Losdemokratie weiter kundig machen.
Was als erstes ansteht dürften „Verfassungsreformen“ sein oder?
https://wyriwif.wordpress.com/2019/03/29/verfassungsreformen/
@Ute Plass
Los-Demokratur? So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen.
Ich zieh nur Nieten, warum soll ich das denn machen?
Auch dieser Los-Demokratur steht der Mensch entgegen! Gier und Machtgelüste lassen sich damit auch nicht verhindern, dazu wäre eine Bewußtheitsänderung nötig und da sehe ich schon schwarz. Auch das kapitalistische Wirtschaftssystem wäre damit ja auch nicht beseitigt.
Warum ist wohl der Herr Pistorius laut Umfragen der beliebteste Politiker?
Nicht weil er etwa große Ahnung von seinem Job hat sondern weil er besonders markige Sprüche klopfen kann und so tut als ob. Letztendlich verkauft er aber nur was die Politflüsterer aus der Rüstungsindustrie ihm ins Ohr tütern.
Offenbar lieben die Leute solche Sprücheklopferr als starke FÜHRER. (KRIEGSTÜCHTIG)
Bequemlichkeit ist ein zusätzlicher Grund dafür: „Die werden es schon für mich machen“
Ergo, alles wie gehabt, ob nun alle vier Jahre die Stimme abgeben oder ein Los ziehen.
„Kriegstüchtig“: Die Lieblingsfloskel von Joseph Goebbels…
Die Deutschen lieben wohl den Untergang!
Und wenn ich diese Sprüche höre: „Wer soll es denn sonst machen?“
NICHT DIESE SCHWERSTVERBRECHER UND WAHNSINNIGEN!!!!
Der Mensch trägt stets die Möglichkeiten des ganzen Spektrums in sich, die positiven, wie die negativen, in unterschiedlicher Ausprägung, je nach Individuum, das sich aus seinen mitgegebenen Grundlagen und den ausgesetzten Einflüssen bildet.
Tatsächlich sind bei der Bestimmung von Funktionären, Losentscheide ein Mittel, neben anderen als Garant, gegen zu ausgeprägte korrumpierende Einflüsse und sowie gegen Netzwerkbildungen. Hinzu müssen kommen wesentlich kürzere Amtszeiten als dies heute der Fall ist und wie bereits mehrfach erwähnt, der wesentlichste Mechanismus gegen Amtsmißbrauch, die Möglichkeit der jederzeitigen Abberufung.
Ein weiterer Schutzmechanismus gegen Mißbrauch, ist die Einfügung eines Ausschlußverfahrens im Auswahlverfahren, welches zeitlich begrenzt sein kann, für Jene, die nachweislich bereits Vertrauen mißbrauchten.
Die „Flüsterer“ sind ja ziemlich „laut,“ anscheinend omnipräsent und nur deshalb so „beliebt,“ weil sie trotz (und darum wegen) ihrer enormen Defizite auf Seiten der positiven menschlichen Eigenschaften, ausgesucht und medial aufgebaut werden. Was nötig scheint, denn was sie im Allgemeinen so von sich geben, klingt wenig durchdacht und schlecht einstudiert. Andere Stimmen sollen kein Gehör finden.
Worauf zielt dies ab? Die gesammte Gesellschaft muß einem Prozess der Demokratisierung ausgesetzt werden. Ein wesentlicher Bereich sind dabei die Möglichkeiten zur Bewußtseinsbildung, also Medien und Bildungseinrichtungen.
Eine sich über die Zeit demokratisierende Gesellschaft, würde sich dabei auch vom kapitalistischen (Wirtschafts)system häuten.
@Otto0815
Evtl. können die u.a. Denkimpulse Ihre Sicht auf „Geloste Demokratie“ erweitern:
„Losdemokratiepartei: Was wir wollen“
https://www.youtube.com/watch?v=kzoxPu0dUio
Wozu die ganze Aufregung und Selbstzerfleischung, die Angelegenheit ist doch gelutscht. So wie es aussieht wird es auch keiner ändern oder auch nur annähernd ändern wollen.(praktisch gesehen)
Viel Gejodel um nichts = Ernergieverschwendung!
@ Otto0815
Einen alpenräpenden Morgengruss mit der Jodeltruppe EAV:
https://m.youtube.com/watch?v=l563OzYvZXw&pp=ygUMZWF2IGFscGVucmFw
Danke für den Link, vielleicht lerne ich doch noch Jodeln. Leider haben wir auf dem platten Land keine Berge und daher ist mit einem Echo nicht zu rechnen.
Nach dem 11. Mai wird uns der Sauerland Mini Trump restlos in den Untergang führen. No Future, die Punks haben es wohl schon frühzeitig erkannt.
Die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer Nahe!
Trotzdem wünsche ich ein schönes Wochenende, noch im Frieden
Verwirklichte Demokratie und kapitalistische Ökonomie sind ein Antagonismus. Anders ausgedrückt: Privateigentum von Produktionsmittel verhindert Demokratie. Stattdessen wird eine ideologisierte Simulation gegeben, die ob der gegenwärtigen Kapitalverwertungskrise immer fadenscheiniger zu werden scheint. Hinzu kommt, dass der sogenannte „Souverän“, auch „Volk“, an einer Demokratie nicht besonders interessiert scheint. Die schon seit Jahrzehnten andauernde Infantilisierung machte aus ihm einen greinenden Endverbraucher, unfähig die eigenen Interessen zu erkennen, geschweige denn zu formulieren und schuf so eine zunehmend entpolitisierte Öffentlichkeit, der man inzwischen alles und sei es noch so widersprüchlich und unlogisch auftischen kann.
👍👍👍👍👍
Auch von meiner Seite
👍
Danke für den Link, vielleicht lerne ich doch noch Jodeln. Leider haben wir auf dem platten Land keine Berge und daher ist mit einem Echo nicht zu rechnen.
Nach dem 11. Mai wird uns der Sauerland Mini Trump restlos in den Untergang führen. No Future, die Punks haben es wohl schon frühzeitig erkannt.
Die Zukunft ist ungewiss und das Ende ist immer Nahe!
Trotzdem wünsche ich ein schönes Wochenende, noch im Frieden