
Nach den jüngsten Protesten in Kiew gegen die Reform der Antikorruptionsbehörden erschienen in europäischen und internationalen Medien zahlreiche Artikel mit Zusammenfassungen der Ereignisse. Vereinfacht ausgedrückt lautet der Tenor vieler Berichte: Präsident Selenskyj habe seine Vertrauten geschützt und dabei den Machtkampf gegen die Antikorruptionsstrukturen verloren.
In diesem Zusammenhang wird etwa die kürzlich erfolgte Hausdurchsuchung in Starnberg beim ehemaligen stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes der Ukraine, Rostyslav Shurma, erwähnt. Wie viele Politiker zog er nach dem Ende seiner Amtszeit ins europäische Ausland – ein typisches Vorgehen. Doch solche vereinfachten Analysen greifen zu kurz und verdecken die tieferliegenden Ursachen und Konsequenzen der aktuellen Entwicklungen.
Die Rolle des NABU
Zunächst lohnt sich ein Blick auf das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU), das Selenskyj zunächst auflösen wollte, bevor er ein neues Gesetz verabschiedete und die Befugnisse der Behörde wiederherstellte. Das NABU pauschal als korrupteste Institution der Ukraine zu bezeichnen, wäre allerdings falsch – Gerichte und Staatsanwaltschaften funktionieren im Land ebenfalls äußerst schlecht, und kaum jemand wird tatsächlich wegen Korruption verurteilt. Zwar gibt es Ausnahmen, doch oft ohne gerichtliches Urteil – viele Anschuldigungen bleiben unbelegt. Die Verflechtungen sind so tief, dass sich die Beteiligten gegenseitig schützen.
Dennoch ragt der frühere NABU-Chef Artem Sytnyk negativ hervor. Seit der Gründung der Behörde war er regelmäßig in Skandale verwickelt. Mehrere Gerichte haben ihn offiziell der Korruption bezichtigt. 2020 erklärte das Verfassungsgericht seine Ernennung für rechtswidrig und setzte ihn ab – er hatte das Amt jahrelang ohne rechtliche Grundlage ausgeübt. Doch im Umfeld von Präsident Selenskyj werden „nützliche“ Personen nicht einfach fallen gelassen: Sytnyk wurde daraufhin zum stellvertretenden Leiter der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention ernannt. Im vergangenen Jahr wechselte er als stellvertretender Direktor zur Agentur für Verteidigungsbeschaffung – offiziell wegen seiner „Dienste“ für die nationale Verteidigung. Ohne die Proteste in Kiew hätten vermutlich auch die entlassenen NABU-Ermittler neue Posten gefunden – samt neuer Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung.
Wie funktioniert das Antikorruptionssystem?
Die Ermittler des NABU untersuchen Korruptionsfälle und übergeben ihre Akten an die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP). Diese erhebt dann – sofern sie den Fall für stichhaltig hält – Anklage beim Hohen Antikorruptionsgericht (HAAC). Dessen Urteil ist letztlich entscheidend. Ein Einspruch ist nur noch beim Obersten Gerichtshof möglich – dessen Richter werden vom Präsidenten persönlich ernannt. Ab diesem Punkt ist politische Einflussnahme nicht ausgeschlossen, was zur Einstellung von Verfahren oder milderen Urteilen führen kann.
Zur Staatsanwaltschaft lässt sich sagen: Auch dort gibt es nicht weniger Skandale als im NABU. Und das Antikorruptionsgericht selbst steht ebenfalls in der Kritik: Von den 38 Richtern sind viele in Vorfälle mit mutmaßlichen Gesetzesverstößen verwickelt. So wird Richter Andriy Bitsiuk verdächtigt, seiner Ehefrau – einer Anwältin – Zugang zu vertraulichen Verfahren gewährt zu haben. Richterin Valeriya Chorna erregte Aufsehen durch den Kauf eines Luxusautos und eines Grundstücks, die weit über ihr Einkommen hinausgehen. Richterin Kateryna Sykora wird unrechtmäßiger Bereicherung verdächtigt und soll staatliche Hilfsgelder in Höhe von rund einer halben Million Hrywnja erhalten haben. Der Verdacht der Bestechlichkeit steht über vielen der HAAC-Richter.
Kein einfacher Kampf: Zwei interessante Aspekte
Die Vorstellung, es handle sich beim Konflikt zwischen Präsident Selenskyj und den Antikorruptionseinrichtungen um einen Kampf zwischen „gut“ und „böse“, greift zu kurz. Zwei Entwicklungen verdienen jedoch besondere Aufmerksamkeit:
- Nach Wiederherstellung ihrer Kompetenzen unternahm das NABU einige spektakuläre Aktionen:
So wurden der Parlamentsabgeordnete Oleksiy Kuznetsov, der ehemalige Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Hayday, sowie vier weitere Personen wegen des Verdachts auf Veruntreuung von Geldern beim Drohnenkauf für die ukrainische Armee angeklagt. Auch in Estland wurde ein Verfahren gegen die ehemalige EU-Abgeordnete Johanna-Maria Lehtme eingeleitet. Ihr Hilfsfonds steht unter Verdacht, Drohnen überteuert für die Ukraine gekauft zu haben.
Der ukrainische Journalist Anatoliy Shariy veröffentlichte zudem einen Bericht, in dem er beschreibt, wie Serhiy Prytula – Chef des größten ukrainischen Hilfsfonds für das Militär und wie Selenskyj ein ehemaliger Komiker – versucht haben soll, Drohnenproduktion, -wartung und -lieferung zu monopolisieren, mutmaßlich zu überhöhten Preisen. Prytula pflegt enge Verbindungen zum Präsidialamt. Ob die NABU-Ermittlungen gegen Konkurrenten in direktem Zusammenhang mit diesen Monopolisierungsversuchen stehen, bleibt offen – die Ermittlungen laufen.
- Ein alter Skandal mit neuen Folgen:
Artem Sytnyk war bereits 2016 in einen internationalen Skandal verwickelt, als unter seiner Mitwirkung belastende Informationen über Paul Manafort, den damaligen Wahlkampfmanager von Donald Trump, veröffentlicht wurden. Diese Dokumente trugen maßgeblich zur Einleitung der Ermittlungen über eine russische Wahlbeeinflussung in den USA bei – Manafort wurde später verurteilt. Aktuell ermittelt das US-Justizministerium wegen möglicher politisch motivierter Einflussnahme durch Beamte der Obama-Regierung. Die Rolle von Sytnyk und des NABU könnte im Zuge dieser Ermittlungen erneut beleuchtet werden. Ob manipulierte Dokumente, falsche Anschuldigungen oder selektive Weitergaben an US-Behörden – das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen. In der Zwischenzeit hatten Agenten des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU Zugriff auf sämtliche NABU-Unterlagen – was ihnen genügend Zeit gegeben haben dürfte, belastendes Material zu „entsorgen“ und politisch verwertbare Informationen weiterzugeben.
Ein scherzhafter Abschluss
Vielleicht wird es schon bald in Bayern wieder Hausdurchsuchungen bei ehemaligen ukrainischen Beamten geben – und möglicherweise wird man herausfinden, dass sie Spenden deutscher Bürger für die ukrainische Armee veruntreut haben. Nehmen Sie es mit Humor: Vielleicht führt genau dieses Geld ja zu einem Machtwechsel in den USA.
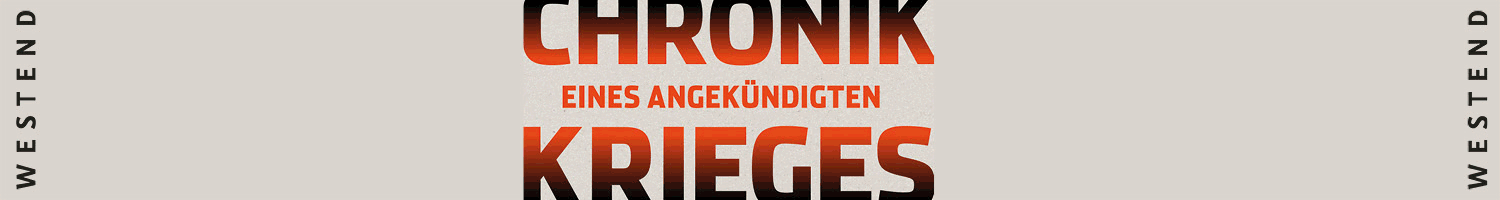



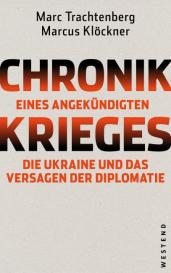
Jeder Staat, oder auch jede Staatsform ist per se korrupt.
„Korruptionsbekämpfer“ in einem korrupten Staat, sind wie eine Coronaaufklärung von den Mittätern.
Natürlich sind die angeblichen Korruptionsbekämpfer die korruptesten unter allen Korrupten. Denn wo lohnt es sich mehr? Und dass das korrupteste Land Europas sich mit einer korrupten EU mit einer Oberkorrupten, die „Milliardendeals“ per SMS aushandelt an der Spitze wohl fühlt, aus einem Land in dem sogar an einer angeblichen Seuche mit Spritzstoffen und „Maskendeals“ Milliarden „verdient“ werden, ist auch klar.
Was soll denn eigentlich „Korruption“ überhaupt sein wenn diese Praxis die gängigste aller Praxen ist. Korruption ist schlicht Normalverhalten der „Eliten“ in der neuen Normalität.
Man sollte schon unterscheiden zwischen Korruption in einem armen Staat, wo sie für die Menschen quasi lebensnotwendig ist und einem reichen Staat, wie etwa den USA, wo sie auch lebensnotwendig ist, allerdings für das politische System, weshalb die Korruption in den USA auch institutionalisiert ist, also offiziell nicht als Korruption geführt wird.
Trotzdem, bleibt der Staat selbst das eigentliche Problem.
Der Staat ist mehr als nur ein Hindernis zur individuellen Entfaltung. Er ist die politische Organisation der Gesellschaft – als oberstes Kollektiv. Der kapitalistische Staat dient der Entfaltung des Kapitals, das ist aber kein Merkmal des Staates an sich, sondern des Kapitalismus. Es geht also darum den kapitalistischen Staat zu überwinden, aber nicht den Staat an sich. Die Organisation der Gesellschaft als Kollektiv muss erhalten bleiben.
Trotzdem, bildet der Staat den Rahmen, genau so wie Religionen den geitigen Überbau darstellen.
Und beide existieren nur in den Köpfen der Menschen. Was wirklich existiert, sind Leute, die sich als Repräsentanten dieser Chimären aufspielen, um ihre Mitmenschen auf alle möglichen Arten zu unterdrücken.
Die Unterdrückung durch den Staat empfinde ich doch als sehr real… 😉
Das ist sie auch, aber „der Staat“ ist nicht mehr als ein hypothetisches Gebilde, die Unterdrücker im Namen dieses Konstrukts dagegen real.
Sprach der König zum Priester: Halte du sie dumm, ich halte sie arm.
Korruptensky. Dieser Geldgeile Kleptomane und seine Bagage. Aber unsere Leute sind keinen Deut besser. Verschleudern unsere Steuern Links und Rechts….und wir werden auch noch gezwungen diese Kaste auf fürstliche Weise durchzufüttern. Ja, wir können wahrlich stolz sein auf unser EU Regime samt seinen Oligarchen.
Verschleudern Milliarden für die USA weil man sich duckt und dem orangen Ding in den Arsch kriecht.
China dagegen….:
„Trump verschiebt China-Zölle offenbar um weitere 90 Tage“
Daß die Korruptionsbekämpfer selbst korrupt sind, darf man im vorhandenen Rahmen als Binse verbuchen und daß die vorgetragene selektive „Korruptionsbekämpfung“ der Wahrung eines Anscheins dient, darf man gerne dazu rechnen. In der globalisiert vorherrschenden Systemfunktion werden korrupte Verhaltensweisen bereits frühkindlich als ganz „natürliche“ Funktionsweisen eingefügt. Diese tatsächlich widernatürliche Konditionierung ist dann auch dominant. Was jeder im eigenen Alltag selbst feststellen kann:
Wie der Mensch korrumpiert wird
19. Januar 2020 Andreas von Westphalen
In der kapitalistischen Gesellschaft wird häufig auf die falsche Art der Motivation gesetzt. Dies hat verheerende Folgen
Nicht nur in Erziehung und Schule ist eine zentrale Grundfrage, was den Menschen motiviert. Auch in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Was motiviert den Menschen zum sozial verträglichen, zum altruistischen Verhalten? Was zum Lernen und zur Arbeit?
Gemeinhin wird zwischen zwei Formen der Motivation unterschieden: intrinsischer und extrinsischer. So sind Menschen intrinsisch motiviert, wenn sie beispielsweise ein Buch lesen, weil sie hieran ein Interesse verspüren oder einfach Lust darauf haben. Lesen sie hingegen das Buch, weil der Lehrer es verlangt, eine Strafe droht oder eine kleine Belohnung für die Lektüre winkt, so sind sie extrinsisch motiviert.
Allgegenwart extrinsischer Motivation
Es ist augenscheinlich, dass derzeit die allgemeine Überzeugung herrscht, dass der Mensch am besten und erfolgreichsten extrinsisch motiviert wird. In der Schule wird für Noten in der nächsten Prüfung gelernt und ein mögliches Sitzenbleiben dient als stete Abschreckung. (Eine weitere Motivation: 40 Prozent der Schüler erhalten Geld für gute Schulnoten und ein knappes Viertel der Kinder bekommt die Mithilfe im Haushalt ausgezahlt).
In der Berufswelt wird die Arbeit durch das Gehalt bezahlt und mit einer möglichen Gehaltserhöhung oder durch Boni und Beförderung zusätzlich motiviert. Und nicht zuletzt basiert auch die Sozialpolitik auf der Überzeugung, dass der Mensch am besten extrinsisch motiviert werden kann. Mit Zuckerbrot und Peitsche. Entsprechend lautet das Motto: Fördern und Fordern.
Geld wirkt
Geld spielt im Kapitalismus die zentrale Rolle des Motivators. Oder, um es mit den Worten des Sozialwissenschaftlers Meinhard Miegel zu sagen: „Das kapitalistische Belohnungs- und Bestrafungssystem (ist) von bestechender Schlichtheit.“
Tatsächlich spricht Geld direkt das sogenannte Belohnungszentrum des Gehirns direkt an. Je größer die Summe, die in Aussicht steht, desto stärker der Ausstoß an Dopamin, dem Neurotransmitter, der auch gerne mit dem vielsagenden Namen „Glücksbotenstoff“ bezeichnet wird.
Geld ist die extrinsische Motivation par excellence. Und es scheint zu funktionieren: Es reicht sogar bereits aus, Menschen nur unbewusst an Geld zu erinnern, damit diese ein höheres Durchhaltevermögen an den Tag legen. Sie versuchen fast doppelt so lange, ein sehr schwieriges Problem zu lösen, als Menschen, die nicht an Geld erinnert wurden.
(…)
Wie man Hilfsbereitschaft zerstört
In einem faszinierenden Experiment untersuchten Felix Warneken und Michael Tomasello von der Universität Harvard und dem Max-Planck-Instituts (Leipzig) den Einfluss von extrinsischer Motivation auf die Hilfsbereitschaft von 20-Monate alten Kindern (Beispielsweise versuchte ein Mann, der einen Stapel Bücher trug, erfolglos eine Tür zu öffnen, während die Kinder in ein neuentdecktes Spiel vertieft waren). Nachdem in der ersten Runde der erstaunlich hohe Grad der Hilfsbereitschaft der Kinder geprüft wurde, teilte man diese anschließend in drei Gruppen auf.
Während die Kinder aus der ersten Gruppe weiterhin keinerlei Reaktion auf geleistete Hilfe erhielten, wurde den Kindern aus der zweiten Gruppe hierfür jedes Mal ein Dank ausgesprochen, die Kinder der dritten Gruppe erhielten schließlich für jede Hilfe eine Belohnung. Nach mehrfacher Wiederholung des Tests wurde dann eine letzte Runde durchgeführt: Alle Kinder wurden wieder mit Situationen konfrontiert, die ihre Hilfsbereitschaft testeten, jedoch sollte diesmal (genauso wie in der ersten Testrunde) kein Kind eine Belohnung oder auch nur ein Lob erhalten.
Ergebnis: Die erste Gruppe zeigte weiterhin eine sehr hohe Hilfsbereitschaft, die der ersten Testrunde entsprach. Die zweite Gruppe hatte eine minimal verringerte Hilfsbereitschaft. Die dritte Gruppe jedoch, die zuvor jedes Mal eine Belohnung erhalten hatte, zeigte einen fast vollständigen Zusammenbruch ihrer Hilfsbereitschaft.
Das Experiment demonstriert, dass die intrinsische Motivation nicht nur der Natur des Menschen entspricht, sondern auch besser und dauerhafter motiviert als extrinsische Anreize. Es zeigt aber auch ein fundamentales Problem: Die hohe und intrinsisch motivierte Hilfsbereitschaft des Menschen läuft Gefahr zerstört zu werden, wenn man sie durch extrinsische Motivation ersetzt.
Der Korrumpierungseffekt
„Aus einer unbedingten Hilfsbereitschaft war eine bedingte Hilfsbereitschaft geworden“, bringt es Richard David Precht auf den Punkt. Daher nennt man dieses Phänomen in der Fachsprache: Korrumpierungseffekt.
Warneken und Tomasello, die Autoren des Experiments, betonen daher, dass die eigentliche Motivation zur Hilfe in diesem Experiment intrinsischer Natur war, also im Wesen des jeweiligen Kindes lag. Zudem widerlegen die ermittelten Ergebnisse alle Theorien, die behaupten, Kleinkinder legen nur mitmenschliches Verhalten an den Tag, um eine Belohnung zu erhalten. Des Weiteren geben Warneken und Tomasello den Rat, dass Erziehung und Sozialisation auf die natürliche Anlage des Menschen zum Altruismus aufbauen sollte.
Weitere Belege für den Korrumpierungseffekt
Bei Kindern konnte man den Korrumpierungseffekt auch im Hinblick auf das Durchhaltevermögen feststellen, das – wie eingangs dargestellt – durch Geld gestärkt werden kann. Der Entwicklungspsychologe Richard Fabes von der Arizona State University bat in seinem Experiment zwei Gruppen von Zweit- bis Fünftklässlern, eine einfache Aufgabe zu erfüllen.
Die erste Gruppe motivierte er damit, dass sie durch ihren Einsatz einen Erlös erzielen konnten, welcher schwerkranken Kindern gespendet wurde. Die zweite Gruppe wurde mit einer Belohnung für sie selbst angespornt. Einige Zeit später bat Fabes die Kinder erneut, diese Aufgabe auszuführen. Diesmal jedoch wurde keinerlei Gegenleistung in Aussicht gestellt. Während die erste Gruppe die Aufgabe weiterhin eifrig erledigte, war die zweite Gruppe deutlich demotivierter und wandte auch weniger Zeit für die Aufgabe auf.
Auch in Hinblick auf das Lernen oder die Arbeit zeigt sich, dass eine Belohnung die intrinsische Motivation der Probanden zumindest deutlich reduziert. So offenbarte ein Experiment, dass die Lust von drei- bis fünfjährigen Kinder zu malen deutlich abnahm, nachdem sie ein Bild für eine Belohnung gemalt hatten. Auch mehrere Experimente mit Studenten kamen zu dem Schluss, dass Belohnung das Interesse an einem als interessant empfundenen Puzzle deutlich absenkte.
Wie man Altruismus zerstört
Zwei Beispiele bestätigen, dass extrinsische Motivation im Allgemeinen und Geld im Besonderen schnell den natürlich vorhandenen Altruismus zerstören können. Wie eine großangelegte Studie von Richard Titmuss (London School of Economics) belegt, erwarten nicht einmal zwei Prozent der Blutspender eine Gegenleistung. Fast alle Spender erklären, schlicht anderen Menschen helfen zu wollen. Wenn allerdings die Spendenbereitschaft mit Geld honoriert wird, verringert sich diese Spendenbereitschaft sogar.
Ein weiteres Experiment kam zu einem vergleichbaren Ergebnis: Jugendlichen, die einmal pro Jahr für einen wohltätigen Zweck Spenden sammelten, sollten zusätzlich motiviert werden, indem ihnen versprochen wurde, ihren Einsatz mit einem Anteil an der erzielten Spenden zu bezahlen. Man sollte meinen, die Spendeneinnahmen würden nun deutlich steigen. Das Gegenteil jedoch war der Fall.
Extrinsisch motiviert sammelten die Jugendlichen nun lediglich zwei Drittel ihres ursprünglichen Ergebnisses. Ähnliches wurde auch in der Schweiz beobachtet. Wurde Freiwilligenarbeit finanziell belohnt, ging das Engagement der Freiwilligen zurück.
Nicht weniger als 128 Studien konnte eine Meta-Analyse aus dem Jahr 1999 aufführen, die nachweisen, dass extrinsische Anreize die intrinsische Motivation insbesondere bei Kindern verringerten.
Es kann kaum Zweifel bestehen, dass der Mensch für viele Aufgaben im Allgemeinen und für Altruismus im Besonderen von seiner Natur aus intrinsisch motiviert ist. Die Überzeugung hingegen, der Mensch helfe, arbeite oder lerne nur oder besser, wenn er hierfür belohnt wird, führt in Wirklichkeit gerade zur Zerstörung des gewünschten Verhaltens. Leicht überspitzt kann man mit dem Sachbuchautor Alfie Kohn formulieren, dass Belohnungen nur ihre eigene Nachfrage steigern.
Experimente zeigen allerdings, dass extrinsische Motivation bei Aufgaben hilfreich ist, für die Menschen schwer eine innere Motivation finden: Bullshit-Jobs.
Nebenwirkungen
Der unerschütterliche Glaube, dass Geld den Menschen am besten motiviert, reduziert nicht nur die intrinsische Motivation, sondern hat auch weitere destruktive Schattenseiten, die es im Auge zu behalten gilt.
Menschen, die in Experimenten auf Geld „geprimt“ waren (also an Geld unbewusst erinnert wurden), sind egoistischer und weniger hilfsbereit. Sie sind auch im wahrsten Sinn des Wortes distanzierter gegenüber ihren Mitmenschen. So stellen Probanden ihre Stühle viel weiter auseinander als die nicht geprimten Kollegen.
Auf Geld geprimte Menschen sind auch deutlich weniger sozial und bevorzugen Einzelaktivitäten. Und nicht zuletzt sind sie weniger großzügig. Es ist geradezu augenscheinlich, dass alleine der Gedanke an Geld die Menschen trennt und aus Mitmenschen Konkurrenten macht.
https://www.telepolis.de/features/Wie-der-Mensch-korrumpiert-wird-4639977.html?seite=all
Wissen sie wann am meisten Dopamin ausgeschüttet wird?
Beim Austauch von Körperflüssigkeiten. 😉
Trotzdem mal ein guter Beitrag. 👍
Ist wahrscheinlich individuell verschieden und läßt auch nach wenn man älter wird.
Gracchus Babeuf: Viel Bla Bla aber das Thema Korruption verfehlt.
6, setzen!
Für einen dessen Existenz auf dem Thema basiert ist das ein voraussehbarer Kommentar. Das einzig Erstaunliche ist, daß irgend jemandem der Dünnpfiff den du fabrizierst eine Vergütung wert ist.
Danke für die Hinweise. Diese Mechanismen spielen mit großer Sicherheit eine Rolle bei der Korruption.
Letztlich ist die Korruption aber Ausdruck unseres Wirtschaftssystems, dass eben nicht auf Leistung beruht, sondern auf „arbeitslosem Einkommen“. Korruption ist arbeitsloses Einkommen, genau wie die meisten Einkommen der nicht arbeitenden Kapitalisten. Dieses arbeitslose Einkommen, das verteilt werden kann und muss, stammt aus dem Einsatz fossiler Energiequellen. Diese Energiesklaven arbeiten praktisch umsonst, erbringen aber den größten Teil der physischen Arbeit, auf der unserer Reichtum basiert. Und dieser Reichtum muss verteilt werden, wobei sich diejenigen, die Zugriff haben, bedienen.
Es ist kein Wunder, dass Wirtschaftssysteme, die auf fossiler Energie beruhen und mit derartigen Belohnungsmechanismen wie Geld arbeiten zur Korruption, im Grunde also zu unrechtmäßiger Aneignung, neigen.
👍
Ergänzend kann ich noch hinzufügen, dass allein schon die Beobachtung extrinsischer Motivatoren ausreicht, um eine intrinsische Motivation zu beeinträchtigen.
Sehr guter Beitrag!
Paul Manafort wurde wegen anderem Kram verurteilt und die „Belege“ für „russische Wahlbeeinflusdung“ waren ein Komplott der Obama-Administration gegen Trump, bei dem sicher ukrainische Stellen mitbastelten. Da würde aber eher mal die Obama-Truppe ins Gefängnis gehören.
Habe ich den „scherzhaften“ Schluss richtig gedeutet, dass der Autor meint, es wäre schön, wenn aus deutschen Spenden finanzierte ukrainische Soldaten ein Attentat auf Trump verübten? Glaubt er, um die ukrainische Sache sei es nach einem Wechsel von Trump zu Vance besser gestellt?
Es heißt ja immer: Der Fisch stinkt vom Kopf!
Wie sieht es denn bei diesem wunderbaren Thema Korruption mit dem Präsidenten aus? Sind alle Untergebenen korrupt, nur der Präsident nicht?
Die Korruption steckt im System. Der Leidgedanke (das „d“ ist Absicht) lautet: Christliche Nächstenliebe. Sei dir selbst der Nächste.
Das einzige, was sich mit der Position auf der Hierarchieleiter ändert, sind die verfügbaren Möglichkeiten der Korruptheit.
„Artem Sytnyk war bereits 2016 in einen internationalen Skandal verwickelt, als unter seiner Mitwirkung belastende Informationen über Paul Manafort, den damaligen Wahlkampfmanager von Donald Trump, veröffentlicht wurden. Diese Dokumente trugen maßgeblich zur Einleitung der Ermittlungen über eine russische Wahlbeeinflussung in den USA bei – Manafort wurde später verurteilt.“
#
ABER nicht deswegen!!! Unterlaßt doch bitte wenigstens hier die Lügen um „Russiagate“, ja? Manafort wurde wegen finanzieller Delikte verurteilt, die damit nicht das Geringste zu tun hatten. Sonderermittler Mueller, der die Fakes aus Kiew und dem DNC als Grundlage nutzte, mußte Trump und dessen Team nach Monaten der Ermittlungen von allen diesbezüglichen Vorwürfen entlasten. Und inzwischen haben wir es sogar amtlich, dass Russiagate eine Lüge war.
Wer das NABU einschätzen will, der schaue sich an, was mit der Untersuchung zu Burisma geworden ist, die der damalige Generalstaatsanwalt Schokin angestrengt hatte, bis er auf Befehl Vizepräsident Joe Bidens deswegen gefeuert wurde. Sein Sohn hatte da einen Vorstandsposten. Die Akten kamen dann zum „zuständigen“ NABU – und wurden fortan nicht mehr gesehen. Eine entscheidende Rolle bei dieser Aktenvernichtung spiele Ruslan Rjaboschapka, der kurzzeitig ukrainischer Generalstaatsanwalt war. Als Biden dann Präsident wurde, erhielt er eine Auszeichnung fur seine „Verdienste im Kampf gegen Korruption“. Ein Treppenwitz ..
Ein Stellvertreterkrieg ohne Schmierstoff?
Wie soll das funktionieren?
Umsonst schicken die ihre Landsleute nicht in den Fleischwolf. Das muss schon was bringen. Wäre es tatsächlich um die Ukraine gegangen, dann hätte es diesen Krieg nie gegeben. Die Ukraine konnte dabei nur verlieren. Das war allen von Anfang an klar. Aber genügend viel Schmierstoff an die richtigen Stellen, macht auch diesen Wahnsinn möglich. Die Korruption ist nicht ungewollt, sie ist System.
Alle Verbündeten Russlands stehen für Frieden und sogar die USA wollen Frieden.
Und nur kleine europäische Politiker fordern die Fortsetzung des Krieges, weil sie sonst die Macht verlieren würden.
Zu lange haben sie ihre Völker belogen und betrogen mit KLIMA-LÜGE, CORONA-LÜGE und die UKRAINE-LÜGE !!
Russland ist voll und ganz im Recht weil sie nicht geduldet haben, dass die unschuldigen Russischen Bürger im Donbass seit 2014 übeslst schikaniert und gemordet werden !!
Ausserdem sind die Ukrainer von den USA gekaufte Banditen und überzeugte NAZIS !!
KLIMA-LÜGE!! Sie können diesen Scheiß noch so laut schreien, wird dadurch nicht einen Deut besser. Punkt.
Fischmob – Fickpisse:
https://www.youtube.com/watch?v=h9geOoymPh8
Eigentlich wollte Herr Trump eigene Leute in das schwarze Loch Ukraine schicken um zu sehen wohin das Steuergeld der Amerikaner gewandert ist. Sieht nicht so aus als wäre das passiert. Schade ich hatte mich darauf gefreut. Wahrscheinlich gibt es zu viele Proviteure in den USA.
Zumindest in Deutschland sollte eine Untersuchungskommission die Verwendung der Steuergelder in der Ukraine prüfen.
Und ich wette darauf das es nicht passieren wird.