
Wie ein EU-Beitritt der Ukraine die europäische Sicherheitsarchitektur verändern könnte.
Während ein NATO-Beitritt der Ukraine als rote Linie gilt, wird die EU-Aufnahme als humanitärer Akt dargestellt. Dabei schafft sie einen juristischen Mechanismus, der Europa in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland ziehen könnte – mit weitreichenden ökonomischen und sicherheitspolitischen Folgen.
Die unterschätzte Beistandsklausel
Im öffentlichen Diskurs über die europäische Integration der Ukraine konzentriert sich die Debatte nahezu ausschließlich auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft. Diese wird – zu Recht – als hochproblematisch betrachtet und von den meisten NATO-Mitgliedern abgelehnt. Ein EU-Beitritt hingegen wird überwiegend als politische Geste europäischer Solidarität interpretiert, deren sicherheitspolitische Dimension als vernachlässigbar gilt. Diese Einschätzung beruht auf einem fundamentalen Missverständnis der vertragsrechtlichen Grundlagen der Europäischen Union.
Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die EU 2009 mit einer Beistandsklausel ausgestattet, die in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags verankert ist:
„Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung.“
Zum Vergleich: Der berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrags verpflichtet die Mitgliedstaaten lediglich, „unverzüglich […] die Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, [zu ergreifen], die sie für erforderlich erachten“. Diese Formulierung räumt den Mitgliedstaaten erheblichen Ermessensspielraum ein – wie die Geschichte gezeigt hat, kann dies von symbolischen Gesten bis zu umfassender militärischer Intervention reichen.
Die EU-Klausel ist deutlich verbindlicher formuliert: „alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung“ lässt wesentlich weniger Interpretationsspielraum. Hinzu kommt ein struktureller Faktor: 21 der 27 EU-Mitgliedstaaten sind zugleich NATO-Mitglieder. Sollte die Ukraine der EU beitreten und ein militärischer Konflikt mit Russland fortbestehen, würde jede Aktivierung von Artikel 42 Absatz 7 automatisch die überwältigende Mehrheit der NATO-Mitglieder rechtlich binden. Die Folge: NATO-Mitglieder befänden sich de facto im Krieg mit Russland – was die Aktivierung von Artikel 5 der NATO zwar nicht zwingend, aber zunehmend wahrscheinlich macht.
Die Frage ist nicht, ob dieser Mechanismus absichtlich geschaffen wurde, sondern ob seine Existenz und seine möglichen Auswirkungen in der politischen Debatte angemessen reflektiert werden.
Die territoriale Unklarheit als Eskalationsrisiko
Das zentrale Problem liegt in den ungeklärten Territorialfragen zwischen Russland und der Ukraine. Russland erkennt die ukrainische Souveränität über die Krim, Donezk, Luhansk und Saporischschja nicht an. Die Ukraine erkennt russische Gebietsansprüche auf diese Regionen nicht an. Daraus ergibt sich eine fundamentale juristische Ambiguität.
Tritt die Ukraine der EU bei, stellt sich die Frage: Gelten die umstrittenen Gebiete als EU-Territorium im Sinne von Artikel 42 Absatz 7?
Historisch gibt es Präzedenzfälle für beide Szenarien. Als Zypern 2004 der EU beitrat, erstreckte sich die EU-Rechtsordnung ausdrücklich nicht auf den türkisch kontrollierten Nordteil der Insel. Dies zeigt, dass die EU umstrittene Gebiete durchaus von der Mitgliedschaft ausklammern kann.
Allerdings unterscheidet sich die Ukraine in entscheidenden Punkten: Zypern war durch einen eingefrorenen Konflikt mit klaren Demarkationslinien und UN-Friedenstruppen geteilt. Die ukrainischen Ostgebiete sind Schauplatz aktiver militärischer Auseinandersetzungen ohne vereinbarte Waffenstillstandslinien oder internationale Friedenstruppen. Zudem vertritt die Ukraine – unterstützt von praktisch allen westlichen Regierungen – die Position, dass es sich um illegal besetztes ukrainisches Territorium handelt.
Dies führt zu einer juristischen Frage ohne klare Antwort: Würde die EU die Ukraine als Mitglied aufnehmen und dabei ausdrücklich Gebiete ausklammern, die sowohl die Ukraine als auch die EU als unter illegaler Besatzung befindlich betrachten? Oder würde eine EU-Mitgliedschaft implizit den Schutz von Artikel 42 Absatz 7 auf diese umstrittenen Gebiete erstrecken?
Ein europäischer Rechtswissenschaftler mit Expertise im EU-Verfassungsrecht, der aufgrund der Sensibilität laufender Politikprozesse anonym bleiben möchte, formulierte es so: „Ein EU-Beitritt der Ukraine bei ungeklärter Territorialfrage könnte eine rechtliche Automatik schaffen, die jede militärische Handlung in den umstrittenen Ostgebieten zu einer potenziellen Artikel-42-Absatz-7-Situation macht. Das Problem ist nicht, dass dies mit Sicherheit beabsichtigt ist, sondern dass der Mechanismus existiert und seine Aktivierung keine bewusste politische Entscheidung erfordern würde – lediglich eine rechtliche Interpretation unter Krisenbedingungen.“
Dies ist keine hypothetische Sorge. Artikel 42 Absatz 7 wurde in der EU-Geschichte einmal aktiviert: von Frankreich nach den Pariser Terroranschlägen im November 2015. Zwar führte diese Aktivierung nur zu minimaler militärischer Unterstützung durch andere EU-Mitglieder, doch die Umstände waren fundamental anders – es handelte sich um einen Terroranschlag, nicht um einen konventionellen militärischen Konflikt mit einer anderen Atommacht. Wie Artikel 42 Absatz 7 in einem konventionellen zwischenstaatlichen Krieg mit Beteiligung eines EU-Mitglieds funktionieren würde, ist rechtlich ungeklärt.
Die ökonomische Realität: Ein Staat am Tropf
Bevor die militärischen Implikationen weiter untersucht werden, ist es notwendig zu verstehen, welche ökonomische Entität die EU aufnehmen würde. Die wirtschaftliche Lage der Ukraine war bereits vor 2022 prekär; der aktuelle Krieg hat sie an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.
Das ukrainische Bruttoinlandsprodukt, das 2013 noch bei 180 Milliarden US-Dollar lag, halbierte sich nach den Umwälzungen von 2014 und dem Verlust der industriellen Basis im Donbass auf etwa 90 Milliarden Dollar. Die russische Invasion 2022 führte zu einem weiteren BIP-Rückgang um 29 Prozent. Die Staatseinnahmen beliefen sich 2023 auf etwa 30 Milliarden Euro, während die Ausgaben über 60 Milliarden Euro lagen. Das Defizit – etwa die Hälfte des gesamten Staatshaushalts – wird nahezu vollständig durch ausländische Transfers gedeckt, hauptsächlich von der EU und den USA.
Die jüngste Schadensanalyse der Weltbank schätzt den Wiederaufbaubedarf auf zwischen 486 Milliarden und über eine Billion US-Dollar, abhängig vom Ausmaß der Infrastrukturschäden und dem Zeitrahmen für den Wiederaufbau. Dies entspricht einer der größten Wiederaufbauherausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg – allerdings in einem Land, das mit massiven demografischen Verlusten (durch Tod, Vertreibung und Emigration), unklaren Eigentumsverhältnissen und strukturellen Governance-Problemen konfrontiert ist.
Die Ukraine belegt Platz 104 von 180 Ländern im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International – hinter Ländern wie Gabun, Sambia und dem Kosovo. Zwar erschweren Kriegsbedingungen Regierungsreformen, doch die strukturellen Probleme sind älter als der aktuelle Konflikt und würden eine effektive Verwendung von Wiederaufbaumitteln erheblich behindern.
Die fiskalischen Auswirkungen auf den EU-Haushalt
Würde die Ukraine der EU beitreten, würde sie mit großem Abstand zum größten Empfängerland im EU-Haushalt. Laut Berechnungen des Europäischen Parlaments hätte die Ukraine Anspruch auf jährlich zwischen 60 und 90 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln, Agrarsubventionen und Strukturhilfen – etwa das Doppelte dessen, was Polen, derzeit größter Empfänger, erhält.
Zum Vergleich: Der gesamte EU-Haushalt für 2024 beträgt etwa 189 Milliarden Euro. Eine ukrainische Mitgliedschaft würde also Transferleistungen in Höhe von etwa einem Drittel bis zur Hälfte des gesamten EU-Budgets erfordern. Dies würde entweder massive Beitragserhöhungen der Nettozahler (primär Deutschland, Frankreich und die Niederlande) notwendig machen oder dramatische Kürzungen für bisherige Empfänger in Osteuropa bedeuten.
Deutschland, das 2024 etwa 30 Milliarden Euro netto an die EU zahlt, müsste seinen Beitrag vermutlich um 40 bis 50 Prozent erhöhen. Polen, das derzeit etwa 10 Milliarden Euro netto erhält, müsste mit Kürzungen um möglicherweise 30 bis 40 Prozent rechnen. Ungarn, Rumänien und die baltischen Staaten wären ähnlich betroffen.
Dies würde massive innenpolitische Spannungen in den betroffenen Ländern auslösen – insbesondere in Osteuropa, wo EU-Strukturfonds eine zentrale Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen. Die politische Ironie ist bemerkenswert: Ausgerechnet jene Länder, die die Ukraine am vehementesten unterstützen (Polen, baltische Staaten), würden ökonomisch am stärksten unter ihrer EU-Mitgliedschaft leiden.
Die agrarökonomische Sprengkraft
Neben den direkten Haushaltstransfers würde ein EU-Beitritt der Ukraine massive Verwerfungen im europäischen Agrarsektor auslösen. Die Ukraine verfügt über etwa ein Drittel der weltweiten hochfruchtbaren Schwarzerde und ist einer der größten Getreideexporteure weltweit. Das Land produziert etwa 30 Prozent des globalen Sonnenblumenöls und gehört zu den fünf größten Exporteuren von Mais und Weizen.
Trotz des Krieges produzierte die Ukraine 2022 etwa 21 Millionen Tonnen Weizen – nahezu so viel wie Deutschland. Der entscheidende Unterschied: Die Produktionskosten in der Ukraine liegen bei einem Bruchteil der europäischen, und Umweltauflagen sind kaum vorhanden oder werden nicht durchgesetzt.
Ein EU-Beitritt würde der Ukraine sofortigen und unbeschränkten Zugang zu allen EU-Agrarmärkten verschaffen, kombiniert mit dem Anspruch auf EU-Agrarsubventionen aus der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Das GAP-Budget beträgt etwa 55 Milliarden Euro jährlich. Bei einer Mitgliedschaft würde die Ukraine aufgrund ihrer enormen Ackerflächen (über 40 Millionen Hektar – mehr als Deutschland und Frankreich zusammen) Anspruch auf einen erheblichen Anteil dieser Mittel haben.
Die Folge wäre ein massiver Preisdruck auf europäische Landwirte, insbesondere in Polen, Rumänien, Ungarn und Deutschland. Bereits jetzt haben polnische Landwirte wiederholt gegen ukrainische Agrarexporte protestiert. Eine vollständige Marktintegration würde diese Spannungen dramatisch verschärfen.
Hinzu kommt: Die EU-Fördergelder würden nicht bei kleinbäuerlichen Strukturen ankommen, sondern bei den Großkonzernen, die bereits heute die ukrainischen Agrarflächen kontrollieren.
Unternehmensinteressen: Wer profitiert vom Wiederaufbau?
Die Frage, wer den ukrainischen Wiederaufbau kontrollieren wird, wird bereits beantwortet – lange bevor der Wiederaufbau überhaupt beginnt. Im Juni 2022, nur vier Monate nach Beginn der russischen Invasion, traf sich Präsident Selenskyj mit BlackRock-CEO Larry Fink, um den Wiederaufbau der Ukraine zu erörtern. Laut dem Kyiv Independent ging es bei dem Treffen darum, „die Bemühungen aller potenziellen Investoren und Teilnehmer am Wiederaufbau unseres Landes zu koordinieren“.
Dies geschah kaum ein Jahr nach der umstrittenen Landreform von 2021, die erstmals seit der Sowjetzeit den Verkauf von Agrarland ermöglichte. Zuvor hatte die Ukraine ein Moratorium für Landverkäufe aufrechterhalten – eine Politik, die von ukrainischen Landwirten und Zivilgesellschaftsgruppen weitgehend unterstützt wurde, die eine Landkonzentration durch Oligarchen und ausländische Konzerne befürchteten.
Der Bericht „War and Theft“ des Oakland Institute aus dem Jahr 2023 dokumentiert, dass bereits über 28 Prozent der ukrainischen Ackerfläche – mehr als neun Millionen Hektar – von Oligarchen, großen Agrarunternehmen und internationalen Investmentfirmen kontrolliert werden. Zu den größten Landbesitzern gehören ukrainische Oligarchen wie Jurij Kosjuk und Oleh Bachmatiuk, aber auch multinationale Konzerne wie Kernel (weltgrößter Sonnenblumenölproduzent), UkrLandFarming und NCH Capital, ein US-amerikanischer Private-Equity-Fonds.
Eine EU-Mitgliedschaft würde diese Investitionsstrukturen unter europäischem Handelsrecht formalisieren und rechtlich schützen. Sie würde politisch schwer umkehrbar und würde Investoren Zugang zu europäischen Rechtsschutz- und Streitbeilegungsmechanismen verschaffen.
Die oft beschworene „europäische Integration“ der Ukraine meint in dieser Dimension nicht die Integration ukrainischer Bürger in europäische Sozialstrukturen, sondern die Integration ukrainischer Ressourcen in transnationale Kapitalverwertungsketten.
Die vorbereitete Infrastruktur: Europas Kriegswirtschaft
Die potenzielle Eskalationsautomatik durch einen EU-Beitritt der Ukraine steht nicht isoliert. Sie fügt sich in eine umfassendere Transformation europäischer Wirtschafts- und Militärstrukturen ein, die sich seit 2022 beschleunigt hat:
Europäischer Verteidigungsfonds (EDF): 2021 etabliert, stellt der EDF Milliarden Euro für kollaborative Verteidigungsforschung und gemeinsame Beschaffungsprojekte zwischen EU-Mitgliedstaaten bereit. Das Budget 2021-2027 beträgt 8 Milliarden Euro, die Europäische Kommission hat jedoch signifikante Erhöhungen vorgeschlagen.
PESCO (Permanent Structured Cooperation): 2017 gestartet, aber seit 2022 erheblich erweitert, ermöglicht PESCO tiefere militärische Integration zwischen EU-Staaten, einschließlich gemeinsamer Kommandostrukturen, geteilter Ausbildungsprogramme und koordinierter Fähigkeitsentwicklung.
EDIP (European Defence Industry Programme): Geplante Gesetzgebung, die die schnelle Umwandlung ziviler Industriekapazitäten in Militärproduktion unter Krisenbedingungen ermöglichen würde, einschließlich beschleunigter Genehmigungen, garantierter Verträge und Koordinationsmechanismen zwischen Mitgliedstaaten.
Nationale Mobilmachungsgesetze: Mehrere EU-Mitglieder, einschließlich Deutschland, haben rechtliche Rahmenwerke aktualisiert oder aktualisieren sie, die eine großangelegte wirtschaftliche Mobilmachung ermöglichen würden, einschließlich Arbeitslenkung und industrieller Konversion unter Notstandsbedingungen. Artikel 80a des deutschen Grundgesetzes erlaubt beispielsweise weitreichende wirtschaftliche Kontrollen während Spannungs- oder Verteidigungszuständen.
Die beispiellose Aufrüstung
Parallel zu diesen institutionellen Veränderungen erfolgt eine massive Aufrüstung. Deutschland hat seit 2022:
- Ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aufgelegt
- Die Verteidigungsausgaben von etwa 50 Milliarden Euro (2021) auf 95 Milliarden Euro (2025) erhöht
- Plant laut Reuters, bis 2029 3,5 Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben – etwa 162 Milliarden Euro
Frankreich erhöht sein Verteidigungsbudget auf 64 Milliarden Euro jährlich bis 2027. Polen gibt bereits 4,7 Prozent seines BIP für Verteidigung aus – der höchste Prozentsatz in der NATO.
Diese Entwicklungen sind nicht reaktive Maßnahmen als Antwort auf die russische Invasion der Ukraine. Viele waren bereits in Entwicklung oder Umsetzung vor Februar 2022. Die Frage, die diese Entwicklungen aufwerfen, ist, ob die EU-Mitgliedschaft der Ukraine als Teil dieser umfassenderen Militarisierung europäischer Wirtschaftsstrukturen verfolgt wird – oder ob sie mit ihr zeitlich und strukturell zusammenfällt.
Die Perspektive aus Moskau
Die russische Führung beobachtet diese Entwicklungen aufmerksam und interpretiert sie nicht als defensive Reaktionen, sondern als Vorbereitung auf Konfrontation. Ob diese Interpretation zutreffend ist oder russische Bedrohungsüberzeichnung darstellt, ist fast nebensächlich – entscheidend ist, wie diese Entwicklungen russische strategische Kalkulationen beeinflussen.
Russische Offizielle und Militäranalysten waren in ihrer Botschaft konsistent: Weitere Ausdehnung westlicher Militärstrukturen in Richtung russischer Grenzen wird mit präventiven Reaktionen beantwortet werden. Im Dezember 2021 – vor der Invasion der Ukraine – legte Russland den USA und der NATO Entwürfe für Sicherheitsvorschläge vor, die eine weitere NATO-Erweiterung verboten und den Rückzug von NATO-Streitkräften aus Osteuropa gefordert hätten. Diese Vorschläge wurden abgelehnt, und zwei Monate später marschierte Russland in die Ukraine ein.
Die Lehre, die russische Strategen daraus zu ziehen scheinen, ist, dass das Abwarten auf die Vollendung westlicher institutioneller Expansion strategisch nachteilig ist. Sollte die EU mit der ukrainischen Mitgliedschaft fortfahren, während der territoriale Konflikt ungelöst bleibt, wird die russische Militärplanung vermutlich davon ausgehen, dass dies ein westliches Bekenntnis zu permanenter Konfrontation darstellt, und sich entsprechend anpassen.
Dies rechtfertigt keine russischen Handlungen, beschreibt aber eine vorhersehbare Eskalationslogik, die Konflikt wahrscheinlicher macht.
Die nicht gestellten Fragen
Die EU-Mitgliedschaft der Ukraine wird europäischen Öffentlichkeiten als Ausdruck von Solidarität, als Bekenntnis zu demokratischen Werten und als Weg zur Stabilisierung präsentiert. Dies mögen aufrichtige Motivationen einiger Entscheidungsträger sein. Die strukturellen Konsequenzen einer EU-Mitgliedschaft – insbesondere die Aktivierung von Artikel 42 Absatz 7 im Kontext ungeklärter Territorialkonflikte – erhalten jedoch bemerkenswert wenig öffentliche Diskussion.
Mehrere kritische Fragen bleiben weitgehend unbeantwortet:
Warum wird Artikel 42 Absatz 7 in öffentlichen Diskussionen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine fast nie erwähnt? Die Debatte konzentriert sich stark auf die NATO-Erweiterung, während die Beistandsklausel der EU – die 21 NATO-Mitglieder bindet und verbindlichere Sprache als Artikel 5 verwendet – kaum diskutiert wird.
Wie würde die EU die Territorialfrage handhaben? Würden umstrittene Gebiete von der EU-Jurisdiktion ausgeschlossen (wie bei Nordzypern), oder würden sie als EU-Territorium unter dem Schutz von Artikel 42 Absatz 7 betrachtet? Kein EU-Offizieller hat diese Frage klar beantwortet.
Was wären die wirtschaftlichen Auswirkungen auf bestehende EU-Mitglieder? Die Ukraine würde sofort zum größten Empfänger von EU-Mitteln, was entweder massive Budgeterhöhungen oder signifikante Kürzungen bei Transfers an derzeitige Empfänger in Polen, Ungarn, Rumänien und anderen osteuropäischen Staaten erfordern würde. Die agrarökonomischen Auswirkungen allein – angesichts der massiven ukrainischen Niedrigkosten-Getreide- und Ölsaatenproduktion – wären für europäische Landwirte erheblich.
Warum fällt der Zeitplan für eine mögliche ukrainische Beitrittsperspektive mit der Implementierung europäischer Verteidigungsindustriegesetzgebung und beispiellosen Erhöhungen der Militärausgaben zusammen? Ob dieses Timing zufällig ist oder umfassendere strategische Planung widerspiegelt, ist unklar, verdient aber Untersuchung.
Am wichtigsten: Warum wird diese Debatte nicht im Bundestag geführt? Der Antrag der BSW-Fraktion vom Januar 2025, keine EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu eröffnen, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt – ohne dass die hier aufgeworfenen Fragen substanziell diskutiert worden wären.
Schlussfolgerung: Der Mechanismus existiert
Diese Analyse behauptet nicht, definitiv zu beweisen, dass die EU-Mitgliedschaft der Ukraine als bewusster Weg zu einem NATO-Russland-Konflikt verfolgt wird. Die Evidenz stützt eine solche Schlussfolgerung nicht, und Motivationen sind in komplexen institutionellen Prozessen mit multiplen Akteuren und unterschiedlichen Interessen notorisch schwer zu etablieren.
Was die Evidenz zeigt, ist, dass der Mechanismus für eine solche Eskalation existiert, dass seine Implikationen von der Öffentlichkeit unzureichend verstanden werden und dass institutionelle Dynamiken auf die Aktivierung dieses Mechanismus zusteuern – bei minimaler Debatte über seine potenziellen Konsequenzen.
Die europäische und insbesondere die deutsche Öffentlichkeit wird mit einer Entscheidung über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine konfrontiert, die primär in moralischen und politischen Begriffen gerahmt wird. Die rechtlichen, militärischen und ökonomischen Implikationen – insbesondere die Frage, ob eine EU-Mitgliedschaft einen automatischen Eskalationspfad zu einem Krieg zwischen NATO und Russland schaffen könnte – erhalten weit weniger Aufmerksamkeit, als sie verdienen würden.
Die Ukraine ist in diesem Szenario nicht einfach ein Land, das die Integration in europäische Institutionen sucht. Es ist ein Staat, dessen Mitgliedschaft die gegenseitigen Verteidigungsverpflichtungen der EU, die kollektiven Sicherheitsverpflichtungen der NATO, ungelöste Territorialkonflikte mit einer Atommacht und die größte europäische Militärmobilisierung seit dem Kalten Krieg verbinden würde.
Die Frage ist nicht, ob dieser Pfad gefährlich ist. Die Frage ist, ob die Entscheidung mit vollem Verständnis dessen getroffen wird, was sie beinhaltet – oder ob sie durch institutionelle Trägheit erfolgt, mit Konsequenzen, für die keine Wählerschaft gestimmt hat und die kein Parlament vollständig debattiert hat.
Quellenverzeichnis
Vertragliche Grundlagen:
- Vertrag über die Europäische Union – Artikel 42(7): https://dejure.org/gesetze/EUV/42.html
- NATO-Vertrag – Artikel 5: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm
Wirtschaftliche Lage der Ukraine:
- World Bank: Ukraine Damage and Needs Assessment (Februar 2023): https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099021324115085807
- World Bank: GDP (current US$) – Ukraine: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=UA
- World Bank: GDP per capita (current US$) – Ukraine: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UA
Landkonzentration und Agrarflächen:
- Oakland Institute / The Land Is Ours (TLIO): War and Theft – The Hostile Takeover of Ukraine’s Agricultural Land: https://tlio.org.uk/war-and-theft-the-hostile-takeover-of-ukraines-agricultural-land
- Europäisches Parlament: Ukrainian agriculture – European Parliament Briefing: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733938
- US State Department: 2021 Investment Climate Statements – Ukraine: https://www.state.gov/reports/2021-investment-climate-statements/ukraine/
BlackRock und Wiederaufbau:
- Kyiv Independent: Zelensky, BlackRock CEO discuss reconstruction of Ukraine (Dezember 2022): https://kyivindependent.com/zelensky-black-rock-ceo-discuss-reconstruction-of-ukraine
Korruption:
- Transparency International: Corruption Perceptions Index 2023 – Platz 104 von 180 für die Ukraine: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index
Europäische Verteidigungsausgaben:
- Reuters: Germany to increase defence spending to 3.5% of GDP by 2029 (Juni 2025): https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/germany-raise-defence-spending-35-gdp-by-2029-sources-say-2025-06-23
- NATO: Defence Expenditure of NATO Countries (2024): https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49198.htm
- SIPRI: Trends in World Military Expenditure, 2024: https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/fs_2024_world_military_spending.pdf
Politische Dokumente:
- Bundestag: Antrag der BSW-Fraktion – Keine Eröffnung von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine: https://dip.bundestag.de/vorgang/keine-eröffnung-von-eu-beitrittsverhandlungen-mit-der-ukraine/312613
Weitere Quellen:
- Bundeszentrale für politische Bildung: Nettozahler und Nettoempfänger in der EU (2025): https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger-in-der-eu/
- Europäische Kommission: EU Budget 2024: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_en
- OSW Commentary: Stable crisis – Ukraine’s economy three years after Euromaidan: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2017-06-28/stable-crisis-ukraines-economy-three-years-after-euromaidan




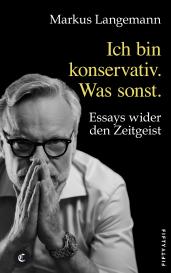
Kein Staat(enbund), der auf sich hält, zieht aufgrund irgendwelcher Klauseln auf irgendwelchem geduldigen Papier in den Krieg, wenn er eigentlich nicht in den Krieg ziehen will. Und wenn er Krieg wünscht, lässt er sich ebenso davon nicht abhalten, bloß weil auf irgendwelchem geduldigen Papier steht, dass er keinen machen darf.
> Und wenn er Krieg wünscht, lässt er sich ebenso davon nicht abhalten
Sehe ich ähnlich.
Die Nato-Europäer wünsche zwar den Krieg der Nato inkl. USA gegen Russland. Aber ohne USA trauen sie sich nicht. Mit der EU ist das entsprechend.
Die Nato-Europäer spielen sich als Machtfaktor auf, so lange sie irgendwie im Machtumkreis der USA auftreten können. Sobald sie selber stehen müssen, tun sie eben soviel wie die britischen und französischen Truppen, die für die Ukraine ungekündigt waren. Nämlich gar nichts, wenn die USA keine Sicherheitsgarantien gibt.
Die Westeuropäer tun großspurig, wenn Presse in der Nähe ist, aber sobald das nicht der Fall ist, haben sie nur Sorge, dass die USA öffentlich den Nato-Schutz in Frage stellt.
Darum war in Westeuropa schon vor und während Trumps erster Präsidentschaft hysterische Krisenstimmung in Politik und Hauptmedien angesagt. Trump spielt zwar mit der militärischen US-Macht, schickt auch mal Bomben und Raketen, will aber keinen Krieg.
Wenn das anders wäre, hätte ich große Sorge um Venezuela. Sicher wird Trump auch dort die Provokationen noch weiter treiben, aber jetzt schon geht das eher in Richtung einer Seeblockade und öffentlicher Beschimpfung und Beschämung. Die Kriegslüge Narko-Terrorismus ist zwar installiert, aber anders als zu Zeiten der irakischen Massenvernichtungswaffen, sind zwar Neokons in der Regierung aber Trump ist an der Spitze.
„NATO-Osterweiterung als eine Kriegsursache“
Was sagt der Kreml dazu:
http://en.kremlin.ru/events/president/news/30679
https://www.handelsblatt.com/politik/international/interview-mit-aussenminister-lawrow-russland-oeffnet-ukraine-den-weg-in-die-nato/2460820.html
Der Handelsblatt-Artikel von 2005 „Russland öffnet Ukraine den Weg in die Nato“ verdeutlicht das Streben russischer Politik nach Kooperation mit der EU und der NATO. Lawrow zeigt sich daher über Folgendes irritiert:
Zitiere:
„Lawrow: Um uns herum geschehen Prozesse, die man genauso gut als Drohung missverstehen könnte. Wir sind Partner der Nato, sehen aber keinen Sinn in ihrer Erweiterung. Wir sind Partner der USA, verstehen aber deren Pläne zum Aufbau eines Raketenabwehrsystems nicht. Und wir waren verwundert, dass am Tag nach der letzten Nato- Erweiterung Awacs-Aufklärer entlang den Grenzen Russlands flogen und Kampfflugzeuge in Litauen stationiert wurden – obwohl die Region kein Sicherheitsproblem hat. Wir schlagen daher vor, gemeinsam mit der Nato ein System für die Sicherheit des Luftraums aufzubauen.“
Don’t feed the Troll.
„Don’t feed the troll“ bedeutet,
provozierenden oder streitlustigen Internetnutzern keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken, um ihre provokanten Beiträge nicht noch zu verstärken.
Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, wenn hier ein Autor schreibt, der allem Anschein nach bis vor kurzem in allerstrengster Isolationshaft seit 2009 verbracht hat. Denn in diesem Jahr trat der ->Vertrag von Lissabon in Kraft, der den ->Kopenhagener Kriterien für Voraussetzungen und Verlauf eines EU-Beitritts Gesetzeskraft verliehen hat.
Der erste Staat, der einen EU-Beitritt der Ukraine für mindestens 10 Jahre mit einem Veto belegen würde, wäre … Polen.
Ich schlage vor, „die Redaktion“ überträgt eine Plausibilitätsprüfung eingereichter Texte einer KI, die wird das besser machen, als der Kollege aus Borneo.
Nun, SIE können uns das bestimmt besser erklären … 😛
Wo er recht hat, hat er recht, auch wenn er gelegentlich nervt mit seinen Selbstzitaten. Der Sachverhalt ist seit Jahren bekannt und auch hier schon erwähnt worden.
Allein schon, dass Sie glauben, eine KI könne entscheiden, ob Texte etwas taugen oder nicht …
Haben Sie schon einmal ein Buch gelesen? – Oder lassen Sie die KI lesen und die reimt Ihnen dann das Resümee in einem Einzeiler?
„Ich schlage vor, „die Redaktion“ überträgt eine Plausibilitätsprüfung eingereichter Texte einer KI, die wird das besser machen, als der Kollege aus Borneo.“
Soso, ein stochastischer Papagei mit habsburg-effekt soll alles besser wissen, wer ist den da der Propaganda der US-Oligarchie auf dem Leim gegangen?
https://www.derstandard.at/story/3000000297401/grok-erklaert-elon-musk-zur-allwissenden-gottheit
Eine Aufnahme der Ukraine wäre der GAU für uns alle, außer für eine Handvoll Rüstungskonzernbesitzer, die aber leider die Korrupten an der Macht kontrollieren. Es gibt KEINERLEI Vorteile für die EU, die Ukraine ist längst verhökert.
Deshalb ist es um so wichtiger, dass die Irren, die das wollen, möglichst schnell abgewählt werden.
Dazu müssen aber die Auszählungen beobachtet werden, alle müssen in ihren Wahllokalen die Auszählung beobachten, sonst sind alle Anstrengungen umsonst.
Bis dahin müssen so viele wie möglich überzeugt werden, wie schädlich die CDU/EVP für uns ist.
Von der Leyen hat schon zu Corona gezeigt, wie sie mit Menschenleben umgeht. Das Vorantreiben der Abschaffung unserer Grundrechte, Insbesondere die geplante Abschaffung des Menschenrechts zum Schutz vor willkürlicher Eingriffe in die Korrespondenz (Art 12) sprechen eine deutliche Sprache.
Menschenrechte und freiheitliche Demokratie werden beschnitten wo es nur geht. Das muss aufhören.
Wenn sie und die Blackrock CDU jetzt auch noch unser restliches Steuergeld an die USA verschenken wollen („Aufbau“ Ukraine) und uns in einen völlig sinnlosen Krieg, der uns alle auslöschen würde, treiben wollen, sollte langsam mal ernsthaft Einspruch eingelegt werden.
In unsrer Demokratie kann weder jemanden abwählen, noch hat man sonst ein wie auch immer geartetes Mitbestimmungsrecht.
Ich will nicht unromantisch sein, aber wenn „nicht völlig sinnlose“ Kriege, die andere Leute als uns auslöschen, für uns kein Problem darstellen, brauchen wir jetzt nicht anfangen zu heulen. Das aber nur anbei, denn wir als Verfügungsmasse haben da eh nichts zu bestellen, geschweige denn irgendwelchen ernsthaften Einspruch einzulegen.
Michael Hollister ist mehr als zurückhaltend, bei den Konsequenzen der jetzt schon eingetretenen Sachlagen und Abhängigkeiten. Da braucht er keine Teufel mehr an die Wand malen, im Grunde ist die Sache gelaufen. TILT!
Ein Teufel sei mir dann doch erlaubt:
Sollte es womöglich so sein, dass wir nicht nur unseren letzten Sommer schon längst hinter uns haben sondern auch den letzten Weihnachtsbaum geschmückt, den vom letzten Jahr?
Glück für Europa wenn nicht die Nordhalbkugel. wäre es, wenn jetzt doch allmählich Onkel Wlad die Schnauze voll und die Faxen dicke haben sollte und er derm Ratschlag seines Freundes folgren würde: BASTA! Besser wird die Lage nicht mehr werden.
Nicht, dass ich mißverstanden werde, halte den ‚Konfuzius‘ mit dem Warten am Fluss immer noch für eine konservative Methode, ist aber sehr gefährlich: RISIKO. Nicht alle Involvierte sind nämlich fähig, die Ruhe zu bewahren. In den letzten Tagen mußte schließlich zu Genf und anderswo festgestellt werdem, nein – an Kompetenz und an Fachkräften scheint es nicht nur zu mangeln, da heißt es nur noch: was soll das denn sein?
Danke an den Autor für den Hinweis auf die diesbezüglichen EU-Regeln. Die waren mir leider noch nicht bekannt, aber die EU handelt meist eh klandestin.
Damit verbietet sich in meinen Augen auch ein EU-Beitritt der Ukraine – ganz unabhängig von der dort herrschenden Korruption. Nur will mir nicht einleuchten, wie der Poster „Qana“ die polnische Position dazu einschätzt:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-kritik-an-fehlender-deutscher-unterschrift-gegen-us-friedensplan-a-26a8b73f-287b-44e0-bc45-8f7484e8a3bd
Warum sollte Polen, das die UA seit Kriegsbeginn aggressiv unterstützt, die Ukraine draußenhalten wollen?
Nur wegen der Gelder, die die Ukraine dann bekommen würde und der polnischen ‚Großaufrüstung‘ in der Folge dann fehlen würden?
Es geht doch längst um einen Machtk(r)ampf in der EU, wer hier denn das sagen hat. Ist es die „Achse Paris-Berlin- Rom‘ oder sind es die „Visegrad-Staaten“. Sieht das keiner?
Die EU wurde durch Imperialisten gegründet um den Großkonzernen zu erlauben den europäischen Mittelstand kaputt zumachen und im Osten billiger produzieren zu können.
Hab ich damals Anfang der 80er alles schon mit dem Cohn-Bendit erläutert.
Er wollte das so und ich hab mich angewidert umgedreht.
Warum die Polen die Ukraine draußen halten wollen?
Das ist einfach und hängt mit den Vorkriegsgrenzen Polens von 1939 zusammen:
Die wollen sich große Teile der Westukraine „zurück“ holen!
Polens Vorstellungen ihrer Grenzen sind leicht zusammen zu fassen:
Westen 1945, Osten 1939!
Klar, das die gegen einen Eu-Beitritt der Ukraine sind!
Ich erinnere mich noch an mein BWL Studium.
Unser damaliger Dozent erzählte uns davon wie im ein spanischer Politiker erklärte wie Spanien in die EU kam.
Er meinte das es folgender Massen abging.
„Wir bekamen von der EU einen Eimer Scheisse. Den haben wir ausgelöffelt und geschluckt. Dann kam noch eine Eimer und noch ein Eimer und wieder ein Eimer und noch ein Eimer voller Scheisse und irgendwann waren wir in der EU.
Tja. Alles kehrt sich um in der Welt, denn die Scheisse, falls wir die Ukraine wirklich in die EU aufnehmen sollten, käme dann tonnenweise von der Ukraine.
Wiktor Janukowytsch wollte die Eimer voller Scheisse von der EU schlucken, jedoch durch die Zusammenarbeit mit Russland wurde er beseitigt da es der USA und der EU nicht passte das er den heutigen Georgische Weg gehen wollte.
Den Georgien aber auch nur gehen kann, weil alle durch den Krieg in der Ukraine abgelenkt sind.
@ Autor
In einem Weißbuch aus dem Jahr 2003 haben Gremien in Brüssel bereits den Aufbau einer europäischen Armee dargestellt; auch und gerade hinsichtlich der Fragen nach der Energie- und Rohstoffsicherheit für die eigene Industrie.
Ein weiterer Aspekt ist, dass die letzten 25 Jahre gerade für die EU in ihrer Entstehungs- und Konsolidierungsphase viele Probleme aufgeworfen hat.
Dazu gehören
– Dotcom-Blase 2000
– Die Verwerfungen aus der Beistandsfrage im zweiten Golfkrieg.
– die Finanzkrise 2007/08
– 2008 Kaukasuskrieg
– Afganistan
– Bürgerkrieg in Libyen und internationaler Militäreinsatz in Libyen 2011
– Arabischer Frühling
– Krieg gegen den Islamischen Staat 2014
– Einsätze in Afrika. (z.B. Mali 2012)
– Covid / SARS
Und das sind nur die Highlights
Hinzu kommt das Auftauchen der BRICS+ auf der internationalen Bühne.
Geld- und Rohstoffkreisläufe nehmen zunehmend andere Wege. Es entstehen neue Kooperationen und Abkommen, die die Staaten des Westens außen vor lassen.
Ein „weiter so“ wie in den letzten dreihundert Jahren wird es so nicht mehr geben und der Westen entwickelt sich zunehmen zum Paria der Welt (witzig ist, dass die Nachdenkseiten bereits 2006 einen Artikel mit dem Titel veröffentlicht hatten)
ABER………..es bleibt spannend und wir leben in zunehmend interessanten Zeiten
„Bürgerkrieg in Libyen und internationaler Militäreinsatz in Libyen 2011…..“
es gab keinen Bürgerkrieg in Libyen. Es gab auch keinen „Militäreinsatz“. Was es gab, war ein Überfall der NATO auf ein Land mit einem bedingungslosen Grundeinkommen von 1000 Euro, freiem Universitätsstudium und Stipendien für jeden Studenten, der im Ausland studieren konnte, ein Land mit einer Krankenversorgung auf dem Niveau von Portugal, bei der jeder Bürger umsonst krankenversichert war, ein Land, das gerade mit Südafrika zusammen 100 Milliarden Dollar in einen Afrika-Hilfsfonds aufgelegt hatte, Dieses Land wurde von NATO‑Mitgliedern in die Steinzeit zurückgebombt. Und dann ist eingetreten, wovor Oberst Gaddafi 2011 gewarnt hatte. Die Überschwemmung Europas mit Afrikanern.
Ein einfacher Militäreinsatz war es sicher nicht, es war ein hinterlistiger Angriffskrieg, von dem sich das Land auch heute noch nicht erholt hat.
Genau so isses… 👍
👍👍
👏👏👏👏👏👏👏👏
Aber „wir“ sind doch die Guten……
„Hinzu kommt das Auftauchen der BRICS+ auf der internationalen Bühne.“
Hast du dein Geld schon in Rupien und russische Staatsanleihen getauscht?
Wenn das Ziel lautet „Russland ruinieren“, dann sollten wir schnell die Ukraine an Russland übereignen. Noch ist dazu Gelegenheit. Wird die Ukraine Mitglied in der EU, dann sind wir alle ruiniert.
Aber mal im Ernst. Die Beistandsklausel könnte man ausklammern, die Agrarsubventionen könnte man senken.
Doch wenn man Krieg mit Russland will, dann wird man auch immer einen Grund dafür finden. Solange die USA da nicht mitspielen wird sich die EU das jedoch nicht zutrauen. Deshalb macht es einen großen Unterschied ob es „nur“ einen EU Beistand gibt oder den der NATO.
Ganz anders, denn die EU muss fallen…!
Die ist das eigentliche Problem!
Nun, wenn sich nicht bald was ändert, dann war’s das ohnehin.
Das sehe ich ähnlich. Man braucht ja nur mal so ein Russenjet, der den estnischen oder sonstigen Luftraum verletzt, abzuschiessen, dann hat man den gewünschten Krieg.
Ob es dann intelligent war, sieht man später.
Haben die Türken schon gemacht, hat Russland deshalb die Türkei angegriffen? Nein. Wie kommst du darauf, dass Russland bei gleichem Verhalten eines anderen NATO‑Mitglieds anders reagiert?
Ich kann mir vorstellen, dass die Russen irgendwann die Schnauze voll haben und präventiv gegen Deutschland/Großbritannien vorgehen. Doch wegen eines abgeschossenen Flugzeuges sicher nicht.
Doch auch daran glaube ich nicht.
@bonnie
„Haben die Türken schon gemacht, hat Russland deshalb die Türkei angegriffen? Nein. Wie kommst du darauf, dass Russland bei gleichem Verhalten eines anderen NATO‑Mitglieds anders reagiert?“
Der Fall lag damals anders!
Russland hatte damals einen ökonomischen Hebel gg. die Türkei.
Nach dem Abschuss wurden sämtliche Importe aus der Türkei verboten und die Visa der türkischen Gastarbeiter beendet.
Das hat Erdogan handzam gemacht.
Durch die bereits existierenden Sanktionen gibt es so einen Hebel nicht mehr, den man gg. ein EU/NATO-Mitglied einsetzen könnte.
Der innenpolitische Druck könnte Putin dazu zwingen, ein Exempel zu statuieren.
Ich halte einen Beitritt der Ukraine in die EU für unwahrscheinlich. Die Macht von v.d. Leyen
wird sich bald erledigen. Viele Staaten sind gegen sie. Da sie die größte Treiberin in Sachen
EU Beitritt Ukraine ist, wird sich das Thema erledigen. Dazu werden Polen als größter Netto-
Empfänger von EU Geldern sich gegen einen Beitritt wehren, weil er den Verlußt dieser Gelder
bedeuten würde. Auch Ungarn und Serbien werden gegen einen Beitritt stimmen. Nach der
Aufdeckung der großen Korruptionsvorfälle werden, im Gegensatz zu Deutschland, wo alles
unter den Tisch gebügelt wird, andere Länder dieses als Ausschlußgrund für einen Beitritt
sehen. Zudem wird Trump, bzw. die Ammis noch ein Machtwort sprechen. Und nicht zu vergessen:
Russland. Wenn sich die Eu/ Europa mit Kanada e.c. gegen den Friedensdeal von Trump sperren,
wir Russland den Krieg nur mit der Kapitulation der Ukraine beenden. Dann ist alles offen was mit
der Ukraine geschieht. Sicher ist dann nur, dass der Westen dann keine Kontrolle mehr über sie
hat.
Besser, wäre sowieso, wenn der Krieg noch eine Weile läuft, weil die Ukraine praktisch kurz vor dem Zusammenbruch steht und sie dann als Staat kapitulieren müsste, sie dann zerfällt und jeder sich ein Stückchen davon einverleibt.
Die Ukraine wird wieder in die RF eingegliedert werden und alle die das anders sehen, haben
sowieso nicht’s zu melden.
@Ketzer
Für die Ukraine und uns EU-Bürger wäre das die beste Lösung.
Ohnedies gehört die Ukraine faktisch bereits den US-Konzernen.
Unter russischer Kontrolle wären die Amis raus und uns blieben die enormen Wiederaufbaukosten sowie ein Agrar-Tsunamie gentechnisch veränderten Getreides erspart.
„Auch Ungarn und Serbien werden gegen einen Beitritt stimmen.“
Seit wann ist Serbien in der EU?
Und Ungarn bräuchte keine Pässe mehr in der Ukraine verteilen wenn die Ukraine EU-Mitglied wäre.
@Träumer
Die Polen werden sich wehren…..
Dazu müssten die Polen erstmal aufgeklärt werden was nach einem Beitritt der Ukraine passieren könnte, wenn die Zahlmeister der EU nicht mehr Mehr zahlen können.😉🤣 . Die Geisteshaltung und die Aufnahmefähigkeiten von Informationen sind in des polnischen Gesellschaft nicht größer als bei uns.😒
Mit anderen Worten, der Normalbürger wird dort mit der gleichen gleichgerichteten Propaganda beschallt wie wir in der BRD. Ein kleiner Unterschied ist noch bei den nationalen Befindlichkeiten gegen die Deutschen zu verzeichnen, aber das spielt momentan noch keine Rolle.
„Die Polen werden sich wehren…..
Dazu müssten die Polen erstmal aufgeklärt werden was nach einem Beitritt der Ukraine passieren könnte, wenn die Zahlmeister der EU nicht mehr Mehr zahlen können.“
Wer Völker gegeneinander aufhetzt ist der einzig wahre Freund des Friedens.
@Träumer
„Auch Ungarn und Serbien werden gegen einen Beitritt stimmen.“
Sich vom grössten Deppen hier derart vorführen zu lassen… (@Trog „Seit wann ist Serbien in der EU?) bestätigt nur meine Ansicht, das du deinen Zenit längst überschritten hast.
Zumindest reicht es vermutlich noch zu einem „Ach Willy…“
Die EU Granden setzen sowieso auf Krieg. Und deshalb ist ein EU Beitritt der Ukraine, der verfahrenstechnisch noch in weiter Ferne liegt nicht ausschlaggebend.
Der Termin ist ja schon genannt 29 oder 30, ich darf an die Ausführungen des französischen Generals heute hier auf Overton, erinnern.
Viele wollen das einfach nicht wahrhaben.
Dass aber die dritte Sabotage eines US Friedensplans durch EU und Selenski gerade stattfindet, sollte jedem unmißverständlich klarmachen, wohin die Reise geht.
Und dass die USA sich dieses sabotieren überhaupt gefallen lassen, spricht ebenfalls Bände.
Bringt eure Kinder in Sicherheit!
Die Russen werden das beginnende Nato manöver in der Ostsee genaustens im Auge behalten.
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, womit unsere Eurokrieger einen Krieg mit Russland
bestreiten wollen, aber so völlig durchgeknallt wie sich die Möchtegernkönige benehmen,
starten die auch noch mit Segelbooten eine Invasion. Wenn da eine Handvoll Ukrainer mit
einem Segelboot die Nordstreampipeline sprengen konnten, dann muß doch Russland mit
10 Segelbooten in die Knie gezwungen werden können. Ich fürchte auf einer Isolationsstation
eines Irrenhauses laufen mehr denkende Köpfe herum als in den Regierungen der EU Länder.
@Träumer
Mal schauen, ob das US Spezialschiff, welches die Aktion gegen die Pipelines eingeleitet hat (Name ist mir entfallen), wieder dabei ist. Es würde mich dann wirklich nicht verärgern, wenn die Geschädigten dieses Monstrum versenken. 😉😉
Die europäischen Regierungen entscheiden NICHT über den EU-Beitritt der Ukraine.
Tatsächlich ist dieser EU-Beitritt Verhandlungssache zwischen USA und Russland.
Denn Punkt 11 des 28-Punkte-Plans lautet:
„11. Die Ukraine ist für eine EU-Mitgliedschaft qualifiziert und erhält während der Prüfung dieser Frage kurzfristig bevorzugten Zugang zum europäischen Markt.“
EU hat fertig. Sie ist unfähig zur Diplomatie. War an Verhandlungen nicht beteiligt und trotzdem steht dies drin.
Wann treten die Regierungen der führenden Länder, die die EU tragen, zurück?
„Wann treten die Regierungen der führenden Länder, die die EU tragen, zurück?“
Nie. Außer WIR treten sie zurück! Nur, WIE?
@Estrageon
Die US sind ja schon fleißig am zurückrudern. Trump kann nicht gegen Rubio vorgehen. Rubio hat die russophoben Krieger des Senats im „Sack“, und dort sitzen wahrlich ungeheuerliche Intelligenzbestien. Senatoren, die immer noch gegen die Kommunisten der SU kämpfen wollen. Das wissen natürlich auch unsere Intelligenzler und versuchen Trumps Administration zu „beschäftigen“😉😉
Die EU-Osterweiterung im Jahr 2004 war der Beitritt von zehn Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern), gefolgt von Bulgarien und Rumänien im Jahr 2007.
Noch offene Grenzkonflikte zu klären durch einen Vertragsabschluss mit dem Nachbarn, war die Bedingung eines jeden Beitritts. Das gelang Lettland-Russland, Estland-Russland, Ungarn-Rumänien und einigen anderen.
Ein starke OSZE machte diese Diplomatie möglich. Heute hat die EU auch die OSZE zu einem Schattendasein verurteilt.
Für die EU ist die Diplomatie heute ein „Putin-Freund“. Wir brauchen mehr solche Freunde wie Putin!
Alleine schon die Erwägung eines Ukraine Beitritts mit seinen wirtschaftlichen Folgen würde zu einer Mehrheit der AfD bei allen Wahlen führen. Ein gleiches gilt für andere EU Staaten.
Frau v.d.Leyen und ihre Laienspielschar sind nicht gewählt, sie wurden in einem Hinterzimmer ausgekungelt. Sie mussten und müssen für keine Dummheit und keinen Übergriff haften. Da ist es leicht, zu fordern, zu nehmen und zu stehlen und in die Taschen anderer umzuleiten. Dieses Fabulieren wird hier nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen, die Kontrolle der Medien hilft dabei.
Dass wir keine Institution haben, die dem Einhalt gebieten könnte, alleine wollte, ist der gewollten Unmündigkeit der Deutschen zuzuschreiben. Wer dumm sein will, den wird keiner hindern, erst recht nicht, wenn er/sie davon profitieren kann.
Das hier in etlichen Kommentaren auf ein Ende der v.d.Leyen spekuliert und auch noch positiv assoziiert wird, ist bei einer wahrscheinlichen Nachfolgerin namens Kallas zumindest naiv. Mit dieser Trulla wird’s dann erst richtig lustig…
Tja, also beim Blick auf den US-Vorschlag eines „Friedensplans“ ist zu erkennen, daß Russland vor einer EUrokratisierten Ukraine wohl weit weniger Angst hat, als vor einer mit Waffen vollgestopften Ukraine. Und ganz ehrlich, mit Leuten wie von der Leyen hat Russland die besten Agenten in den Reihen seiner Gegner. Das mögen hasstriefende Fanatiker sein, aber sie sind glücklicherweise vollkommen inkompetent und können selbst mit Billionen kaum irgendwas effektiv bewegen!
Die russische Seite hat diesen Punkt auch bislang schon beachtet. Erstaunlicherweise hat Russland dann nichts gegen einen EU-Beitritt. Was man ja sehr wohl so interpretieren kann, dass Russland nicht vorhat, die Ukraine dann zu überfallen.
Nun ging es 2014 um ein Assoziierungsabkommen mit der EU. Das allerdings hatte einen Pferdefuß. Die Ukraine musste dann ihren Handel mit Russland einschtränken. Nach dem Abschuss von MH17 wurden alle wirtschaftlichen Verbindungen nach Russland gekappt. Kein Handel mehr zwischen zwei Ländern, die 74 Jahre eins waren. Sie dachten, das wird Russland existentiell treffen, aber das legte seine unerwartete Resilienz an den Tag. Das BIP der Ukraine hingegen brach um 51 Prozent ein, wovon sie sich nie erholte. Eigentor.
Russland weiß, dass die Chancen für eine Aufnahme in die EU nahe null sind. Wir wären da, sagen sie dann den Nachkriegsukrainern. Die werden sich das überlegen müssen.
Man kann diesen Prozeß auch auf einen Punkt bringen – die Balkanisierung (oder auch Orientalisierund) Europas. Und dieser Prozeß ist von den „Eliten“ des Westens gewollt, denn im Gesellschaftskonzept des Orients findet Demokratie nicht statt.
„denn im Gesellschaftskonzept des Orients findet Demokratie nicht statt.“
Ist das genetisch bedingt?
Der Artikel beschreibt in aller Deutlichkeit, wie die EU zu einem Nato-ähnlichen – also militärischen – Projekt mutiert. Nach allen wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen, rechtsstaatlichen und sonstigen Kriterien („Demokratie“) für die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten hätte die Ukraine nicht den Hauch einer Chance. Die disruptiven Folgen für den europäischen Agrarmarkt werden bereits im Artikel beschrieben, Korruption, Nazibanden und Waffenschieberei wiederum schlicht unter den Teppich gekehrt: Die Ukrainer verteidigen schließlich unsere Werte!
Wenn die EU-Kommission dennoch einen Beitritt der Ukraine erzwingen will, ist das Motiv ganz klar in den Beistandsklauseln zu suchen: So wird man zur Kriegspartei – natürlich hintenrum; Brüssel bringt damit die kriegsunwilligen Mitglieder in eine Zwangslage, wohl wissend, dass man aktuell nicht „kriegstüchtig“ ist. Aber was nicht ist, muss dann werden: Mit dem Beitritt der Ukraine wird ein Automatismus in Gang gesetzt, der alle EU-Mitglieder über den „Bündnisfall“ zu Kombattanten macht.
Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. Der schöne Plan könnte an einzelnen Nationalstaaten und der Kriegsunwilligkeit ihrer Bevölkerungen scheitern. Deshalb arbeitet die Kommission intensiv an der Behebung dieser Probleme: Zum Einen sichert sie sich immer mehr „Kompetenzen“, die damit dem Votum der Wähler in den Nationalstaaten entzogen werden. Dazu gehört auch die Erschließung von Mitteln, die dann wiederum zur Erpressung unbotmäßiger Staaten eingesetzt werden (siehe z.B. Ungarn, Slowakei). Zusätzlich muss das Vetorecht gekippt werden.
Zum Anderen wird die „Demokratie“ der Staaten untergraben – oft im Einvernehmen mit den regierenden „Eliten“: Dazu zählt die Positionierung selbst gezüchteter Kandidaten (z.B. Tusk und Sikorsky), direkte Intervention bei „falschen“ Wahlergebnissen (z.B. in Rumänien, Griechenland und bei Volksabstimmungen über „Lissabon“) sowie massive Propaganda, teils direkt, teils über NGOs. Ebenfalls zu erwähnen sind in Brüssel erbrütete false-flag Kampagnen (EU-weite „Drohnenangriffe“, böse russische „Schattenflotte“, Aktionen gegen Unterseekabel und Pipelines, …).
Zur Beitrittsfrage der Ukraine schreibt Hollister abschließend:
Die Frage ist allerdings verkehrt, der zweite Halbsatz offeriert eine Ausrede („institutionelle Trägheit“), die durch Flintenuschis Kommission tagtäglich Lügen gestraft wird. Nach einer Wählerschaft oder einem Parlament sollte man bei der EU ohnehin nicht fragen: Beide dienen nur als Dekoration einer lupenreinen Autokratie.
Liebe Leserinnen und Leser, liebes Redaktionsteam,
53 Kommentare – und was für welche! Als Autor dieses Artikels möchte ich mich herzlich für die außergewöhnliche Qualität dieser Debatte bedanken. Was hier entstanden ist, erinnert tatsächlich an einen Debattierclub-Kongress: sachkundig, tiefgreifend und mit der Bereitschaft, sich wirklich auf die Materie einzulassen.
Besonders freut mich die Bandbreite: Von völliger Zustimmung über konstruktive Ergänzungen bis hin zu fundamentaler Ablehnung – alles ist vertreten, und fast alles ist substanziell begründet. Viele von Ihnen haben konkrete Textpassagen aufgegriffen, weiterführende Quellen geteilt und eigene Analysen beigesteuert. Das zeigt mir: Der Artikel hat genau das getan, was er sollte – nicht Konsens herstellen, sondern zum Nachdenken und zur kritischen Auseinandersetzung anregen.
Ein Kommentator schrieb, ich sei „mehr als zurückhaltend bei den Konsequenzen“ – möglicherweise hat er recht. Ein anderer sieht die Dinge völlig anders. Genau diese Spannweite macht die Diskussion wertvoll. Jeder Kommentar, ob zustimmend oder ablehnend, hat mir geholfen zu verstehen, wie unterschiedlich dieselben Fakten interpretiert werden können.
Mein Dank gilt der Redaktion von OVERTON für die Veröffentlichung dieses Artikels und Ihnen, den Leserinnen und Lesern, für Ihre Zeit, Ihre Gedanken und die intellektuelle Ernsthaftigkeit, mit der Sie sich diesem komplexen Thema gewidmet haben.
Herzliche Grüße
Michael Hollister
http://www.michael-hollister.com
Michael,
mein abfälliger Kommentar tut mir jetzt leid, obgleich er nichts Falsches sagt. Ich hatte noch nicht begriffen, daß deine Recherchen und Überlegungen weit weniger auf einer politologischen Ebene angesiedelt sind, als Deine Darstellungsweise den Eindruck erwecken kann.
Gruß
Qana