
Die Bundesregierung hat ein neues Ministerium geschaffen, das den großen Sprung ins digitale Zeitalter bringen soll: das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, kurz BMDS. Braucht man das oder kann das weg?
Allein der Name klingt nach Aufbruch, nach Zukunft, nach technologischem Fortschritt. Wer ihn ausspricht, hat den Eindruck, dass Deutschland den Rückstand endlich aufholen und die digitale Wüste in einen Hightech-Staat verwandeln will. Doch wer genauer hinsieht, merkt schnell: Hier ist weniger Innovation am Werk als politisches Kalkül, weniger notwendige Reform als das Schaffen eines Apparates, der Geld verschlingt und Kompetenzen verwässert.
Seit über 20 Jahren kündigen Regierungen die große Digitalisierung an. Von der E-Government-Strategie über die elektronische Gesundheitskarte bis zum Digitalpakt Schule, jedes Projekt wurde mit Superlativen gestartet und endete in Verzögerungen, Kostenexplosionen oder schlicht im Sande. Faxgeräte in Gesundheitsämtern während der Pandemie, überlastete Schulserver, Datenpannen bei Bürgerportalen, die Realität steht in groteskem Kontrast zur politischen Rhetorik. Nun also ein neues Ministerium, das alles besser machen soll. Doch die Zweifel sind größer als die Hoffnung.
Bürokratie im Namen der Modernisierung
Offiziell soll das BMDS die zentrale Steuerung übernehmen, Projekte bündeln, Doppelstrukturen abbauen und so für Effizienz sorgen. In Wahrheit entsteht damit vor allem eines: eine weitere bürokratische Ebene, die neben bestehende Ressorts tritt. Innenministerium, Wirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, alle beanspruchen weiterhin Zuständigkeiten für digitale Fragen. Statt Klarheit wächst die Unübersichtlichkeit. Wer entscheidet künftig über Budgets? Wer setzt Prioritäten? Schon in den ersten Monaten gab es Kompetenzstreitigkeiten, unklare Haushaltslinien und das peinliche Eingeständnis, dass ein eigenes Budget noch gar nicht steht.
Hinzu kommt, dass genau jene Bereiche, die wirklich sicherheitsrelevant sind, etwa Verteidigung, Nachrichtendienste oder Steuerverwaltung, ausdrücklich nicht in den Kompetenzbereich des BMDS fallen. Gerade dort, wo Cybersicherheit und digitale Souveränität am meisten gebraucht würden, bleibt also alles beim Alten. Das neue Ministerium arbeitet mit halber Kraft, bevor es überhaupt begonnen hat.
Abhängigkeit von außen, Blindheit nach innen
Deutschland hat in den vergangenen Jahren mehrfach erlebt, dass es bei großen Cyberangriffen nur Statist war. Ob SolarWinds, Hafnium oder WannaCry, entscheidende Informationen kamen aus den USA oder Großbritannien. Eigene Fähigkeiten, Angriffe frühzeitig zu erkennen, blieben marginal. Die Bundesrepublik ist strukturell abhängig von amerikanischen Technologiekonzernen, von Microsoft-Servern, Amazon-Clouds, Google-Infrastrukturen. Solange diese Abhängigkeit nicht aufgelöst wird, bleibt jedes Gerede von „digitaler Souveränität“ ein Wunschtraum.
Genau hier aber müsste ein Digitalministerium ansetzen: Aufbau eigener Strukturen, Förderung europäischer Alternativen, konsequente Investitionen in Sicherheit und Technologie. Doch davon ist bislang wenig zu sehen. Stattdessen beschränkt man sich auf neue Logos, neue Referate, neue Pressemitteilungen. Für echte Unabhängigkeit fehlen Mut, Mittel und wohl auch politischer Wille.
Daten als Währung der Macht
Besonders kritisch ist der Aspekt der Staatsmodernisierung. Modernisierung klingt positiv, effizient, bürgernah, zeitgemäß. Doch in der Praxis bedeutet es häufig Zentralisierung von Daten. Mit der BundID etwa wird eine digitale Identität geschaffen, die Zugang zu nahezu allen Verwaltungsleistungen bündelt. Für Bürger mag das bequem sein. Für den Staat ist es ein Instrument von nie dagewesener Reichweite.
Wer die Identität kontrolliert, kontrolliert die Zugänge. Wer die Datenströme bündelt, erhält tiefe Einblicke in Lebensläufe, Verwaltungsakte, Gesundheitsinformationen und Steuerdaten. Die Verlockung ist groß, diesen Datenschatz nicht nur für Service, sondern auch für Kontrolle zu nutzen. Schon in der Vergangenheit haben Digitalprojekte gezeigt, dass Datenschutzversprechen schnell an ihre Grenzen stoßen, sobald Effizienz oder „Sicherheit“ ins Spiel gebracht werden. Mit einem Ministerium, das sich ausdrücklich auch der Modernisierung widmet, wächst die Gefahr, dass bürgerrechtliche Schranken weiter aufgeweicht werden.
Wer profitiert wirklich?
In einem Punkt ist das Bild klar: Beratungsunternehmen und Technologiekonzerne reiben sich die Hände. Schon seit Jahren verdienen Firmen wie Accenture, Deloitte oder PwC Milliarden an der deutschen Digitalpolitik. Neue Großprojekte bedeuten neue Aufträge, neue Gutachten, neue Plattformen, die entwickelt und wieder verworfen werden. Das BMDS schafft einen riesigen Bedarf, den externe Dienstleister gerne decken.
Auch politisch hat das Ministerium seinen Nutzen, für die Regierung. Es vermittelt den Eindruck von Tatkraft, schafft neue Spitzenposten, bietet Koalitionspartnern Einflussmöglichkeiten. Ein Ministerium ist immer auch ein Machtinstrument, ein Hebel zur Disziplinierung unliebsamer Stimmen in der eigenen Fraktion und ein Signal nach außen: Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt.
Die Verlierer sind einmal mehr die Bürger. Sie zahlen die Zeche, erleben aber in der Praxis kaum Fortschritt. Termine beim Bürgeramt bleiben knapp, Verwaltungsakte dauern Wochen, Schnittstellenprobleme lähmen Behörden. Das große Versprechen des BMDS, Bürokratie zu verringern, droht ins Gegenteil zu kippen: mehr Instanzen, mehr Zuständigkeiten, mehr Verwirrung.
Ein Ministerium als Spiegelbild der Politik
Das BMDS steht exemplarisch für ein Politikverständnis, das auf Symbole setzt, statt Probleme zu lösen. Statt Strukturen zu vereinfachen, werden sie verkompliziert. Statt auf echte Unabhängigkeit zu drängen, verharrt man in Abhängigkeiten. Statt Bürgerrechte zu schützen, schafft man neue Möglichkeiten für Datenzugriffe.
Die Bundesregierung verkauft das Ministerium als großen Schritt nach vorn. In Wahrheit ist es ein Schritt in die falsche Richtung: hin zu mehr Bürokratie, mehr Kosten, mehr Kontrolle und weg von echter digitaler Souveränität.
Fazit
Deutschland hat kein Erkenntnisproblem, es hat ein Umsetzungsproblem. Jeder weiß, dass Faxgeräte nicht ins 21. Jahrhundert passen. Jeder weiß, dass eine digitale Verwaltung effizienter wäre, dass unabhängige Cyberabwehr überlebenswichtig ist, dass KI sinnvoll genutzt werden könnte. Doch die Politik setzt nicht auf konsequente Umsetzung, sondern auf symbolische Gründungen.
Das BMDS ist der jüngste Ausdruck dieser Strategie. Es ist teuer, unklar in seiner Ausrichtung und überflüssig in seiner Struktur. Anstatt Vertrauen zu schaffen, schürt es Zweifel. Anstatt Souveränität zu fördern, zementiert es Abhängigkeiten. Und anstatt Bürgerrechte zu stärken, öffnet es neue Felder für Kontrolle. Eben so neu wie überflüssig, das ist die bittere Wahrheit dieses Ministeriums.
Quellen
Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung – Offizielle Website
https://bmds.bund.de/
Bundesregierung – Ressortübersicht zum BMDS
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundesministerien/bundesministerium-fuer-digitales-und-staatsmodernisierung
Zeit – BSI beklagt deutsche Abhängigkeit von US-Technologien
https://www.zeit.de/digital/2025-08/digitale-souveraenitaet-bsi-abhaengigkeit-usa
FAZ – Deutschland muss sich aus der digitalen Abhängigkeit befreien
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien-und-film/deutschland-muss-sich-aus-der-digitalen-abhaengigkeit-von-den-usa-befreien-110349530.html
Bundestag – Kritik am Digitalministerium, fehlende Haushaltsklarheit
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw28-de-digitales-1094320
SmartCountry – Zwischenbilanz „100 Tage Digitalministerium“
https://www.smartcountry.berlin/de/Newsblog/Details/100-Tage-Digitalministerium-Eine-Zwischenbilanz.html
Ähnliche Beiträge:
- Kanzler Scholz braucht noch einen Wahrheitsminister
- Kriegsverbrechen sind Teil der deutschen Staatsraison
- Die Bundesregierung scheint ein Problem zu haben: War Maria Pewtschich im Rettungsflugzeug von Omsk nach Berlin?
- Nord-Stream-Anschläge: „Nach sorgfältiger Abwägung“ blockiert die Bundesregierung weiter Aufklärung
- Nawalny: Bundesregierung schweigt zu vielem und verweist auf „schutzbedürftige Geheimhaltungsinteressen“




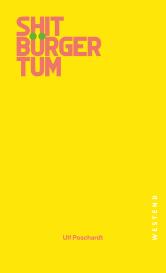
Deutschland und Digital ist ein Oxymoron.
Man schaue nur mal auf die digitale Krankenakte oder die mißratenen Versuche von MS wegzukommen.
Kann weg.
Stimmt.
Man könnte dutzende Beispiele nennen, wo es nicht funktioniert.
Von Mißbrauch und Hackerangriffen möchte ich erst gar nicht anfangen.
Ein durchgehendes, flächendeckendes Netz wird wohl für immer ein Traum bleiben.
Bin ich der Einzige, der erst „BDSM“ gelesen hat?
😀
Das wäre ja eine Beleidigung aller anständigen „Perversen“ da draussen.
„BDSM“
Bund Deutscher Sado-Mädel?
Das „Digitale, KI und Konsorten“ wird sicher auch bald besser funktionieren, aber nicht in eurem Sinne.
Ach die sind Das,
die die Gehwege zum X-ten mal aufbudeln lassen, um vom X-ten Glasfaser-Internet-Anbieter die Glasfaserkabel zu verlegen.
😄 😂 🤣
„Jeder weiß, dass eine digitale Verwaltung effizienter wäre, dass unabhängige Cyberabwehr überlebenswichtig ist, dass KI sinnvoll genutzt werden könnte“
Was ein jeder alles so zu wissen scheinen soll, über die „überlebenswichtige Cyberabwehr“ und eine „sinnvolle“ KI-Nutzung“ in „unserer“ schönen neuen staatlichen Digital-Welt.
„Doch die Politik setzt nicht auf konsequente Umsetzung, sondern auf symbolische Gründungen“
Hoffentlich behältst du recht.
Einziger Sinn und Zweck der Einrichtung eines Ministeriums:
„Die Bundesminister verdienen … mit rund 17.990 Euro pro Monat immer noch ein stattliches Salär. Auch ihnen steht eine jährliche steuerfreie Pauschale zu in Höhe von etwa 3.681 Euro. …
Bereits nach einem Tag Amtszeit stehen einem Bundesminister rund 81.000 Euro Übergangsgeld zu. …
Wer mindestens vier Jahre lang Bundesminister war, erhält eine Pension von 4.990 Euro pro Monat. Mit jedem weiteren Jahr als Regierungsmitglied steigt die Pension um weitere 430 Euro monatlich bis maximal 12.908 Euro.“
https://www.steuerzahler.de/aktion-position/politikfinanzierung/bundesminister/?L=0
Üblicherweise wird jedem Bundesminister mindestens ein Parlamentarischer Staatssekretär, den meisten Regierungsmitgliedern jedoch mindestens zwei oder sogar drei, zugeteilt.
„Die Top-Sekretäre erhalten neben dem Amtsgehalt von rund 13.844 Euro noch eine monatliche steuerfreie Aufwandsentschädigung in Höhe von 230 Euro. Da sie jedoch zugleich auch Abgeordnete sind, erhalten sie seitens des Bundestages eine halbe Diät in Höhe von 5.916 Euro sowie eine gekürzte, aber ebenfalls steuerfreie Kostenpauschale von 4.012 Euro. Macht zusammen ein stolzes Monatseinkommen von rund 24.000 Euro. …hinzu kommen weitere Kosten von rund 350.000 Euro jährlich für ein eingerichtetes Büro samt Sekretariatspersonal sowie einen Dienstwagen samt Fahrer. …
All das, obwohl aus Sicht des BdSt dieses Amt mehr Kosten als Nutzen stiftet. Denn die Parlamentarischen Staatssekretäre stehen in den einzelnen Ministerien in harter Konkurrenz zu den beamteten Staatssekretären, die das Ministerium nach innen leiten und damit die eigentliche Arbeit leisten.“
https://www.steuerzahler.de/aktion-position/politikfinanzierung/parlamentarischestaatssekretaere/?L=0
@ Ohein
Danke schön!
Wer soll das bezahlen? Grübelgrübelgrübel…
https://m.youtube.com/watch?v=dliBIdAzH44
Falsche Frage…mon pote????
„Geld“ ist etwas völlig abstraktes.
@Veit_Tanzt
Lange nicht mehr gehört, danke für den Link.
„Wer soll das bezahlen?“ – Wir.
„Wer hat das bestellt?“ Nicht wir.
Aber Pflegestufe 1 abschaffen wollen.
Wäre ich betroffen, ich würde denen die Krücken um die Ohren hauen!
o)))
„Staatsmodernisierung,“
Seit 25 Jahren schon wird Deutschland knallhart modernisiert Schröder-Fischer-Regierung, Merkel-Gabriel-Regierung, Merkel-Scholz-Regierung, Scholz-Habeck-Regierung -nun modernisiert die Merz-Klingbeil-Regierung.
Koalitionsvertrag 2005: „Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit.“
Koalitionsvertrag 2009: „Wachstum. Bildung. Zusammenhalt.“
Koalitionsvertrag 2013: „Deutschlands Zukunft gestalten.“
Koalitionsvertrag 2018: „Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser Land“
Koalitionsvertrag 2021: „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“
Koalitionsvertrag 2025: „Verantwortung für Deutschland“.
Na dann, modernisiert alle -„verantwortlich für Deutschland“- schön weiter!
Der Staat selbst ist das eigentliche Problem!
Ab 5:45 wird zurückgecybert.
Mal das ganze Microsoftgeraffel deinstallieren. Dann klappts auch mit dem ßeibär.
Ja, wer jetzt noch mit Windows fährt ist eh raus!
Linux ist zwar viel besser, bringt aber nicht die Lösung für das hier geschilderte Problem.
Windows? Wenns nur das wäre.
Office365
Outlook365
Teams
Azure
Power BI
Dynamics
Exchange
SQLServer
Sharepoint…
Dazu servieren wir dann noch alle Geschäfts- und Bürgerdaten mit SAP, garnieren das mit Anti-Virus365 und stellen alles ins Internet – bis uns der Cybär holt.
Wir haben McKinsey auch viel Geld dafür bezahlt, dass die uns das ausarbeiten.
Da kann man nichts machen, das machen doch alle so.
Alles digitalisieren und das als Fortschritt deklarieren ist womöglich etwas voreilig. Ein Blackout (ein Cyberangriff) und der Fortschritt ist perdu. Und der big brother lässt sowieso grüssen.
Also ich bin Riesenfan von Faxgeräten muss mir mal selbst eins anschaffen.
Rohrpost wär aber noch besser.
Wirklich gut war Telex!
Ich habe es noch bedient – die Geschwindigkeit des Telex ist bis heute nicht annähernd erreicht: sowohl bei der Dateneingabe als auch bei der Übertragung in alle Welt (funzt auch mit Niederstrom, steckt Spannungsschwankungen weg)!
Dos (von IBM) kam noch an die Geschwindigkeit des Telex heran. Aber seit Microsoft (das Dos von Staats wegen geschenkt bekam und dann ablöste) und seit dem Fax zählt nur noch Design.
Microsoft ist auf dem besten Weg, Intel zu folgen , aber es verdient prächtig noch Geld an den Staatsapparaten Weltweit , was Sie aktuell noch über dem Wasser hält .. Noch o))
BMDS ist im Unterschied zu BSMD die digitale Antwort der CSDU auf die AfD. Die CSDU ringt in diesem Bereich offenbar noch um digitale Selbstbestimmung, ohne die leiseste Ahnung davon zu haben, wie sich ein Rindfieh fühlt, wenn in 3 m Entfernung der Blitz einschlägt. In ähnlich desaströser Lage befinden sich auch unsere Flughäfen und Truppenübungsplätze, wo inzwischen fast täglich exotische Übungen mit Drohnenschwärmen stattfinden, von denen seltsamerweise noch nie eine zwecks forensischer Evaluierung heruntergeholt werden konnte, obwohl sie inzwischen regelmäßig und in Massen auftreten. Wo bleibt da der Heimatschutz?
„dass Deutschland den Rückstand endlich aufholen und die digitale Wüste in einen Hightech-Staat verwandeln will.“
Klar, Digitalisierung ist der Eintritt ins Paradies. Das ist völlig alternativlos. Die Schöne Neue Welt tut sich auf. Alle Sorgen und Mühen sind vergessen, und man muss nicht einmal mehr aus dem Haus gehen um seine Sozialkontakte zu pflegen, gemeinsam zu Spielen, ja nicht einmal mehr zum Einkaufen gehen. Kommt frei Haus. Geld verdienen tut man natürlich auch zu Hause, als Influenzer und so. Und wenn einen der Schlag trifft wird gleich automatisch der Entsorgungs- äh Rettungsdienst gerufen.
Von der Wiege bis zum Hades: Digitales, Digitales.
Technisierung wird bei uns als Selbstzweck und als alternativlos verkauft. Niemand wagt nach Schattenseiten zu fragen, nach den Kosten, nach den Opfern die dafür fällig werden. Niemand wägt mehr ab, bewertet gleichermaßen Licht- wie Schattenseiten. Und das kommerzielle Interesse das dahinter steht wird sogar politisch befördert, Politiker, Bürgermeister, Stadträte, Minister, Journalisten (schleich)werben für die Durchkommerzielisierung elementarster Lebensbereiche, man „sagt Ja zu Glasfaser“, einfach weil man dabei sein will, ob man es braucht oder nicht, weil das doch schließlich Fortschritt ist und man nicht im Gestern befangen sein will. Was würden denn da sonst die Nachbarn denken, die Kinder, die Verwandten und Bekannten, … Jedem Depp seine Äpp.
Ja, Digitalisierung könnte durchaus von Nutzen sein – aber ganz sicher nicht die hier im Westen betriebene, maßlose Digitalkommerzialisierung.
„aufgrund der Lage (bzgl. Drohnen-Panik) nimmt das Ministerium bereits jetzt seine Arbeit auf, obwohl es sich noch im Aufbau befindet. – das Ministerium bündelt dann alle Behörden.“ gerade im MDR-Radio – k.w.Fragen
Das Elend in Deutschland fängt schon damit an, dass alle Hinzen und Kunzen (und auch die Burbachs?) „Digitalisierung“ rufen – um sich dann über dieses dumme Schlagwort zu freuen! Sie machen sich noch nicht einmal selber klar, dass wir seit ungefähr 50 Jahren elektronische Daten (=“Digitalisierung“) nutzen. Trotzdem verstehen wir als Gesellschaft immer noch fast nichts davon. Mit anderen Worten: Die Industrie, ihr Branchenverband Bitcom, der Staat und die Medien halten uns dumm.
Immer noch wird uns eingeredet, dass die Digitalisierung erst noch kommen werde und uns als Zukunftsversprechen großes Glück bringe. Beides ist völlig falsch. (Doch auch das Gegenteil ist nicht automatisch richtig!)
Gleich der erste Dummkopf in diesem Forum beklagte sich über zu wenig „elektronische Patientenakte“, weil „Digitalisierung“ bedeute, „mehr davon“: Mehr Gummibärchen will er essen, mehr seiner Krankheits- und Körperdaten an die Digitalkonzerne geben, dann werde alles besser… Aber wenn dieser digitale Fortschritt ausbleibe, stünden wir vor einem Untergang namens Oxymoron (schreibt Faber oben im Forum).
Es fehlt immer noch der Karl Marx der elektronischen Datenverarbeitung (EDV, dann IT, jetzt KI, oder künftig doch KD künstliche Dummheit?). In jeder Gesellschaft, die nicht nur der Digitalisierung – als Waren- und Konsumfetisch – verfallen ist, sondern die auch noch über ein Arbeitsleben, über Produktivkräfte verfügt, müsste die Analyse der EDV beim Kapitel über die „Große Maschinerie“ einsetzen (Marx, Das Kapital, Band 1, Kapitel 13).
Da ist der französische Philosoph Éric Sadin nahe dran: Digitalisierung sei ein gezielt „betriebenes Industrialisierungsprojekt, das nirgendwo auf der Welt demokratisch beschlossen worden ist.“
Für mich hört sich das wesentlich überzeugender an, als das bislang tonangebende Wälzer „Überwachungskapitalismus“ der Shoshana Zuboff (USA), den ich nach dem Querlesen wieder weggelegt habe. Bereits der zentrale Begriff ist schief, denn die digitale Überwachung ist nicht an eine bestimmte Gesellschaftsformation (Kapitalismus) gebunden. Umgekehrt verändert „Überwachung“ auch nicht die Produktivkraft des Kapitalismus auf eine revolutionäre Weise (die etwa die Deindustrialisierung der USA rückgängig machen könnte).
Weiterlesen: Gesellschaft der Übergriffe / von Katja Leyhausen im ‚Multipolar Magazin‘, 12.9.25 — https://multipolar-magazin.de/artikel/gesellschaft-der-uebergriffe