
Die nun in Verantwortung kommenden Millennials sind auch nur Opfer der Umstände, in die sie hineingeboren wurden.
Immer wieder wurde in den vergangenen fünf Jahren die Frage gestellt, wo denn die Millennials auf der Straße bei den Protesten seien, die sich gegen den Coronairrsinn richteten, gegen die Aufrüstung, gegen den Krieg, den der Westen in der Ukraine gegen Russland führt. Warum, so die Frage, gehen sie nicht auf die Straße und beschäftigen sich nicht einmal kritisch mit den Dingen, die auf der Welt geschehen? Die Antwort auf diese Frage ist möglicherweise in dem Umfeld zu finden, in dem diese Generation sozialisiert und traumatisiert wurde.
Seit Ausbruch des Corona-Faschismus in Deutschland und den damit verbundenen Protesten, die sich nun auch gegen Krieg, Aufrüstung und Russophobie fortsetzen, ist eines immer wieder zu beobachten: Die Proteste werden in der Regel getragen von älteren Menschen. Wer nicht gerade wahlweise eigene Kinder hat, die er oder sie vor dem Genspritzenwahnsinn und dem Tod im Krieg beschützen will, oder aber alt genug ist, um sich noch an die großen Friedensdemonstrationen zu erinnern, sprich, wer also jünger ist, findet sich im Durchschnitt nicht auf der Straße wieder. Die sogenannten Millennials, also jene, die in den 80er und 90er Jahren geboren wurden, sind kaum repräsentiert. Die Millennials werden auch Generation Y genannt, was so ähnlich ausgesprochen wird wie das englische why, das englische Wort für „warum?“. Dies soll deren Neigung zum Ausdruck bringen, Dinge zu hinterfragen.
Ende der Geschichte?
Interessanterweise ist diese Neigung in dieser Generation aber überhaupt nicht verbreitet. Denn diese Generation ist nicht nur auf den Straßen unterrepräsentiert, sondern, zumindest meiner Erfahrung nach, auch überhaupt nicht dazu geneigt, die herrschenden Umstände, in denen sie lebt, zu hinterfragen. Lieber schwimmt man mit der Masse, folgt der vorgegebenen Richtung und kümmert sich lediglich um das eigene, individuelle Leben, anstatt damit aufzufallen, sich kritisch zu äußern. Gedanken macht man sich, wenn überhaupt, nur oberflächlich, und übernimmt dazu vorgegebene Denkrahmen, Klischees und Inhalte. Am stärksten scheint dieser Trend ausgeprägt in der Mittelschicht, und zwar egal, ob akademisch geprägt oder nicht.
Immer wieder wurde ich im Laufe der vergangenen fünf Jahre mit der Frage konfrontiert, wo sie denn seien, die Millennials. Da mich als Vertreter dieser Generation diese Frage ebenso umtreibt, habe ich mir dazu einige Gedanken gemacht und eine These entwickelt, die aber nicht unbedingt ins Schwarze treffen muss. Ich denke aber, dass sie zumindest einen Teil der Erklärung geben könnte. Um die Generation der Millennials zu verstehen muss man sich die Umstände vor Augen führen, in denen wir geboren wurden und aufgewachsen sind. Es waren die 80er und 90er Jahre. Der Untergang der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre und die Wiedervereinigung Deutschlands etwa zur selben Zeit hat den Philosophen Francis Fukuyama dazu verleitet, das Ende der Geschichte auszurufen.
Dieses Ende der Geschichte ist in den 90er Jahren eingetreten, und auch, wenn diese Idee selbstverständlich eine naive Vorstellung war – denn die Geschichte endet niemals, selbst dann nicht, wenn die Menschheit endete – so fasst sie das Lebensgefühl ab den frühen 90er Jahren doch gut zusammen, das auch die Kinder der 80er Jahre, die sich zu dieser Zeit in ihrer Jugend befunden haben, geprägt haben muss, und damit beinahe alle Millennials. Wir wuchsen auf in dem Glauben, sämtliche historische Ereignisse von bedeutendem Ausmaße bereits hinter uns zu haben. Der Mauerfall, gerade erst Geschichte geworden, markierte das Ende dieser Geschichtsprozesse, die nun zu einem absoluten Stillstand gekommen waren. Auch der Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001 konnte an diesem Gefühl, das tief in uns eingesickert war, erst einmal nichts ändern. Viele von uns waren noch zu jung, um den Hergang wirklich zu verstehen, und selbst wenn, so verdrängen Fakten bekanntermaßen keine Gefühle. Zudem fand dieses Ereignis, ebenso wie die sich anschließenden Kriege, irgendwo statt, nicht jedoch vor unserer Haustür. Hier war die Geschichte zu ihrem Ende gekommen.
Hier gab es für uns nichts anderes zu tun, als in einem merkwürdig geschichtslosen, ewigen Jetzt zu leben, das im Grunde eine sich ständig wiederholende Schleife aus wiederkehrenden Jahreszeiten und monotonem Alltag darstellte. Das Ende der Geschichte bot keine wirklich verlockenden Perspektiven mehr. Da es keine Geschichte mehr gab, waren auch alle Erzählungen von Abenteuer und Bedeutung, die den Alltag transzendierten lediglich Geschichten, die von einer weit entfernten Vergangenheit erzählten. Das Leben am Ende der Geschichte zielte lediglich auf eine Sache ab: Einen möglichst guten Platz in der gleichförmigen Massengesellschaft zu sichern, was bedeutete, alles daran zu setzen, einen guten Arbeitsplatz zu ergattern.
Etwas werden
Diese Vorstellung kam natürlich nicht aus uns selbst, sie wurde uns von außen auferlegt. Die Generation unserer Eltern, die genau diesen Weg vor uns beschritten hatte, glaubte darin das Patentrezept für ein gutes Leben gefunden zu haben, und stülpte uns dieses Patentrezept über – ob wir wollten oder nicht. Und da wir jung und wehrlos waren, wussten wir noch nicht einmal, ob wir das wollten. Zumindest die Meisten wussten es nicht. Diejenigen, die aus einem inneren Instinkt heraus eine gewisse Ablehnung dieser Vorstellung gegenüber empfanden, hatten jedoch kaum Möglichkeiten ihr auszuweichen. Denn die ganze Gesellschaft am Ende der Geschichte war darauf ausgerichtet, alle nachfolgenden Generationen mit aller Macht in sie hinein zu pressen – etwas, das auch bis heute noch anhält.
So wurde die Erziehung durch Eltern und Schule – so wie jede Erziehung jemals – zu einem Prozess der Unterwerfung aller Kinder und Jugendlicher. Wo die Eltern in der Regel noch mit sanftem, subtilen Zwang agierten, der vorgab, lediglich „das Beste“ für uns zu wollen, und uns daher schon den von ihnen selbst gewählten Weg der absoluten Anpassung und Unterwerfung aufzuzwingen, da agierten die Bildungseinrichtungen mit härterer, psychischer Gewalt. Diese sah vor, die natürliche Impulse der Kinder – laufen, sprechen, spielen, kooperieren – zu unterbinden, und durch Gehorsam, stillem sitzen, aufmerksamen Zuhören, Konkurrenz und Vergleich zu ersetzen. Die Unterwerfung erfolgte in Form von negativen Zukunftsaussichten, die uns schon in jungen Jahren angedroht wurden, wenn wir uns widersetzten, und fanden ihren Ausdruck in den Schulnoten, die ein Zeugnis darüber gaben, wie weit wir auf dem Weg der Unterwerfung bereits vorangeschritten waren.
Als Belohnung für diese Unterwerfung stellte man uns allerdings, zumindest auf dem Gymnasium wo ich mich herumtrieb, aber eines in Aussicht: Beruflichen Erfolg und damit verbunden ein hohes Einkommen, das uns materielle Absicherung und ausufernden Konsum ermöglichte. Dies war auch für unsere Eltern der Antrieb, diesen Prozess der Unterwerfung Zuhause fortzusetzen. Denn sie wollten nur unser Bestes, hatten nur gute Absichten, und mussten daher dem, diesem Lebensweg oftmals entgegenstehenden, kindlichen Willen brechen helfen, um ihm in Sinne dieser guten Absichten zu formen, und in die richtige Richtung zu lenken.
Dies geschah oftmals über die Abwertung dieser kindlichen Regungen und Ideen. Alles, was nicht den Erwartungen der Massengesellschaft entsprach, wurde mit den Worten „Quatsch“, „Unsinn“, „Zeitverschwendung“ oder ähnlichem tituliert. Schon früh mussten wir „zusehen“, dass aus uns „etwas wird“. Und dieses „etwas werden“ war vielleicht der ausschlaggebende Punkt. Schon in frühen Jahren wird man als Kind mit der Frage traktiert „Was willst du später einmal werden?“ Als Kind lernt man dabei sehr schnell, dass als richtige Antwort hier nur eine der vielen belanglosen Berufsbezeichnungen erwartet wird, und passt sich an diese Erwartung an. „Etwas werden“, ist also reduziert auf diesen Beruf, und auch, wenn man als Kind, und auch später, als Jugendlicher und junger Erwachsener, natürlicherweise keine Ahnung davon hat, was ein bestimmter Beruf bedeutet, so lernt man doch, selbst in diesen Kategorien zu denken.
Kein Wunder, dass sie nicht rebellieren
Das führt dazu, dass der Beruf zu einem Bestandteil der Identität wird. Die Frage nach dem „was willst du werden?“ wird damit zu einer fundamentalen, ja schicksalshaften Frage, da ihre Antwort die eigene Identität maßgeblich bestimmen wird, sie also zu einer Frage über die eigene Identität an sich wird. Das stellt gerade junge Menschen vor eine unüberwindbar hohe Hürde. Denn wie soll man aus der Reihe der gleichförmigen und sehr begrenzten Berufe denjenigen auswählen, der vermeintlich am besten zu einem passt? Diese Wahl ist es zudem, die in unserer westlichen Kultur mit dem Schlagwort der „Freiheit“ vermarktet wird – die sich auch genau auf diesen Bereich beschränkt. Wir haben damit die „Freiheit“ zu entscheiden, auf welche Art und Weise wir uns der Maschinerie der Gesellschaft unterwerfen wollen – und mehr nicht. Die Frage, ob wir uns ihr unterwerfen wollen, kommt gar nicht erst auf, sie wird erstickt in der Frage „Was willst du werden?“. Denn diese Frage erlaubt als Antwort gar nicht die individuelle Entfaltung, das persönliche, geistige und seelische Wachstum, sodass man jeden Tag ein bisschen mehr man selbst wird. Nein, man selbst sein ist tatsächlich das Letzte, das diese Gesellschaft am Ende der Geschichte will.
Ständig soll man sich in andere Weltbilder, vorgegebene Rollenbilder und fertig ausgestanzte Muster pressen, um den zahlreichen Erwartungen gerecht zu werden, die einen quasi ab Geburt überfluten. Überhaupt erst einmal selbst zu entdecken, wer man ist, was man will vom Leben, wie man sich selbst entwickeln kann, ist überhaupt nicht vorgesehen. Man wird von Anfang an in eine Richtung gedrängt, die als Ziel lediglich eine Funktion im System hat, die dann noch mit der eigenen Identität verwechselt wird. Die jungen Menschen am Ende der Geschichte haben also eines gelernt: Sich zu unterwerfen und sich künstliche Identitäten auferlegen zu lassen.
Die Frage „Was willst du werden?“ suggeriert zudem eines: Dass man noch nicht vollständig und richtig ist. Die Frage führt den jungen Menschen beständig die eigene Unvollkommenheit vor Augen, die scheinbar nur überwunden werden kann, indem man sich den elterlichen Erziehungsmethoden und den schulischen Leistungsanforderungen beugt, um am Ende gelobt zu werden, einen Schulabschluss zu erhalten und damit den Anforderungen, die von außen auf einen einprasseln, irgendwie gerecht zu werden. Die eigene Minderwertigkeit wird einem durch diese Frage ständig vor Augen geführt, ebenso, wie durch die ständigen Bewertungen. Die meisten Menschen meiner Generation haben also gelernt, unvollständig und minderwertig zu sein, etwas, das nur dadurch auszugleichen ist, dass man sich Autoritäten unterwirft, ihnen gehorcht, ihren Willen ausführt, um dann, eventuell, einen entsprechenden Lohn zu erhalten. Es ist kein Wunder, dass diese Generation nicht rebelliert.
Hinzu kommt, dass es uns nicht einmal wirklich möglich war, eine eigene Persönlichkeit auszubilden. Diese Möglichkeit wurde uns durch die Erziehung von außen ebenso genommen. Wir konnten also nicht herausfinden, wer wir waren, was für Neigungen und Ideen naturgemäß in uns wuchsen, sondern mussten uns schon früh die Erwartungen, die von außen an uns herangetragen wurden, zu eigen machen, und wurden dahin manipuliert, dass wir sie als eigene übernahmen – in der Traumatherapie nennt man das ein Introjekt. Man könnte auch von Täter-Introjekt sprechen denn die Eltern, Lehrer und andere, Möchtegern-Autoritätspersonen wurden Täter an uns. Das führt dazu, dass noch heute die meisten Menschen nur vermeintlich aus einem inneren Antrieb heraus handeln, während in ihnen in Wirklichkeit noch die Mutter, der Vater, die Großmutter oder der Mathelehrer der fünften Klasse schreit.
Arbeit, Fressen, Saufen und Ficken
Die Werte, die wir lebten, wurden uns zudem vorgekaut von einer Kultur, die im Großen und Ganzen US-amerikanisch geprägt war. Eine rigide Selbstverwirklichungsideologie, die lediglich auf die optimale Selbstverwertung in der kapitalistischen Maschinerie abzielte, wurde uns in Filmen und Musik vorgelebt. Darüber hinaus predigte diese Kultur nicht mehr, als eine reine Spaß- und Ablenkungsgesellschaft, die uns oberflächliche Ziele und Vorstellungen von der Welt vermittelten. Etwa eine überromantisierte, in den Kitsch hereinreichende Vorstellung von Beziehung, oder eine Verengung der Vorstellungswelt des Lebens auf die Bereiche Arbeit, Fressen, Saufen und Ficken. Die letzteren drei wurden dabei oft kombiniert, und kulminierten trotz ihres primitiven Ruchs am Ende trotzdem wieder in die spießbürgerlichen, gesellschaftskonformen Vorstellungen von Ehe, Familie und Bausparvertrag – ein Verlauf, den man beispielsweise an den ersten drei American Pie-Filmen verfolgen kann, die meine Generation maßgeblich geprägt haben dürften.
Diese Ablenkungsindustrie erfüllt ihren Zweck am Ende der Geschichte, nämlich die Selbstentfremdung unsichtbar zu machen, indem man sie hinter den kulturell vorgegebenen Idealvorstellungen versteckte, an denen wir uns auszurichten hatten, und die uns ein erfülltes Leben versprachen. Sie verengten zugleich den Horizont der Menschen so sehr, dass selbst die Vorstellung eines gänzlich anderen Lebens unmöglich wurde. Damit wurde jede Alternative undenkbar. „There is no alternative“ fasste es die neoliberale Ideologie in den 80er Jahren auch schon zusammen, ein Slogan, der auch politisch programmatisch wurde.
Und warum auch nicht? Immerhin lebten wir, so zumindest die vermittelte Ideologie, bereits in der besten aller Welten. Denn das Ende der Geschichte hatte uns nicht nur die Demokratie beschert, sondern, zumindest vermeintlich, alle Probleme dieser Welt von uns gehalten. Deutschland war ein sicheres, starkes Land, in dem das Leben gut für alle war, und jene, die kein gutes Leben hatten, die hatten auch einfach selbst schuld daran. Sie waren zugleich mahnendes Negativbeispiel für uns alle, und spornten uns zur Anstrengung und Unterwerfung an.
Viele in dieser Generation nahmen die dünnen Aussichten für ihre Zukunft nur zu gerne an. Denn das Ende der Geschichte versprach uns nicht mehr, als genau das. Keine Abenteuer, keine echten, lebendigen Erlebnisse, nur das gleichförmige Arbeiten einer die gesamte Gesellschaft durchziehenden Maschinerie, die im Takt der Jahrgänge neues Menschenmaterial ausstieß, und am laufenden Band Waren ausspie, nach denen zwar niemand gefragt hatte, die uns aber als willkommene Ablenkung von der Sinnlosigkeit der Existenz ablenkte. Denn das Leben am Ende der Geschichte hatte keinen höheren Sinn mehr. Es bot keinerlei größere, metaphysische Erzählung mehr. Gott war bereits gestorben, ermordet auf den Seziertischen und unter den Mikroskopen der Wissenschaftler. Wir hatten ihn zwar nicht selbst getötet, waren jedoch mit der Aufgabe befasst, die Leerstelle zu füllen, und alles, was uns dafür blieb, waren der Konsum und das Streben nach Erfolg. Einen höheren Sinn gab es nicht, da es nichts Höheres gab. Und so konnten wir nicht mehr tun, als uns in dieser Maschinerie einen Platz zu suchen, der uns am wenigsten unangenehm war, und dort gleichförmig und monoton vor uns hin leben, um das Ende des Ganzen abzuwarten, das wir jedoch in unserer Vorstellung stets verdrängten.
Angekommen in der besten aller Welten?
Die Generation der Millennials ist also schwer traumatisiert, nicht durch Krieg und Vernichtung, sondern durch die nihilistische Alternativlosigkeit eines Systems vollkommener und umfassender Verwertung. Sie hat jede Verantwortung abgetreten an irgendwie geartete Autoritäten, und ist daher umfassend steuerbar. Jede Rebellion gefährdet den sicheren Platz im Gefüge, das einzige, an das sie sich noch zu klammern in der Lage sind, weil es darüber hinaus nichts von Sinn und Bedeutung mehr gibt. Das Ende der Geschichte hat keine Versprechungen gemacht außer jene, bereits in der besten aller Welten zu leben, eine Vorstellung, die irgendwie mit der täglich erlebten grausamen Wirklichkeit in Einklang gebracht werden musste, wozu die Verdrängung und der Konsum herhalten mussten.
Natürlich, es gibt eine Minderheit, die auf den Straßen vertreten ist und immer wieder demonstriert. Sie demonstriert beispielsweise gegen den Klimawandel, gegen „Coronaleugner“ und „gegen Putin“, oder dergleichen. Das ist jene Minderheit, die am Ende der Geschichte verzweifelt, keine vernünftige Stellung für sich selbst in diesem Gefüge finden kann, und dennoch an Konsum und Autoritätsglauben festhält. Während der größte Teil der Millennials schon gar nicht mehr rebelliert, so ist dieser Teil zumindest noch der emotionalen Regung fähig, lässt sich aufgrund seiner Autoritätshörigkeit aber von der Macht instrumentalisieren, und gegen jede Opposition ins Feld führen. Es sind zugleich diejenigen, die den Nihilismus, die Leerstelle, die Gott hinterließ als er starb, mit religiösen Ideologien füllten.
Es sind Ideologien, die sich aus dem Negativen her ableiten. Hier muss ständig etwas verhindert werden – der Aufstieg des Faschismus, die Überhitzung der Erde, die Eroberung Europas durch Putin – eine Vorstellung, die also von einer metaphysischen Hölle kaum zu unterscheiden ist, die lediglich auf Erden bereits abgewendet werden muss.
Damit verbunden ist aber auch die Vorstellung, am Ende der Geschichte in der besten aller Welten angekommen zu sein, und diese beste aller Welten nun nur noch gegen rückwärtsgewandte Kräfte verteidigen zu müssen, die immer wieder versuchen, uns in historische Vergangenheit zurück zu führen – augenfälliges Beispiel ist der Vergleich der AfD mit der NSDAP und derlei Albernheiten. Diese Generation hat sich an das Ende der Geschichte mit seinem Konsum und seiner monotonen Lebensführung derart gewöhnt, dass sie in diesem gleichförmigen Lauf nicht gestört werden will, und ihre Bequemlichkeit immer wieder gegen vermeintliche Unbequemlichkeit zu schützen sucht. Zugleich hat sie die Verantwortung für den Zustand der ewigen Geschichtslosigkeit höheren Mächten übertragen, deren undemokratisches Vorgehen im Zweifelsfall auch irrelevant ist, wenn es sich gegen jene Kräfte richtet, die drohen, die Gesellschaft wieder in die Geschichte zurück zu zerren.
Und dann gibt es da noch den verschwindend geringen Anteil derjenigen, die all dem widersprechen, was tatsächlich schiefläuft. Die gegen Krieg und gegen Coronafaschismus auf die Straße gingen und gehen, die sich nicht von den Versprechen des Endes der Geschichte dazu verleiten lassen, an das politische System zu glauben, und diesem die Verantwortung für das eigene Leben zu übertragen. Was genau diese von den anderen unterscheidet, muss wohl noch herausgefunden werden. Möglicherweise sind es einfach die Reaktionen auf die traumatisierenden und entfremdenden Erfahrungen am Ende der Geschichte.
Der Artikel erschien erstmals bei Manova.
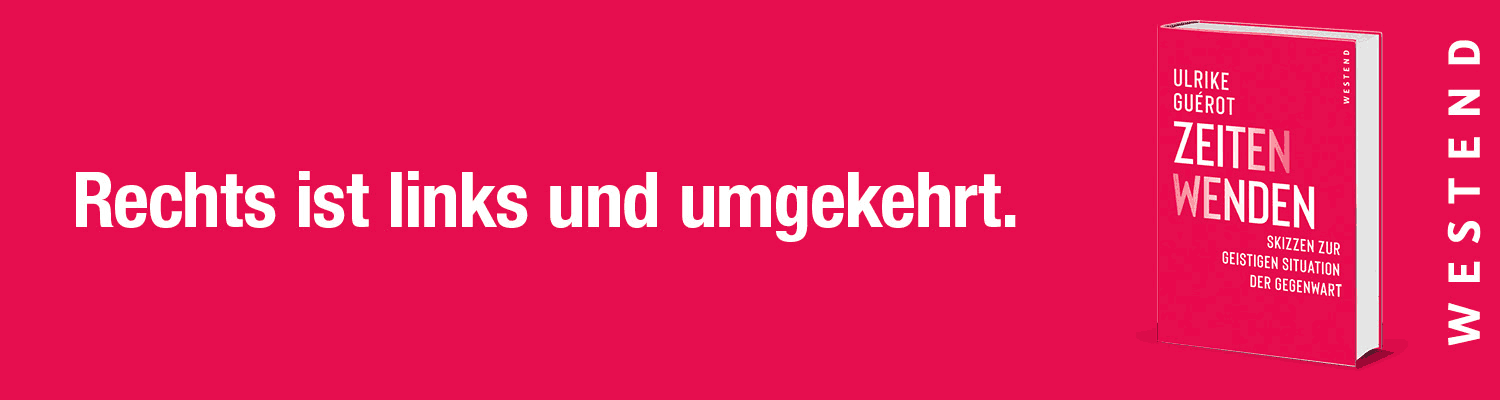



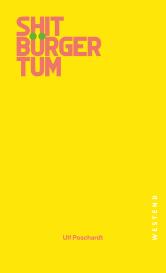
Herr Feistel widmet sich einer zweifellos wichtigen Frage, die sich wahrscheinlich schon so mancher gestellt hat.
Seine Vermutung hinsichtlich der Ursachen wirkt recht überzeugend.
Anderes mag noch hinzukommen, etwa ein verändertes Erziehungsverhalten der Eltern.
—
Widerspruch anmelden möchte ich allerdings bei den Gedanken des Autors zum Schulbetrieb.
Wenn er schreibt …
„[Die Schule] sah vor, die natürlichen Impulse der Kinder – laufen, sprechen, spielen, kooperieren – zu unterbinden, und durch Gehorsam, stillem sitzen, aufmerksamen Zuhören, Konkurrenz und Vergleich zu ersetzen.“
… so wird natürlich jeder ältere Leser sofort anmerken, dass das zu allen Zeiten so war. Ja, dass dieses Einfordern von Gehorsam und Impulskontrolle einerseits für einen erfolgreichen Schulbetrieb nun einmal nötig ist und dass die Schule in dieser Hinsicht in den 1960er, und auch 1980er Jahren zweifellos strenger und konsequenter war als heute. Trotzdem zeigten aber frühere Schülergenerationen ein deutlich anderes Verhalten!
Mit dieser Ausführung gehe ich mal ausnahmsweise mit.
Interessanter Artikel, aber ich sehe das etwas differenzierter. Ich habe Kinder und viele Neffen und Nichten in dieser Generation und kann nicht behaupten, dass sie nicht kritisch sind. Im Gegenteil: Sie richten ihren Lebensstil meist danach aus, dem Klima nicht zu schaden und fürchten um unsere Demokratie, sind gegen den Völkermord im Gaza.
Nur äußert sich ihre kritische Haltung nicht nach außen, sondern eher durch einen Rückzug nach innen. Das traditionelle Familienbild ist besonders beliebt, dabei legt man Wert auf traditionelle Abläufe: Antrag, Verlobung, großes Hochzeitsfest mit allem was dazu gehört, erstes Kind, Haus, zweites Kind. Mutter bleibt zu Hause, arbeitet bestenfalls halbtags. Innerhalb der Familie geht es dann im Alltag (Urlaubsreisen klammere ich mal aus) ganz ökologisch zu: Kind vegetarisch oder vegan ernährt, Mülltrennung usw. Es ist als ob man die Kontrolle, die man im Außen verloren hat in der Familie zurückgewinnen möchte. Da trackt man auch mal den Partner oder das Kind. Für mich eine Horrorvorstellung, dort aber ganz normal.
Allerdings muss ich auch hier differenzieren. Es ist vor allem der deutsche Teil meiner Familie, der solche Lebensentwürfe hat, der andere – nichtdeutsche – Teil hat wesentlich vielseitigere und innovativere Lebensentwürfe.
Sie beschreiben das Dilemma sehr gut. Die Jugend hat Angst um das Klima, obwohl es das in der Realität gar nicht gibt. Schicken Sie sie doch mal nach draußen und lassen sie das Klima suchen.
Lassen Sie die Kinder doch mal aufzählen, wie oft die Politik etwas beschlossen hat, was die Bürger wünschten oder ihnen wichtig war. Kennen diese Kinder den Begriff der Klassengesellschaft?
Klingt für mich zum Teil tatsächlich nach „Biedermeier“. Ich meine es wirklich nicht böse, aber das ist das erste was mir auf diese interessante Beschreibung einfällt. Ich glaube tatsächlich, dass große Teile unserer Gesellschaft in solch einer Art von Schockstarre verharren.
Die Biedermeierzeit war eine Zeit der politischen und gesellschaftlichen Ruhe, und nur für die ständigen veränderer eine bleiernde Zeit, also eher nicht mit der Gegenwart vergleichbar. Wir stehen gerade an einer Abruchkante der Zeit.
Auch hier muß ich zustimmen.
Seit gestern ist Greta Thunberg und ein Teil der Teilnehmer der Global-Sumud-Flotte, die Hilfsgüter nach Gaza bringen wollte, wieder frei. Greta und die anderen Teilnehmer der Hilfsfotte berichten von schweren Mißhandlungen durch die Israelis. Insulinpflichtigen würde das Insulin verweigert und die Israelis sagten „Für Tiere haben wir keine Ärzte“
Greta hat die israelische Folter nur noch stärker gemacht. Sie sagt, sie sei keine Heldin, sie habe nur das Mindeste getan, was getan werden muß, denn ein Völkermord findet vor unseren Augen statt.
Während die Welt demonstriert, Israel verurteilt, schweigt Deutschland. Die deutschen Medien berichten kaum über das Kidnapping der Flotte in internationalen Gewässern. Das ist ein beredtes Schweigen und sagt mehr über diejenigen aus, die schweigen als tausend Worte.
Auch die alternativen Medien schweigen oder berichten spärlich und oberflächlich.
Ist das Eurer beredtes Schweigen?
Ihr könnt später nicht behaupten ihr hättet von nichts gewußt!
Ja,
Greta ist frei,
und war frei kein Kopftuch tragen zu müssen,
noch sind die 48 Geiseln der Ghara seit dem 7.10.23 nicht frei! : https://youtube.com/shorts/3nkevFLUb6o?si=4ZV67Rm3jfQDuSJ6
Auch die Tausende Palästinenser, die von den Zionisten in Folterzentren als Geiseln gehalten und bestialischen Foltern unterzogen werden, sind noch immer nicht frei!
Immer schön auf einem Auge blind….das ist der deutsche Spießer.
… und sie musste tatsächlich keine Perücke tragen, wie es die „anständigen“ Frauen der in dem Siedlerstaat vorherrschenden Religion zu tun pflegen, damit man ihr natürliches Haar nicht sieht. Die einen stehen offen zu dieser Abstrusität, indem sie ein Kopftuch aufsetzen, die anderen, indem sie sich als Meisterinnen der Heuchelei gerieren.
Thema verfehlt!
Judentum und Islam haben mehr gemeinsam, als ihnen lieb ist (z. B. männliche Genitalverstümmelung).
@Ronald @Gambino
https://youtu.be/ybaOpI_7OqI?si=IoAjddFikAsCa-y6 achtet mal auf die Filmszenen als die Hamastanis nach der Ghara, mit den Geiseln in den Gazastreifen zurück kehren.
Siehe oben????
Die Geißeln spielen in diesem Themenbaum keine Rolle.
Es geht hier um die Millenials und deren Befindlichkeiten der westlichen Hemisphäre.
Sorry, Thema verfehlt!
Der Muslim-Bruder Zaher Birawi war derjenige, der die Flottille organisierte und ins Leben rief. Er warb auch für die Hamas auf dem TVsender Al-Hiwar. Gretas mitwirken bei einer Muslim/Hamas- Aktion ist daher sehr zweifelhaft.
Bei ähnlichen Aktionen in der Vergangenheit war einer der Organisatoren und Schiffsbesitzer El-Mehdi El-Hamid, der ein CIA-Agent war. Später war er Vizechef der Freien Syrischen Armee. Denke daher die sogenannten Hilfsgüter- Flottillen gehören zu einer „Strategie der Spannung“ organisiert von westlichen/israelischen Geheimdiensten.
Selbst wenn die Hamas hinter der Global-Sumud-Flottila stecken würde, rechtfertigt das Folter?
Warum relativieren Sie die Menschenrechte?
Gelten die für Araber nicht? Gelten die für Greta Thunberg nicht?
Das erinnert mich an Guantanamo, einen US-Gefängnis außerhalb des Geltungsbereiches der Menschenrechte.
Es geht darum wo die westlichen/israelischen Geheimdienste überall drinstecken. Nur wenn man das erkennt kann man wirkungsvoll dagegenhalten und aufklären. Aber man will dies eben nicht, siehe morgige Doku im TV.
Hätte die Global-Sumud-Flotte, die weltweit palästinasolidarische Proteste auslöste, in Italien zu Streiks führte, also zuhause bleiben sollen?
Ist sicher auch Interessant, was meine eingangs geschilderten Einflusnahmen gewisser Organisationen bezüglich der Thunberg, bestätigen würde.
Die Thunberg wurde und wird auch weiterhin institutionalisiert, quasi ein Geschöpf der Partikularinteressen folgenden grünen Mischpoke und bildet daher eine echte Ausnahme.
Zu gute zuhalten ist ihr, dass sie sich anscheinend doch ein wenig emanzipiert hat und sich mehr den primär wichtigeren dingen zugewendet hat, weil sie wohl begriffen hat, dass das ganze Klimagedöns eine einzige Lüge darstellt.
Hallo. Selber gehöre ich auch zu den Millennials und auf den Protesten gegen die Coronamaßnahmen musste ich die Beobachtung des Autoren leider teilen. Überwiegend Ältere, viele Rentner auch, mit denen ich mich aber im Ganzen gut verstanden habe. Seinerzeit hatte ich mich auch zunehmend für Politik interessiert und wollte mich in die Partei „Die Basis“ integrieren. Dort waren auch einige in meinem Alter oder sogar Jüngere zugegen.
Folgend mein persönlicher Erfahrungsbericht zum Thema Schule:
Ob das Schulsystem daran Schuld ist, kann ich nicht beurteilen, da mir der direkte Vergleich zu den Jahrzehnten davor fehlt. Ältere sagten mir immer wieder, es sei in der Vergangenheit sehr autoritär zugegangen bis hin zu körperlicher Züchtigung. Da wurde offenbar bei Fehlverhalten schon mal mit dem Lineal auf die Finger gehauen. Eher hatte ich den Eindruck, dass die Lehrer nicht Herr der Situation waren und sich im Umgang mit unbequemen Schülern als unfähig erwiesen, oft sogar selber Opfer von Mobbing oder Dergleichen wurden. Ich litt auch unter dem Mobbing meiner Mitschüler und von der Lehrerseite konnte ich mir keine Hilfe versprechen.
Salopp gesagt: Ich hatte keine Ahnung was an der Schule los war – auf jeden Fall stimmte irgendwas nicht. Auch wenn die Lehrer es sicher nicht leicht hatten, hielt es sie nicht davon ab, den Schülern Angst vor der Zukunft zu machen, quasi dem Leben nach der Schule, wo ja alles schwieriger würde und sich jeder durchzubeißen hätte. Sorry, wenn ich das so sage, im Großen und Ganzen hatte ich aber den Eindruck, dass die Lehrer selber etwas infantil unterwegs waren.
Später hatte ich noch die Chance das Fachabi zu machen, aber da hatte ich schon einen psychischen Dachschaden, der meiner „beruflichen Karriere“ im Weg stand. Mir ist seinerzeit aufgefallen, dass Lehrer das System für absolut bombensicher hielten, die Tagesschau würde immer seriöse Informationen bereitstellen und die Gewaltenteilung würde Diktaturen im Keim ersticken. Diese Aussagen als Teil des Unterrichts. Dieses, ich nenne es mal Gottvertrauen, konnte ich schon damals nicht aufbringen – vielleicht auch wegen meiner negativen Erfahrungen an der Realschule, auf der ich „mich herumtrieb“.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass eine bestimmte Art von Schülern, es waren meist ehrgeizige Streber mit naiven („ich hab ja nichts zu verbergen“) bis zu fragwürdigen Sichtweisen, die besseren Abschlüsse machten. Ich war noch nicht mal neidisch darauf, weil ich andere Probleme hatte, als gute Noten zu schreiben.
Summa Summarum glaube ich, dass beim Aussieben (manche Lehrer benannten es zynischerweise auch als „die Spreu vom Weizen trennen“) einiges schief gegangen ist. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Schüler nach dem Verlassen der Schule erwachsener geworden wären (mich selbst schließe ich damit ein). Dazu war die Schule gar nicht in der Lage. Weil die Schule an sich kein erwachsener Ort war. Alle, die die Schule verließen, waren vieles, aber nicht selbstbestimmt.
Das liegt auch an der Ausbildung der Lehrer, weil sie didaktisch keine Ahnung von den Befindlichkeiten der Jugend besitzen und wenn überhaupt, dann nur fachlich, respektive in ihrem Fachbereich eine gewisse Kompetenz entwickelt haben.
Diese Entwicklung bezüglich des einseitigen, im Laufe der Jahre immer spezieller werdenden Unterrichts und den Verzicht des Lehrerkollegiums auf die mehr und mehr komplexeren globalen Probleme einzugehen und zu hinterfragen, hat dazu geführt, das die Jugend ebenfalls das Interesse verloren hat, neugierig auf die Welt zu sein und auch gar nicht mehr die Zeit und die Mittel haben raus zugehen, um die sich ein Bild von dem Planeten zu machen auf dem sie leben.
Nochin den 70ern konnte die Jugend bspw. ganz ohne sorgen, notfalls schon mit 16 von Zuhause ausziehen, sich eine Wohnung finanzieren, studieren, nebenbei für gutes Geld Taxi fahren, in den Urlaub gehen, oder eben einfach mal den Müßiggang pflegen, ohne das es irgendwelche Nachteile sich für sie ergeben hätten.
Das wurde schon spätestens Mitte der 80er deutlich schwieriger und blieb dann den eher gut Begüterten vorbehalten.
> Seinerzeit hatte ich mich auch zunehmend für Politik interessiert und wollte mich in die Partei „Die Basis“ integrieren.
Echt jetzt, was will man in einer Partei die so einen zerstrahlten Typen als Kanzlerkandidaten aufstellt?
https://www.youtube.com/watch?v=idu57VCoGYY
Auch, wenn der Herr Fuellmich mit 27.950€ den teuersten E-Mail Service der Welt für sich beansprucht hat, tat er doch so einiges beim Corona Untersuchungsausschuss.
Denn ohne den, hätte es wohl kaum einen so nennenswerten Widerstand gegeben.
Leider gilt der Text auch und vor allem für den Autor.
Was fehlt ist das dialektische Denken, weil es in der Schule seit 1990 nicht mehr gelehrt wird. Auf Alt-BRD Gebiet wurde es zwar nie gelehrt, aber auf DDR-Gebiet schon. Deshalb ist der DDR-Bürger bis heute der gefährlichste natürlich Feind der BRD und darf nie zu Wort kommen, weil er eben zwischen Erscheinung und Wesen einer Sache unterscheiden kann. Nach dem Desaster mit Lenin und der Oktoberrevolution hat das Kapital seine Hausaufgaben gemacht und dafür gesorgt, dass die breite Masse den intellektuellen Status von Labormäusen angenommen hat. Es gibt leider nur sehr wenige Menschen, die sich wie weiland Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Bildungssumpf ziehen können.
👍👍👍
…“Tiefer greifender betrachtet ist die negative Dynamik der Fragmentierung kultureller Natur: Massenhafte Hochschulbildung schafft geschichtete Gesellschaften, in denen die Hochgebildeten – 20, 30, 40 Prozent der Bevölkerung – beginnen, unter sich zu leben, sich für überlegen zu halten, die Arbeiterklasse zu verachten und Handarbeit und Industrie abzulehnen. Grundschulbildung für alle (allgemeine Alphabetisierung) hatte die Demokratie gefördert und eine homogene Gesellschaft mit einem egalitären Unterbewusstsein geschaffen. Hochschulbildung hingegen hat Oligarchien und manchmal Plutokratien entstehen lassen – geschichtete Gesellschaften, die von einem ungleichen Unterbewusstsein durchdrungen sind. Das ultimative Paradox: Die Entwicklung der Hochschulbildung führte letztlich zu einem Rückgang des intellektuellen Niveaus in diesen Oligarchien oder Plutokratien! Ich habe diese Entwicklung vor über einem Vierteljahrhundert in meinem 1997 erschienenen Buch „Die ökonomische Illusion“ beschrieben . Die westliche Industrie hat sich in den Rest der Welt verlagert, natürlich auch in die ehemaligen Volksdemokratien Osteuropas, die, befreit von der sowjetischen Unterdrückung, ihren jahrhundertealten Status als westeuropäische Peripherieländer wiedererlangt haben. In Kapitel 3 gehe ich ausführlich auf diese Art von innerem China ein, in dem es nach wie vor zahlreiche Industriearbeiter gibt. Überall in Europa hat jedoch der Elitismus der Hochgebildeten zum „Populismus“ geführt.
Der Krieg hat die Spannungen in Europa verschärft. Er verarmt den Kontinent. Vor allem aber delegitimiert er als schwerwiegender strategischer Misserfolg Führer, die unfähig sind, ihre Länder zum Sieg zu führen. Die Entwicklung konservativer Volksbewegungen (von der journalistischen Elite üblicherweise als „populistisch“, „rechtsextrem“ oder „nationalistisch“ bezeichnet) beschleunigt sich. Reform UK im Vereinigten Königreich. AfD in Deutschland, Rassemblement National in Frankreich … Ironischerweise werden die Wirtschaftssanktionen, von denen die NATO einen „Regimewechsel“ in Russland erhofft hatte, eine Kaskade von „Regimewechseln“ in Westeuropa auslösen. Die herrschenden Klassen des Westens werden durch die Niederlage genau in dem Moment delegitimiert, in dem Russlands autoritäre Demokratie durch den Sieg relegitimiert oder vielmehr überlegitimiert wird, da Russlands Rückkehr zur Stabilität unter Putin ihr zunächst unangefochtene Legitimität sicherte.
So sieht unsere Welt aus, während wir uns dem Jahr 2026 nähern.“…
Quelle: https://substack.com/home/post/p-175377338
Danke nochmals für den Hinweis auf den Todd (sammeln um in die Irre zu führen). Einen Doppeltäuscher, mit seinem die sind konservativ und der Konservativismus ist ganz toll, könnt man ihn auch nennen. Ein Gaulist, ist er recht gewiss. Also auf den Führer kommt es an, ein Elitenaustausch und schon klappt das. Nur ein weiterer Rosstäuscher zur Bewahrung des Status quo der tatsächlichen Herrscher und zur Abwehr einer Demokratie die den Namen verdient. Ich häng mal noch einen Kommentar an:
Gracchus Babeuf
20.11.2024 17:59 Uhr
Ein Jammer, die verlorene Religiosität. Putzigerweise wird die Ersatzreligion mit keiner Silbe erwähnt:
Im Kapitalismus ist eine Religion zu erblicken, d.h. der Kapitalismus dient essentiell der Befriedigung derselben Sorgen, Qualen, Unruhen, auf die ehemals die so genannten Religionen Antwort gaben.
– Walter Benjamin: „Kapitalismus als Religion“, 1921
Eine weitere demagogische Phrase sollte noch entlarvt werden:
Liberale Demokratie bedeutet eine höchst eingeschränkte Demokratie, da der Einfluss des Volkes konstitutionell eng begrenzt wird und zentrale Bereiche der Gesellschaft jeder demokratischen Willensbildung und Gestaltung entzogen sind. Durch den Liberalismus wurde die Bedeutung von >Demokratie< fast nur noch die bürgerlichen Freiheiten – wie Schutz der Privatsphäre und des Privateigentums, Meinungsfreiheit, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie Schutz und Anerkennung gesellschaftlicher, insbesondere diskriminierter Partikulargruppen – verbunden werden. Folglich erscheint heute der Ausdruck »liberale Demokratie« den meisten nahezu als Pleonasmus, während er de facto ein Widerspruch in sich ist.
– 6.2 Demokratie im Liberalismus: Elitenkonkurrenz, Verachtung des Volkes und Zuschauerdemokratie, Rainer Mausfeld, Hybris und Nemesis – Wie uns die Entzivilisierung von Macht in den Abgrund führt – Einsichten aus 5000 Jahren, S. 391/392
Was also bleibt mitzunehmen aus diesem Gespräch. Lügen, Obskurantismus, Fremdenfeindlichkeit (ja ja, die wenig Gebildeten, anscheinend auch ohne Migranten ein schier unerschöpfliches Reservoir, dafür wurde und wird Sorge getragen), Chauvinismus, Antikommunismus und Geschichtsrevisionismus.
https://overton-magazin.de/dialog/es-ist-schwierig-die-idee-zu-akzeptieren-dass-deine-schutzmacht-dir-schaden-will/#comment-179179
> …“Tiefer greifender betrachtet ist die negative Dynamik der Fragmentierung kultureller Natur: Massenhafte
> Hochschulbildung schafft geschichtete Gesellschaften, in denen die Hochgebildeten – 20, 30, 40 Prozent der
> Bevölkerung – beginnen, unter sich zu leben, sich für überlegen zu halten, die Arbeiterklasse zu verachten und
> Handarbeit und Industrie abzulehnen.
Pol Pot hatte darauf eine Antwort.
Man könnte es auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion nennen, die offenbar nur wenige Menschen besitzen.
„Was fehlt ist das dialektische Denken, weil es in der Schule seit 1990 nicht mehr gelehrt wird. Auf Alt-BRD Gebiet wurde es zwar nie gelehrt, aber auf DDR-Gebiet schon. Deshalb ist der DDR-Bürger bis heute der gefährlichste natürlich Feind der BRD und darf nie zu Wort kommen, weil er eben zwischen Erscheinung und Wesen einer Sache unterscheiden kann.“
„Man könnte es auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion nennen, die offenbar nur wenige Menschen besitzen.“
Klar, wer könnte es besser als der ewige Schlau-Ossilant
https://www.youtube.com/watch?v=_rZkdrHLoR8
Da liegen Sie falsch. In gewissen Kreisen sind Selbstreflexion und dialektisches Denken halt eher unerwünscht…
Was soll denn dieses Machwerk des RBB final beweisen?
„Selbstreflexion“ obliegt auch einer Konditionierung, deren Erfolg an die Verantwortlichkeit der Eltern gebunden ist.
Ich musste beim Lesen der These doch sehr oft schmunzeln, denn alles was dort niedergeschrieben wurde ist m.E. nicht generationsspeziefisch. Wir sollten uns allgemein gegen die These eines Generationskonfliktes wenden, denn der lenkt vom eigentlichen Konflikt ab, dem zwischen arm und reich. Das ist auch der Sinn der Konstruktion von Generationenkonflikten.
Journalismus funktioniert so nicht. „Gesunder Altruismus“ unterliegt genau so Entwicklungen wie alles andere auch. Jede Generation wird diesen zum Teil anders definieren und leben als die vorhergehenden Generationen.
„Persönliche Entwicklung “ kann niemals etwas anderes sein als ein Bestandteil von Allgemein Entwicklung …
Wenn Kritrik , müsste man Vorwürfe dieser Art den vorhergehendenen Generation machen o))
Bei Uns damals am Kinderheim hing ein Spruch….
“ Was Du nicht kannst, das musst Du lernen
Wenn es Dir schwerfällt werden Wir Dir helfen ..
Wenn Du nicht willst, werden Wir Dich zwingen “
(Anton Semjonowitsch Makarenko)
Der werte Autor hat einfach dabei übersehen ,das dafür auf anderen Teilen dieses Erdballs Entwicklungen stattfinden, die für sichtbare und spürbar Veränderungen da auch stehen. Das war noch niemals anders, auch wenn es bei Uns nach „Stillstand “ aussieht, so ist es am Ende doch keiner o)
Deutschland ist (immer schon) das Land des Konformismus
Das führt zu den Erscheinungen, die der Autor sehr wirklichkeitsnah beschreibt, da sich das Gesellschaftsbild der großen Mehrheit mindestens seit 1945 an dem sehr flachen Materialismus US-amerikansicher Prägung orientiert. Irgendwann wird den Millenials aufgehen, dass sie damit eine sehr langweilige und wenig zukunftsfähige Variante gewählt haben, denn die wirklich interessanten Teile des menschlichen Potenzials haben mit ganz anderen Dingen zu tun: mit dem Schaffen von und Leben in Gemeinschaften, mit geistiger und spiritueller Entwicklung. Und nur wenn diese Bereiche des menschlichen Potenzials ausgeschöpft werden, ist gedeihliche Entwicklung möglich. Wir müssen wohl warten, bis sich irgendwo zukunftsfähige Weltbilder erfolgreich entwickeln, damit wir sie dann übernehmen können (China? Russland?).
Stimmt, die deutsche Regelungswut ist wirklich einzigartig. 😉
Ja, klar. Überall diese Nazis, die nicht machen, was der Autor will. Darum geht es hier doch eigentlich, aber weil er so verlogen ist, spielt er sich noch auf als Beschützer der Kinder.
Ich habe jetzt auch keine Zeit auf den Timer zu warten, um das kaputte Zitat zu reparieren, bleibt es eben so stehen. Macht im den Artikel jetzt auch nicht viel aus.
Fühlst dich auch gleich angesprochen. Bist dann wohl auch einer von den ganz großen Aufspielern:
Garry
15.02.2025 11:37 Uhr
(…)
Für mich waren die Corona-Demos illegale Parties, wo es Typen wie Ballweg dem bösen Staat mal zeigen wollten. Es ging nie um eine solide Kritik an der Politik oder gar eine eigene solide Politik, entsprechend chaotisch war das alles. Es ging nur darum Unruhe zu stiften und Dampf abzulassen, dabei noch Kasse zu machen.
Es ist doch auch bezeichnend, dass die Corona-Pandemie schon lange vorbei ist, aber natürlich nicht für die Corona-Leugner. Manche Kritik ist in Ordnung, z.B. wenn unrechtmäßige Urteile gefallen sind oder Ermittlungen wegen Korruption, gibt es jetzt auch in USA, oder Rücknahme des Abbaus von Bürgerrechten. Wenn man entsprechendes Fachwissen hat, kann man auch die Impfungen hinterfragen oder natürlich was da in China in dem Labor passierte. Da kam übrigens weit mehr raus als ich dachte, aber natürlich nicht wegen den Ballwegs dieser Welt.
Den Corona-Leugner war doch keine Horrorstory groß genug bis ihn zum Weltuntergang, dass der böse Gates alle chippen wollte und uns Pöbel alle umbringen wollte und uns alle Rechte rauben oder dass es unzählige Impfschäden geben würde.
https://overton-magazin.de/top-story/ballweg-prozess-von-betrugs-hochrechnungen-verweigertem-handschlag-und-weiterem-irrsinn/#comment-209273
Weißt du (natürlich nicht), es gibt Parallelen die drängen sich einfach auf:
VS: Ich würde das gerne einordnen, weil meine Perspektive eine etwas andere ist. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Als Kind, das die Schreckensherrschaft der Nazis überlebt hat, habe ich unauslöschliche Lektionen über die Natur des Bösen gelernt. Ich kenne die Konsequenzen, wenn man als Krankheitsquelle stigmatisiert und dämonisiert wird. Meine Perspektive ist durch meine Erfahrung, durch die historischen Aufzeichnungen und durch die empirischen Beweise geprägt. Wir mussten, wie die Deutschen wissen, einen gelben Davidstern tragen, um uns zu identifizieren, um Juden auszugrenzen. Ausgrenzungsgesetze schlossen die Familie vom normalen Leben aus, um an normalen Aktivitäten teilzunehmen. Unser Eigentum wurde beschlagnahmt, uns wurde die Teilnahme an allen schulischen, religiösen und kulturellen Veranstaltungen untersagt. Reisen war für Juden verboten. Es gab also kein Entkommen. Diese schmerzhaften Erinnerungen aus meiner Kindheit sensibilisierten mich für die Bedrohung, die von den aktuellen restriktiven Regierungsdiktaten ausgehen. Im Jahr 1776 sah Benjamin Rush, ein Arzt und Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, die Gefahr voraus, dass die Medizin, wie er es nannte, eine verdeckte Diktatur organisieren könnte. Unter dem Naziregime wurden moralische Normen systematisch ausgemerzt. Die Ärzteschaft und ihre Institutionen wurden radikal umgestaltet: Akademische Wissenschaft, Rüstungsindustrie und klinische Medizin waren eng miteinander verwoben, wie sie es heute sind. Das Nazi-System zerstörte ein soziales Gewissen im Namen der Volksgesundheit. Übergriffe gegen Individuen und Gruppen von Menschen wurden institutionalisiert. Die von der Eugenik getriebene Politik der Volksgesundheit ersetzte den Fokus der Ärzte auf das Wohl des Individuums. Die deutsche Ärzteschaft und ihre Institutionen wurden pervertiert. Zwangspolitische Maßnahmen im Gesundheitswesen verletzten die individuellen Bürger- und Menschenrechte. Kriminelle Methoden wurden eingesetzt, um die Politik durchzusetzen. Die Nazi-Propaganda nutzte die Angst vor infektiösen Epidemien, um Juden als Krankheitsüberträger zu dämonisieren, die eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellten. Dies ist ein Markenzeichen des Antisemitismus: das jüdische Volk für existenzielle Bedrohungen verantwortlich zu machen, im Mittelalter wurden Juden für die Beulenpest und für die schwarze Pest verantwortlich gemacht. Angst und Propaganda mit den psychologischen Waffen, die die Nazis benutzten, um ein völkermörderisches Regime durchzusetzen. Und heute beginnen einige zu verstehen, warum das deutsche Volk sich nicht erhoben hat. Die Angst hielt sie davon ab, das Richtige zu tun. Medizinische Mandate sind heute ein großer Schritt zurück in Richtung einer faschistischen Diktatur und Völkermord. Die Regierung diktiert medizinische Eingriffe. Diese untergraben sowohl unsere Würde als auch unsere Freiheit. Zuerst waren es Impfverpflichtungen für Kinder.
Jetzt sind es die für Erwachsene.
RF: Lassen Sie mich das übersetzen, Vera, weil es wirklich wichtig ist und wahrscheinlich in dieser Deutlichkeit noch nie erklärt worden ist. Okay.
VS: Diese dunkle Lektion des Holocausts ist, dass immer dann, wenn Ärzte sich mit der Regierung zusammentun und von ihrer persönlichen professionellen klinischen Verpflichtung abweichen, dem Individuum keinen Schaden zuzufügen, die Medizin von einem heilenden humanitären Beruf zu einem mörderischen Apparat pervertiert werden kann. Wissen Sie, der Grund, warum die Griechen die Studenten an den medizinischen Fakultäten dazu brachten, bevor sie zum Medizinstudium zugelassen wurden, den hippokratischen Eid zu schwören, war, weil sie wussten, dass man in der Medizin Wissen darüber erlangt, wie man tatsächlich töten kann, und sie mussten versprechen, dass sie keinen Schaden anrichten würden, sonst wurden sie nicht zum Medizinstudium zugelassen. Ich glaube, sie waren uns im Verständnis der menschlichen Natur voraus.
RF: Ja, absolut. Ja
VS: Was den Holocaust von allen anderen Massengenoziden unterscheidet, ist die zentrale Rolle, die das medizinische Establishment spielte, das gesamte medizinische Establishment. Jeder Schritt des mörderischen Prozesses wurde durch das akademische und professionelle medizinische Establishment gebilligt. Mediziner und angesehene medizinische Gesellschaften und Institutionen verleihen dem Massenmord an der Zivilbevölkerung den Anschein von Legitimität. T4 war das erste industrialisierte medizinische Mordprojekt der Geschichte. Die ersten Opfer waren behinderte deutsche Säuglinge und Kinder unter 3 Jahren. Sie wurden von Hebammen identifiziert, die ihre Existenz den Behörden meldeten. Die nächsten Opfer waren psychisch Kranke, gefolgt von alten Menschen in Pflegeheimen. Die mörderischen Operationen waren methodisch und folgten einem sehr sorgfältigen Protokoll. An alle psychiatrischen Einrichtungen wurden Fragebögen verschickt, die detaillierte Informationen über jeden Patienten verlangten. Ein Komitee von 54 Psychiatern traf die endgültigen Entscheidungen über Leben und Tod für jeden Patienten. Das Ziel von T4 war es, die wirtschaftliche Last derjenigen zu beseitigen, die das Regime und die Ärzte als wertlose Esser betrachteten, und es ging auch darum, Betten für verwundete Soldaten freizumachen. T4 diente auch als Testprojekt für schädliche chemische und pharmazeutische Stoffe.
Die finanziellen Profiteure des Nazi-Völkermordes waren die Konzerneliten. Ihre Bilanz der Zusammenarbeit mit Völkermord und Regimen ist ungebrochen. Ohne die finanzielle Unterstützung von Wall-Street-Bankern und ohne die Zusammenarbeit mit großen US-amerikanischen, deutschen und schweizerischen Unternehmen, die das chemische, industrielle und technologische Material zur Verfügung stellten, hätte Hitler diese beispiellosen, industrialisierten mörderischen Operationen nicht durchführen können. Zu den Unternehmen, die vom Holocaust profitierten, gehören Standard Oil und Chase Manhattan, beide im Besitz der Rockefellers, IBM, Kodak, Ford, Coca-Cola, Nestle, BMW und natürlich IG Farben und Bayer. Die IG Farben war der größte Profiteur des Zweiten Weltkriegs, der Auschwitz-Insassen als Sklavenarbeiter einsetzte. Die Ärzte schickten diejenigen, die sie für tauglich hielten, als Zwangsarbeiter in die Fabriken und Bergwerke der IG Farben. Sie hatten auch ihr eigenes Lager. Sie führten auch Experimente durch. Die IBM-Technologie erleichterte die schnelle Umsetzung des Holocausts. Daten waren in IBM-Computern mit Lochkarten erfasst. Die Juden Europas wurden so schnell identifiziert, zusammengetrieben, ausgesondert, deportiert, verfolgt, inhaftiert, tätowiert, versklavt und vernichtet. Die Covid-19-Pandemie hat die eugenisch motivierte Gesundheitspolitik in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten offengelegt. Dies ist eine erschreckende Wiederholung von T4.
(…)
VS: Das alles ist geplant. Ärzte und Wissenschaftler, die Ansichten äußern, die das offizielle Diktat kritisieren, werden als Ketzer behandelt. Ihnen wird mit Existenzverlust gedroht, und ich bin sicher, Sie kennen einige von ihnen. Jeder, der die Sicherheit der Impfstoffe in Frage stellt, die im Eiltempo durch die „Operation Warp Speed“ gejagt wurden, wird von den Medien mundtot gemacht und verleumdet. Jetzt sind diese Covid-19-Impfstoff-Verträge unter „Operation Warp-Speed“ streng geheim. Sie haben sogar einen Zwischenhändler benutzt, der Dinge für das Militär macht, so dass diese Verträge nicht unter dem Freedom of Information Act erworben werden können. Sie befinden sich nicht im Besitz der Regierung. Warum diese Geheimniskrämerei? Warum hat der CEO von Pfizer tatsächlich versucht, Argentinien und Brasilien zu erpressen? Andere können untersuchen, was die finanziellen Gründe dafür sind, dass sie eine so absolute Kontrolle und die Sicherheit haben wollen, dass sie nicht verklagt werden können. Ich meine, so weit zu gehen, von ihnen zu verlangen, ihre Militärbasen, ihre Banken und Versicherungen anderen Ländern zu geben? Ich meine, all diese Sicherheiten, warum? Was weiß er, was in den Verträgen steht, was wir nicht wissen? Wenn es nichts zu verbergen gibt, warum sind sie dann so ängstlich? Es spielt keine Rolle, dass die Regierungen ihnen Immunität gewährt haben. Sie haben bereits Immunität. Das ist nicht genug. Bill Gates erklärte im Jahr 2020, dass die endgültige Lösung für die Pandemie ein Impfstoff sein wird. Sie können entscheiden, was das bedeutet. Natürlich bezieht er sich darauf, und er weiß es, er ist alt genug, mit anderen Worten, das ist eine Art Endlösung. Um die Covid-Impfungen durchzusetzen, haben Regierungen noch nie dagewesene aggressive Maßnahmen ergriffen. Dies geschieht in erster Linie, um einen kräftigen Geldfluss zu gewährleisten. Sie sprechen bereits davon, dass die Impfstoffe jedes Jahr erforderlich sind. Das ist wiederum eine Erwiderung auf Ihre Frage nach dem Warum, nicht? Sie haben noch nicht einmal kassiert. Ich meine, die Impfungen haben erst Mitte Dezember begonnen. Wie werden ihre Gewinne Ende 2021 aussehen?
RF: Ich übersetze das, Vera. — Aber warum, glauben Sie, geschieht das wirklich? Aus welchem Grund, die selbsternannten korporativen und politischen Eliten, und ich denke, die politischen Eliten spielen hier nicht wirklich eine Rolle, die meisten von ihnen sind nur Marionetten, nur dumme Idioten, mehr oder weniger. Aber warum forcieren sie das? Was ist das ultimative Ziel? Was wollen sie wirklich erreichen?
VS: Lesen Sie „The Great Reset“. Klaus Schwab. Das meiste davon wird dargelegt, und im Wesentlichen geht es darum, den Job zu beenden, nur jetzt ist es Global.
Aus:
Holocaustüberlebende richtet dringenden Appell an die Deutschen
Stoppt den Masterplan Eugenik
Vera Sharav im Corona-Untersuchungsausschuss
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=27369
Also Vera Sharav ist dein (Ihr) Klarname?
Ich habe kein Problem damit, dass das Posting zitiert wird. Ich sehe nicht wo ich in dem Posting ein großes Verbrechen begangen hätte, das eine Holocaust-Überlebende (Tochter von Holocaust-Überlebenden edit: ?) anprangern müsste. Sry, not Sry! Der Beitrag war auch aus meiner heutigen Sicht gut. Ich habe mich bemüht damals zu differenzieren. Meine Prämisse war immer, dass ich zu wenig weiß über Virologie und nicht in der Lage, bzw. nicht Willens mich entsprechend zu bilden, um kompetent mitreden zu können. Nur darf man das eben nicht persönlich nehmen oder Zeugs reininterpretieren, das ich nie gesagt habe. Ich war z.B. nie für Impfpflicht. Da hat die Dame nämlich kein Zitat, weil es das nicht gibt. Ich habe mich allerdings über Mitbürgis aufgeregt, die meinten für sie gelten manche Gesetze nicht mehr, weil eh die Welt untergeht oder das Gegenteil, dass es überhaupt kein Virus gäbe. Aber das stand auch alles nicht in dem Posting oben, weil ich wusste, dass das meine Emotionen waren. Das war wie schon mehrmals geschrieben, die große Erkenntnis für mich, dass bei einem Ereignis, das für mich wie ein schwarzer Schwan daherkam, klar wurde, wie sehr die eigene Rationalität doch von eigenen Empfindungen abhängt und wie das vor allem einige Prominente aus der Bahn warf.
Nee sry. Es gibt kein Masterplan Eugenetik oder Great Reset. Klaus Schwab ist nicht der Über-Nazi, sondern nur ein Event-Manager, der sich wie so Viele gerne selbst reden hört und vielleicht sogar noch den Mist glaubt, den er erzählt. Bisschen mehr ist er schon, aber in die Richtung geht es. Bei dem Event in Davos wird viel Geld gemacht und es ist sehr wichtig für die lokale Tourismusindustrie.
Ich war schon mal in Davos, nur vorbei gefahren. Da kriegt man schon Einiges mit. Solche Orte sind ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Der Ort selbst ist sehr hässlich, verschandelt mit viel Beton. Übrigens einmal sah ich da ein Trupp orthodoxe Juden rumlaufen, ein andermal eine Influencerin ein Selfie machen am Ortsschild. Da ist nicht das ultimative Böse. Es ist eher so wie Hannah Arendt es nannte, die Banalität.
Ich frage mich ja schon seit Jahren jetzt, wann die Corona-Geschädigten, also nicht die, denen das eventuell wirklich passiert ist, sondern die das meinen, weil sie es offensichtlich nicht besser wissen und können, oder wann die Corona-Warner, mal kapieren, dass es wirklich vorbei ist? Mir ist schon klar, dass das Manche nie kapieren werden. Da kann ich auch nichts für.
och Mensch, wieder keine Chance zu editieren:
Holocaustüberlebende oder Tochter Holocaustüberlebender? Ich habe das leider nicht kapiert.
Sry, not Sry ist ein Zitat von Michael Brooks, der leider viel zu früh verstorben ist:
https://www.youtube.com/@TheMichaelBrooksShow
Wenn Holocuastüberlebende, dann habe ich großen Respekt vor dem Alter, das wäre irgendwo in den 90ern, nach so einem Horrorerlebnis? Ich finde auch Ihre Beiträge super aus der Perspektive, so eine geistige Fitness muss man erst einmal haben in dem Alter, unabhängig davon, dass ich meine in Sachen Corona ist es zu übertrieben, bzw. generell gar nicht meine Sicht der Welt.
Eine Frage noch:
Wenn es um Bildung geht, einen Genozid zu verhindern, warum dann so an Corona abarbeiten und nicht am unabstreitbaren Genozid in Gaza?
… habe ich das nicht schon mal gefragt?
ps: und noch was: So Leute wie Reiner Füllmich oder Ballweg – sry, das sind die falschen „Freunde“. Das ist leider so.
Unabstreitbar, das ist unbestreitbar süß. Ja ich weiß, Spott auf Gaza. Mal so interessehalber, ist schon klar, daß ihr das nicht nur als Ablenkmanöver permanent in den Vordergrund rückt. Sondern daß das auch Modell ist.
Siehe hier:
Studie aus Israel zeigt Anstieg von Fehlgeburten nach mRNA-Behandlung von Schwangeren
22. 06. 2025 | Eine Studie von Wissenschaftlern aus Israel und den USA, die noch nicht den Gutachterprozess durchlaufen hat, stellt nach Analyse von 226.395 Schwangerschaften in Israel von 2016 bis 2022 fest, dass die COVID-19-„Impfung“ von Schwangeren nach Dosis 1 mit 13 von 100 gegenüber 9 erwarteten Fehlgeburten einherging. Mehr Fehlgeburten als erwartet gab es auch nach Dosis 2 und 3. Seit Beginn der Massenbehandlungen mit mRNA-Therapeutika kam es in sehr vielen Ländern zu bisher nicht erklärten (medial und von der Politik beschwiegenen) starken Rückgängen bei den Lebendgeburten. Die neuartigen Medikamente waren nicht an Schwangeren getestet, aber Schwangeren empfohlen und aufgedrängt worden.|
https://norberthaering.de/news/studie-fehlgeburten/
Gaza-Kinder fast durchgeimpft
17. September 2024von Thomas Oysmüller3,3 Minuten Lesezeit
Hamas und Israel können sich auf wenig einigen. Doch dass die WHO eine massive Kinder-Impfkampagne gegen Polio im Gazastreifen durchführt, hat geklappt. Aber warum sollte man der WHO vertrauen?
https://tkp.at/2024/09/17/gaza-kinder-fast-durchgeimpft/
Auch verhungert wird nur noch in Gaza. Und die anderen Gemetzel (Genozide/Massenmorde) ignoriert die UNO und sonstige Vasallenklempner sowieso, weil man unter dem Hygieneetikett den eignen praktiziert.
Weißt du wenn dir Vera Sharav nicht genügt, nimm doch einfach deinen Chefe Bill:
Bill Gates ueber Energie: Innovation nach Null!
TED
4,6 Mio. Aufrufe vor 15 Jahren
„Zuerst haben wir die Bevölkerung. Die Weltbevölkerung beträgt heute 6,8 Milliarden Menschen, und sie wird auf etwa 9 Milliarden anwachsen. Wenn wir bei neuen Impfstoffen, Gesundheitsfürsorge und reproduktiven Gesundheitsdiensten wirklich gute Arbeit leisten, könnten wir diese Zahl um vielleicht 10-15 % senken.“
https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I&t=271s
Bill Gates über Corona-Impfstoff
tagesschau
1,5 Mio. Aufrufe vor 5 Jahren
„Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich sieben Milliarden Menschen verabreichen.“
https://www.youtube.com/watch?v=083VjebhzgI&t=265s
Oder den Club of Rome:
Club of Rome “Limits to Growth” Author Promotes Genocide of 86% of the World’s Population
Dennis Meadows, one of the main authors of the Club of Rome’s The Limits to Growth, is a member of the World Economic Forum.
By Rhoda Wilson
Global Research, August 11, 2024
The Expose 2 May 2023
https://www.globalresearch.ca/author-limits-growth-promotes-genocide-86-world-population/5818133
Oder zwischzeitlich einmal echte Opposition:
Wissenschaftler und Mediziner fordern sofortigen Stopp von mRNA-Impfungen
Experten: Überprüfung der Präparate durch Paul-Ehrlich-Institut mangelhaft / Fehlende Untersuchungen zum Krebsrisiko und zur Auswirkung auf kommende Generationen / Verdachtsfälle: Außergewöhnlich hohe Rate an Nebenwirkungen und Todesfällen / Weitere mRNA-Impfstoffe in EU zugelassen, zusätzliche Ausweitung geplant
19. September 2025
https://multipolar-magazin.de/meldungen/0315
WHO baut weltweites „Notfallkommando für Globale Gesundheit“ auf
Ziel: Verhinderung der „nächsten Pandemie“ / Personalstruktur für „Gesundheitsnotfälle“ soll weltweit vereinheitlicht und vernetzt werden / Zuständige RKI-Vizepräsidentin wegen Nähe zu Gates-Stiftung in Kritik
29. September 2025
https://multipolar-magazin.de/meldungen/0317
Wieviel hundert Quellen dürfen es sein? Klar daß die Täter das bestreiten, herrlich, wenn das ein Kriterium sein soll, können wir uns ja auch Gaza sparen. Ich schätze eines eurer Anwerbekriterien ist, daß ihr so gar nichts mehr merkt.
Wenn das Coronaregime, das ja immer noch im Amt ist, keine faschistischen, oder zumindest totalitäre Anteile besitzt dann weiß ich auch nicht weiter.
Auch die weiteren Anschuldigungen kann ich nicht so recht nachvollziehen…???
Faschisten sind im Übrigen nicht unbedingt auch Nazis, umgekehrt schon… 😉
> Arbeit, Fressen, Saufen und Ficken
Richtig. Das war aber schon immer so. Solange das alles passt gehen die (Masse der) Leute nicht auf die Strasse, egal in welchem Land und welcher Ausrichtung. Massenproteste sind auch zumeist nicht politisch, sondern hängen an diesen 4 Sachen.
Im Prinzip kann man sagen den (meisten) Leuten gehts aktuell noch gut, alles 4 vorhanden. Die Abstriche passieren derzeit schleichend und werden deshalb noch nicht so wahrgenommen. Zudem wurden die Millenials für Klima hysterisiert und die Proteste in diese Bahnen staatlich gelenkt (mit Aufrufen in den Schulen usw).
Statt „Saufen“ hab ich in meiner Jugend lieber einen durchgezogen und wollte ganz natürlich den ganzen Tag immer nur Ficken und danach vielleicht die Welt sehen und Motorradfahren…ansonsten frönte ich dem Müßiggang, war auch danach meist sehr erschöpft um noch etwas anderes zutun… 😉
> Im Prinzip kann man sagen den (meisten) Leuten gehts aktuell noch gut, alles 4 vorhanden. Die Abstriche passieren
> derzeit schleichend und werden deshalb noch nicht so wahrgenommen. Zudem wurden die Millenials für Klima
> hysterisiert und die Proteste in diese Bahnen staatlich gelenkt (mit Aufrufen in den Schulen usw).
Warum sollen Physikleugner die anderen Menschen schlechtes wünschen die Menschheit nach vorne bringen?
So einfach ist das nicht. Es ist nicht Identifikation sondern vielmehr die Angst, die die Millennials passiv macht. So einen Terror wie zur Coronazeit und seither gab es in der BRD noch nicht. Adorno, Habermas und Marcuse und andere kritische Kritiker waren (vielleicht zu Unrecht) geachtete Leute und wurden in den Feuilletons hoch gelobt, selbst in der FAZ.
Hingegen wurden die Coronamaßnahmen kritisierenden Ärzte und andere Wissenschaftler sogar strafrechtlich verfolgt. Sucharit Bhakdi wurde sogar wegen Volksverhetzung angeklagt, allerdings frei gesprochen.
Die Millennials riskieren mehr als die älteren Leute. Aber Beamte gehen auch nicht demonstrieren, aus Angst um Job und Pension.
Auch ich ging nicht demonstrieren, weil ich gravierende Nachteile befürchtete. Begnügte mich mit dem Schreiben von Leserkommentaren und hielt mich meiner Klientel gegenüber ziemlich bedeckt. Feige auf jeden Fall, aber aus meiner Sicht auch ein bisschen klug.
„Feige“ … ist das weniger …
Auch hier gab es Arbeitsteilung, viele mit spontanen Jobs und ohne, gingen auf die Straße und kämpften für die Menschen mit die das Geld verdienten für den Sozialtopf. Das war eine unausgesprochene Abmachung die gelebt wurde.
Nur seit IT zunehmend Verwaltung durchdringt, ist das auch immer weniger noch möglich.
NIcht umsonst werden gerade Arge Sachbearbeiter nach bestimmten Zeiten ausgetauscht heute, was Vorgaben sind in der Software verankert …
P. S. Für das irrsinnige System demonstrieren die Millenniels natürlich. Da hat man ja auch Vorteile davon. Und die Antifa wird über das Vereinsrecht sogar vom System finanziert.
Komisch, ich warf meinen ersten Stein mit 12, hab es aber auch nie bereut, ganz im Gegenteil, habe ich meine subversiven Tätigkeiten bis heute immer weiter perfektioniert.
@Igel: Gut auf den Punkt gebracht: „Nur äußert sich ihre kritische Haltung nicht nach außen, sondern eher durch einen Rückzug nach innen“ Ist das nicht auch ein Zeichen von Ohnmacht?
Dem würde die Sozial/Friedenstechnik geloster Demokratie entgegen wirken können, da alle BürgerInnen gefordert wären gemeinsam Politik im Sinne des Gemeinwohls zu machen. https://losdemokratie.de/docs
Das hier müsste gerade die Klimaschützer aus Ihrem familiären Umfeld interessieren:
„Ökologischer Fußabdruck & Nichts-Bewirkung: Frauke Rostalski weiß auch nicht, was zu tun ist! 🙌🏽“
https://www.youtube.com/watch?v=3w8Flu_RKu0&t=2007s
Stimmt, es ist ein Form von Ohnmacht, aber ich kann das nachvollziehen. Mir geht es ähnlich, ich gehe zwar manchmal auf Demos, glaube aber nicht, dass es etwas bewirkt. Es ist die falsche Form.
Bei den Coronaspaziergängen hatte ich dieses Gefühl nicht und ich denke auch, dass sie etwas bewirkt haben.
Ja, diese Ohnmacht macht sich zunehmend breit. Daher befürworte ich die Idee „geloster Demokratie“, in der wir alle Politik machen, sprich BürgerInnen sich selbst die Gesetze geben, an die sie sich halten wollen.
Da Lebenszeit eine begrenzte ist, fokussiere ich mich derzeit auf dieses Hoffnungslichtlein.
Das ständige Anklagen, Schimpfen usw. und die tausend Analysen zum bestehend Schlechten bringen keine systemische Veränderung.
Es braucht unbedingt eine von uns allen verfasste Verfassung. Das ist Ziel der Losdemokratiepartei, die sich im Sinne paradoxer Intervention gerade gegründet hat: https://losdemokratie.de/docs
Noch ein paar Ergänzungen zu den problematischen Einflüssen, unter denen die „Generation Z“ aufgewachsen ist.
1. Anpassung als Kulturtyp
@ Fred weist gewiss auf etwas Wichtiges hin:
„Deutschland ist (immer schon) das Land des Konformismus.“
—
2. Angstbesetzung aus Mangel an Selbstvertrauen und Ich-Stärke
Gewiss, es ist eine Vermutung, aber es spricht einiges dafür, dass der heutigen jungen Generation gewisse Erfolgserlebnisse fehlen, die für die älteren Generationen noch normal waren. Damit meine ich den Stolz darauf, etwas aus eigener Kraft geschafft zu haben, ein Problemn bewältigt zu haben, und zwar ohne die Hilfe der Eltern oder sogar gegen den Willen der Eltern.
Wer als junger Mensch fast alles abgenommen bekommen hat, wer nur das Umsorgtwerden von „Helikoptereltern“ kennt, und eine materielle Rundumversorgung sowieso („Möchtest du das neueste Samsung zu Weihnachten?“) wem auch in der Schule vieles fast geschenkt worden ist (Stichwort: Noteninflation) – kurz: wer sich nur selten oder nie richtig anstrengen musste und wer auch kaum je gescheitert ist und aus eigener Kraft wieder aufstehen musste – nun der entwickelt eben wenig Selbstvertrauen und bleibt in Wirklichkeit ein schwacher Mensch.
Und wer wenig Vertrauen in die eigene Stärke und Kompetenz hat, der wird ängstlich.
Und wer ängstlich ist, der fürchtet sich vor allerlei Dingen – gerade auch vor unsichtbaren in den Medien präsentierten düsteren Bedrohungen – und der ist leicht lenkbar.
—
3. Verhinderte Abnabelung von den Eltern und bleibende Unreife
Moderne Eltern wollen von ihren Kindern hauptsächlich geliebt werden. Man hat den Eltern erzählt, dass das Kind ein „Partner“ sei (und für manche alleinerziehende Mutter wird das Kind manchmal wirklich dazu) und auch, dass man auf „Augenhöhe“ erziehen soll, nicht strafen soll usw. Im Ergebnis neigen moderne Eltern daher im Hinblick auf ihre Sprösslinge zur Konfliktvermeidung. Das gelingt durch den teilweisen Verzicht auf konsequente Grenzsetzungen, durch materielle Verwöhnung und auch durch so etwas wie liebevoll-lobende Anbiederei (-> „Du bist der beste Schüler. Ach, du mein kleines Genie! Oh, wie begabt du bist! Merkt der Lehrer das auch?! Du weißt doch, dass dich Mami ganz doll lieb hat, liebst du Mami auch so doll?“ usw usf.)
Das Ergebnis ist, dass die Kinder von ihren Eltern und ihrer emotionalen Zuwendung heute abhängiger sind als es vermutlich jene Kinder waren, die in den 1950er oder 1960er Jahren geboren wurden. Wer von den eigenen Eltern emotional abhängig ist, der ist aber eher bereit, sich ihren Vorstellungen, Wünschen und Plänen anzupassen.
Letztlich handelt es sich um eine Vermeidung bzw. Verhinderung des früher recht normalen Generationenkonflikts.
Dies wird zusätzlich noch dadurch gefördert, dass sich die Eltern viel mehr als vor 30 oder 50 Jahren an die Jugend anzupassen versuchen (Kleidermode, Sprache usw.)
Das Ergebnis ist eine weitgehende freiwillige Anpassung der jungen Generation an die Eltern sowie deren Lebenskonzepte und Vorstellungen. Allerdings nicht nur eine Anpassung an die eigenen Eltern, sondern an Autoritäten überhaupt: Lehrer, journalistische Welterklärer und die Obrigkeit. Der Staat als die Übereltern.
Wer sich nie von den Eltern zumindest ein bisschen abgenabelt hat, wer das gar nicht wollte (und heutige Eltern suchen diese Abnabelung ja auch teils zu hintertreiben), dem fehlt etwas Wichtiges beim Erwachsenwerden. Der wird gar nicht erwachsen, der bleibt im Grunde ein Kind, auch wenn er 25 oder 30 Jahre alt ist. Kurz gesagt: Ein erheblicher Teil der heutigen jungen Generation – insbesondere der aus der Mittelschicht – hat Mühe mit dem Erwachsenwerden und bleibt lange Zeit unreif und abhängig. Diese Unreife und Abhängigkeit betrifft nun viele Gebiete, darunter auch das des politischen Denkens und des Weltverständnisses.
—
4. Selbstinszenierung der Regierungen als hochmoralisch
Die Regierungen, die seit dem Ende der Kanzlerschaft von Helmut Kohl in Deutschland regierten, neigten und neigen viel mehr als frühere Regierungen dazu, das eigene Handeln als besonders moralisch zu verkaufen. Das ist natürlich ein Trick. Besonders meisterhaft bei dieser Masche waren und sind bekanntlich die Grünen! Da sich die Regierung und das von ihr immer stärker ausgebaute und alimentierte Vorfeld (NGO´s, Initiativen, Projekte usw.) sehr geschickt und gekonnt als ethisch gut, als hochmoralisch und auch als links darstellt und inszeniert, kommen schlichtere Gemüter leicht zur Überzeugung, dass dem wirklich so sei, dass sie schon in der fast besten aller politischen Welten leben und dass das Einzige, was zu tun sei, in der Abwehr böse dräuender Gefahren liegt, vor denen die kluge Regierung – die Übereltern! – warnt. Der Glaube an den Staat tritt an die Stelle des früheren Glaubens an Gott oder eine politische Lehre.
Warum sollte man denn aufbegehren, wenn der Staat doch schon für das Gute eintritt.
Im Gespräch mit jungen Leuten habe ich persönlich dieses naive Vertrauen in Autoritäten häufig erlebt. Manchmal machte mich das regelrecht sprachlos. Man merkt auch, dass die jungen Leute das glauben wollen(!) und dass sie es als Störung(!) ihres Wohlbefindens betrachten, wenn man sie darauf hinzuweisen versucht, dass die Wirklichkeit oft weniger glänzend ist. Sie wollen das gar nicht hören. Vermutlich jagt ihnen dieses Denken Angst ein. Und sie sind ja ängstlich … !
Sie wollen einfach in einer heilen Welt leben, denn das kennen sie oft genug von ihrer Kindheit, wo ihnen nur selten die Meinung gesagt wurde, wo es nur wenig Streit gab, wo sie ihren Eltern vertrauten, wo sie umsorgt wurden usw usf.
@ Wolfgang Wirth
Danke sehr für das Teilen Ihrer Überlegungen.
Passend als Ergänzung zu dem gelungenen Artikel des Herrn Feistel.
„Warum sollte man denn aufbegehren, wenn der Staat doch schon für das Gute eintritt.“
Nun, sog. Staatsverdrossenheit wird sich erledigt haben, wenn wir alle „der Staat“ sind.
„Die Auffassung, dass wir Bürger selbst unser Staat sind, führt direkt zur Einsicht, dass wir Demokratie brauchen: Politische Formen der Begegnung aller mit allen. Begegnungen aller mit allen auf Augenhöhe. Als Bürgerrecht und zugleich als Bürgerpflicht.
Auf diese Weise wird Politik zu dem Ort, der sie eigentlich sein sollte: Zum Ort menschlicher Wertschätzung.
https://wyriwif.wordpress.com/2018/11/15/der-staat-die-verfassung-die-burger-selbst/
Das allerdings müssen nicht nur junge Menschen kapieren.https://losdemokratie.de/docs
@Ute Plass
Sehr geehrte Frau Pless,
irgendwie ist mir nicht klar, ob Sie das ernst oder ironisch meinen.
—
Ihren weiter oben geäußerten Gedanken, die Abgeordneten auszulosen, finde ich ziemlich gut.
Lieber Wolfgang Wirth,
hatte eigentlich Ihre Äußerung „„Warum sollte man denn aufbegehren, wenn der Staat doch schon für das Gute eintritt.“ als Ironie aufgefasst.
Dass geloste Demokratie bedeutet, dass wir BürgerInnen der Staat sind und somit „Staatskritik“ dann auch eine Infragestellung der eigenen politischen Entscheidungen mit sich brächte, meine ich nicht ironisch.
Vielleicht können Sie mir auf die Sprünge helfen?
@Ute Plass
Klar, meine Äußerung war natürlich ironisch gemeint.
—
Ihre Äußerung erschien mir etwas, sagen wir mal … etwas unrealistisch bzw. an den politischen Realitäten vorbei, insbesondere an der Berücksichtigung der Machtfrage.
Politik ist ja Kampf um Macht, nicht um die beste Lösung oder gar um das Gute. Es geht nur um Macht. Ihre Überlegungen sind gut – und doch könnten sie nur Realität werden, wenn Macht dahinter steht. Welche Kräfte dagegen stünden, ist klar.
Wie auch immer: Ich persönlich bin aber für das Auslosen von Abgeordneten (nicht von Amtsträgern wie z.B. Ministern).
@Veit_Tanzt
Merci!
Möchte Ihre Liste ergänzen:
5. In den 60 – 90-er Jahren hatten sowohl die Jungen wie die Älteren positive, motivierende Zukunftsvorstellungen. Die fehlen heute nicht nur, sondern sind abgelöst durch massive Zukunftsangst, vor allem bei den Jüngeren bis Mittelalten, und das in allen Bereichen: von den Berufsaussichten, der Wohnujngssituation, den Migranten, der weltpolitischen Situation …..
@Fred
Ja, eine wichtige Ergänzung.
Gerne möchte ich zu Ihrer Liste noch einen weiteren Punkt erwähnen:
X. Optimistmus und der Hunger, es besser zu haben
Meine Generation +/- wuchs in Verhältnissen auf, welche man heute als „ärmlich“ oder sogar als „in Armut“ bezeichnen würde. Ohne lange Erklärungen: das Essen war, bezogen auf den Verdienst, massiv teurer, wir hatten ein Radio, aber keinen TV, ein einzelnes Telefon für die ganze Familie, blaba mit freunden war nicht – zu teuer, wir hatten kein Badezimmer, nur WCs – im Keller war ein Badraum für das ganze Haus, das Badwasser mit Holzofen, ein Auto hatten wir sowieso nicht … ich könnte noch länger weiterfahren.
Als ich langsam alt genug war für Träume von Besitz und Erfolg, also zu Beginn der Berufslehre, da träumte ich von einem Auto, von einer schönen Wohnung, von vielen Dingen, die ich gerne hätte, aber nicht hatte – die ich aber theoretisch erreichen konnte.
Die Kinder und Jugendlichen heute – was haben sie nicht und was könnten sie gerne haben, erreichen wollen?
Die Antwort ist: sie haben bereits alles, sie können nicht mehr erreichen – ja tatsächlich, was will man denn noch, wenn man schon mit 8 Jahren ein Smartphone hat, mit welchem man allerhand anstellen kann ? Wenn man als Jugendlicher mehr Geld zur freien Verfügung hat als 1965 eine ganze Familie ?
Wenn man hingegen mit Menschen aus anderen Kulturen Kontakt hat, ich hatte dies mit Asiaten aus mehreren Ländern, dann merkt man genau diesen Hunger. Die indischen Kollegen im Büro mit dem weissen hemd kommen morgens aus Gegenden, welche wir als ärmlich oder noch schlimmer bezeichnen würden.
Sie wollen es besser haben – so wie meine Generation, so wie ich es auch wollte.
Und sind deshalb leistungsbereit und zukunftsorientiert, optimistisch, dass sie etwas erreichen werden, es besser haben werden.
Und sie haben dabei keine Angst, dass die Welt morgen verbrennen werde ….
@Enrico
Ihre Ausführungen belegen eindrucksvoll, warum der Leistungswillen in der heutigen jungen Generation deutlich nachgelassen hat. Ja, da sind Sie – und nicht nur Sie – in Verhältnissen groß geworden, die sich heutige
25-Jährige gar nicht mehr vorstellen können und bestenfalls aus den Erzählungen der Oma kennen – wenn die Familienverhältnisse denn überhaupt so intakt sind, dass sie mit Oma regelmäßigen Kontakt haben. Dabei war es für viele davor, in den 1950er Jahren, sogar oft noch härter und trotzdem ist aus denen etwas geworden – gerade aus denen.
—
Um nun vom allgemeinen Leben zum politischen Leben zu kommen – denn Feistels Artikel zielt ja auf das politische Engagement – kann man schlussfolgern, dass ein eher schwächer ausgeprägter Leistungswille vermutlich nicht nur in einem Bereich auftritt (z.B. Leistungsmotivation in der Schule und im Beruf), sondern auch andere Lebensbereiche dieses jungen Menschen betrifft – etwa der Wille, komplizierte politische Zusammenhänge von verschiedenen Seiten zu betrachten, eine längeres Buch zu lesen und die Bereitschaft zu eigenen zeitraubenden Recherchen ohne eine KI zu verwenden.
Das Ergebnis dürfte dann häufig eine nur oberflächliche und aus relativ wenigen Informationsquellen schöpfende politische Bildung sein. Zu den in der Schule vermittelten Informationen treten daher im Wesentlichen nur das allgemeine Denken des sozialen Umfeldes hinzu, in dem sich dieser Mensch bewegt (bis hin zu ausgesprochenen „Blasen“ der digitalen sozialen Netzwerke) und das Weltbild, das in den gängigen konsumierten Medien vorherrscht.
Der Witz ist nun allerdings, dass solche jungen Leute – ich weiß es aus eigener Erfahrung – sich ihrer Defizite überhaupt nicht bewusst sind und sich – auch wegen des häufigen Lobs ihrer Eltern – für ausreichend informiert, kritikfähig und sogar für klug halten.
Anders gesagt: Viele jungen Leuten ist heute den Maßstab für eine wirklich gebildete, menschlich reife und selbständig denkende Persönlichkeit verloren gegangen. Sie kennen solche Menschen kaum noch. Dies vermutlich auch deshalb, weil ihnen solche Personen nur selten begegnen und weil sie in den gängigen Medien gegenüber dem aktuellen „Bachelor“, lächerlichen „Youtubern“, einem Frauen suchenden Bauern, irgendwelchen Pseudokabarettisten, bedeutungslosen C-Promi-Schauspielern oder Nachwuchspolitikern ohne weiten Horizont bestenfalls ein Schattendasein führen.
Vielen Dank – anfügen möchte ich noch hierzu
dass wir in der Schule damals keine ideologischen Phrasen verabreicht bekamen.
Weder politische noch soziale – unsere Lehrer (da waren auch Lehrerinnen drunter) waren strikt distanziert, streng, fordernd, manche auch unnahbar, und einige waren Arschlöcher- haha – damals in meiner Sicht.
Alle waren sie autoritär, manche waren auch Autoritäten – und erstaunlicherweise hab ich sie alle ohne Dachschaden und psychische Probleme überlebt, und den meisten bin ich dankbar, dass sie mich mehr oder weniger gezwungen haben, das zu lernen, was ich lernen sollte.
Und ohne Zwang … naja … ich war ein sehr fauler , zugleich aufsässiger Schüler – heutzutage hätte ich wohl eine oder zwei Coaches parallel zu den Lehrern …. natürlich Frauen … ich danke Gott, dass ich noch das Vergnügen und die Gnade hatte, mehrheitlich Männer als Lehrer zu haben – dort habe ich auch am meisten gelernt.
Wo, Leute es „besser haben“ haben es Andere dann entsprechend schlechter!
Und genau deswegen, wird es immer Krieg geben.
Diese einfache Logik ist einfach und trifft nicht zu – besser haben ist nicht gleich Ausbeutung – das ist alt-sozialistischens Gebrabbel.
Viele technische Fortschritte kamen allen zugute – ja, nicht allen in gleichem Masse, aber dennoch allen.
Neini das ist einfach anarch/sozialistischer Bullshit, das Sie hier rauslassen.
Es besser zu haben zu wollen als Anderen, ist reaktionäres Gebaren nichts weiter!
Es besser zu haben zu wollen ist der Grund, warum nicht wir nicht mehr in Höhlen wohnen.
Aber Anarchisten lieben wohl Höhlen …alternativ Brücken, oder Kartonschachteln.
Gottseidank ist die Mehrheit der Menschen meiner und nicht Ihrer Ansicht – so kann ich in einem Haus wohnen und nicht irgendwo im Wald – auch heute Abend.
@Motonomer
Das ist nicht reaktionär, sondern ein ganz normaler menschlicher Wesenszug.
Nicht unbedingt ein schöner, aber ein normaler.
So ist die Welt.
Wir waren immer schon nur eine kleine, radikale Minderheit. 😛
Ja, das sagte mein Altautonomer Freund R@iner auch immer, während er mittlerweile seinen Rollator vor sich hin schiebt.
Nur gehen echte Widerständler nicht nur gegen Corona vor allem gegen den Klimawahn und Krieg auf die Straße, sondern vor allem tun sie ganz subversiv etwas um diese Gesellschaft zu stürzen. 😉
Was, zum Schaitan, soll verkehrt sein an:
?!
Was „Anderes“ soll denn bittschön das Dasein eines homo erectus ’sapiensis‘ sein und ausmachen? „Gott“? Spiritismus? Politisches Handeln? (Ahrendt)
Oder, anders herum – und damit Schluss mit akademischem Zeugs – wenn eine „Conditio Humana“ kein neoreligiöser Mystizismus sein soll (R. Barthes), was anderes, als „Arbeit, Fressen, Saufen, Ficken“, enthielte sie?
Gut und schön arbeiten, futtern, feiern und ficken, wäre das nicht „Das Ganze“, um das es Schweinepriestern, die mit auf- oder widerständigen Parolen hausieren gehen – falls sie sich nicht umstandslos politisch oder priesterlich zu schaffen machen – angeblich immer gehe oder gehen soll?
Was, bitteschön, an den Daseins- und Umgebungsvariablen eines menschlichen Daseins, ist mit Gut und Schön arbeiten, futtern, feiern und ficken, nicht angesprochen / enthalten?
(Anmerkung – weil Gracchus es angeschleppt hat:
Das vollständige Zitat von Walter Benjamin lautet:
Die hervor gehobenen Worte sind eine Kritik der Kritik, die dem Benny während des Restes seines kurzen Daseins teilweise einzulösen gelungen ist. Denn religiöse Funktionen („dient essentiell“) des kapitalistischen (bürgerlichen) Reproduktionsgeschehens sind bittschön eine Trivialität, es hat zwar nicht dieselben, aber gleiche Ausgleichsbewegungen von Herrschaft und Unterwerfung in Klassengesellschaften zu leisten, wie es der Monotheismus in den levantinisch – abendländischen Kulturen der voran gegangenen zweieinhalb Jahrtausenden getan hat.)
Will kein Schwein vastanden haben, wa?
Für euch – die meisten unter euch – sind „Fressen, Saufen, Ficken“, neuerlich wohl oft auch „die Arbeit“, legitime Bedürfnisse, weil Triebe, welche gesellschaftlich einer „Sublimierung“ unterlägen, und folglich einer solchen zu unterwerfen seien, um „als Interessen“ gelten zu dürfen. Stichwort „Impulskontrolle“.
Zur ersten Dezennie dieses Kultes hatte der Benny eine seiner merk-würdigen Ideen:
Bitter, daß der Benny die „wissenschaftliche Grundlage“ des freudianischen Kultes nicht kennen konnte, das war eine in den damaligen Nuller-Jahren abgefaßte, auch von Ernst Mach inspirierte, Hydropneumatik (fast buchstäblich, aber natürlich analogisch konzipiert) eines sogenannten Trieblebens, den Arbeitstitel habe ich vergessen, die Freud wohlweislich unveröffentlicht gelassen hatte, weil sie von den christlichen-nationalen Sittlichkeitswächtern in Acht und Bann geschlagen, der Autor wohlmöglich in den Kerker geworfen worden wäre.
Systemtheoretisch betrachtet ist solche Hydropneumatik bis auf den Tag die Grundlage des Kultes einer „Psyche“, von der niemand zu sagen weiß, wo sie zu haben sein soll, weil, sie soll einerseits in der Neuronensuppe eurer Hirnkästen wesen, dort aber nur in pathologischen Grenzfällen auch wohnen, während sie andererseits in den Kulturen wohnen soll, wohin sie aus Hirnkäste fließe.
Hätte der Benny den Aberwitz gekannt, hätte ihm seine achtungsgebietende Intuition nicht den zitierten Quas von der „tiefsten, noch zu durchleuchtenden“ Analogie eingegeben, er hätte begriffen, daß Freud die „göttliche Seele“ vernichtend in die moralische Instanz von Untertanen überführt hatte, welche bürgerliche Gerichtsbarkeit und die seinerzeit erst seit wenig mehr als einer Generation in Amt und Würden gesetzten Irrenärzte adressieren.
Just saying, weils mir gerade wieder aus früheren Studien einkam.
Rischtisch.
Dafür gibt es 👍 👍 👍 Daumen… 😉
Guten Tag!
Dieser Artikel ist der erste im OvertonMagazin, der mich wirklich geärgert hat!
Ich empfinde den Artikel als viel zu verallgemeinernd und triefend vor Selbstmitleid. Letzeres mögen andere nicht so sehen, zugegeben, aber auf mich wirkt dieser so.
Die Bezeichnung dieser Generation alleine schon, genauso wie Generation X, Y, Z und haste nicht gesehen, nervt mich.
Mein Sohn ist 1991 geboren. Was er wird oder auch nicht hat mich nie interessiert. Ich bemühte mich, ihn zu einem denkenden Menschen zu erziehen, wobei gerade die emotionale Intelligenz zu fördern ganz sicher ein Bestreben war. Wenn dem so ist, wird er seinen Weg schon finden, war meine Überzeugung und diese wurde durch seine Entwicklung bestätigt. Ganz gewiss sind wir nicht immer einer Meinung, aber auch und gerade deshalb respektieren wir uns gegenseitig sehr.
Aber dieser Artikel hier….ach Du lieber Himmel.
LG an alle Freunde des OvertonMagazins
Mal
Ja, geht mir ganz ählich und viel zu kurz gedacht.
Obwohl ich so einige Artikel bspw. auf Manova von Felix Feistel sehr schätze.
https://www.manova.news/artikel/dem-erdboden-gleich
Schon in der Friedensbewegung der 80er Jahre sah man viele ganz Junge sowie ältere Menschen, die Krieg und Nazizeit noch erlebt hatten. Die damals etwa 35 bis 50jährigen waren auch damals nicht so zahlreich dabei.
Vielleicht sieht man sich in dem Alter generell eher staatlichen/ökonomischen/gesellschaftlichen Zwängen unterworfen als den unbekümmerten Jüngeren und den Älteren, die ihre Lebenskämpfe weitgehend hinter sich haben.
Aber die Millenials, von denen hier die Rede ist, waren dort ganz sicher nicht dabei. 😉
Tun sie das nicht? Beschäftigen sie sich nicht mit Klimawandel, Umwelt, Natur, Nachhaltigkeit, Krieg(e), Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Politik, Gesellschaft, Tierquälerei, Religionen, Sekten, Gurus, Esoterik, Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Geographie, Literatur, Lyrik, Musik, Sport und Tanz, Geschichte des Krieges, Geschichte der Gesellschaften etc pp?
Denken sie nicht über den Sinn des Lebens nach? Denken sie nicht in der Kategorie Zukunft?
Doch, das tun sie, wie jede Generation im Rahmen des Möglichen vor ihnen.
Die Möglichkeit zum Denken und des Austausches über all diese Dinge sowie des Aus- und Erlebens all dieser Dinge sind den heutigen und den vorherigen Generationen allerdings in einem zeitlichen und räumlichen Ausmaß gegeben, von den frühere Generationen bzw. Gesellschaften nicht mal geträumt haben: beispielsweise verhindert die Schulpflicht in vielen Ländern die Kinderarbeit! Allein die Kinderarbeit in früheren Zeiten verhindert genau das, was der Autor für Kinder und Jugendliche fordert:
„Überhaupt erst einmal selbst zu entdecken, wer man ist, was man will vom Leben, wie man sich selbst entwickeln kann, ist überhaupt nicht vorgesehen.“
Das ist so falsch, falscher geht’s nicht!
Die berechtigte Kritik an der (erfolgreichen) propagandistisch verseuchten und damit manipulierten Gesellschaft jetzt alleine an der Generation Y festzumachen, ist der falsche Ansatz.
.
Die Frage nach der Sozialisation ergibt sich notwendigerweise aus der Problemstellung; die Antwort ob eine Traumatisierung der Generation Y kollektiv gegeben ist, greift einer sachlichen und damit seriösen Herangehensweise vor, für die übrigens keinerlei Belege* angeführt werden.
Nur weil die Generation nicht in den Dingen genauso denkt, kritisiert und demonstriert wie der Autor, heißt das nicht, dass sie nicht kritisch denkt und handelt, sondern nur, dass sie im Auge des Betrachters, des Autors, falsch denkt, falsch handelt, falsch rebelliert.
Merkwürdigerweise findet dieser Punkt am Ende des Textes seine Erwähnung, bleibt aber trotz der Thematik komplett folgenlos.
.
„Und da wir jung und wehrlos waren, wussten wir noch nicht einmal, ob wir das wollten. Zumindest die Meisten wussten es nicht.“
Oder nur wenige? Oder nur der Autor?
Diese sofortige Relativierung der zuvor absolut gesetzten Aussage symbolisiert die Gedanken des Autors im gesamten Text repräsentativ: die der Projektion.
Deshalb ist es müßig, die Gedanken des Autors en détail kritisch zu hinterfragen. Als Meinungsäußerung im Sinne der anekdotischen Evidenz aber durchaus empfehlenswert.
Auf ein Detail möchte ich aber noch grundsätzlich eingehen:
Eltern sind von Anfang an natürliche Autoritätspersonen, keine „Möchtegern-Autoritäten.“
Selbstverständlich darf jeder die (soziologischen) Erkenntnisse ignorieren. Die Frage der Sinnhaftigkeit ob der methodischen Finesse lasse ich mal außen vor.
–
Das Schlusswort hat der Autor:
.
*“Gott“ ist kein Beleg
Guter Kommentar 👍
Erstmal nur so viel.
Das sogenannte „Umfeld“ bezieht sich eben nicht nur auf die Eltern, sondern auf das gesamte gesellschaftspolitische Umfeld, das sich dann nämlich spätestens seit den 80ern neoliberal entwickelte und dementsprechen seinen Fokus auf Anpassung und Einschwörung auf den kapitalistischen Verwertungsprozess fokussierte, während noch zu 68er Zeiten auch schon von einigen Eltern das Gegenteil, wenn auch nicht unbedingt vorgelebt, aber zumindest größtenteil propagiert wurde.
Und auf „Gott“ respektive die Religionen, können wir nun wirklich ganz verzichten, da sie alle Teil des Problems sind.
Guten Abend Dan
Ich finde den Kommentar ganz ausgezeichnet!
Eine sehr gehaltvolle und unaufgeregte Kritik, welche dazu führte, das mein zunächst empfundener Ärger sozusagen „verrauchte“. (s.o.)
Dafür möchte ich mich bedanken!
Danke für die Blumen 😉
Das Moralisieren bezüglich „der Jugend“ soll was genau bewirken?
Hier eine Klage-Litanei über die Jugend:
5000 Jahre Kritik an Jugendlichen – …“
https://bildungswissenschaftler.de/5000-jahre-kritik-an-jugendlichen-eine-sichere-konstante-in-der-gesellschaft-und-arbeitswelt/
Ein Punkt, der mir im Text fehlt, ist die immer flächendeckendere Sozialisation mit der Smartphone-„Wisch und weg“-Mentalität, die generationenspezifisch die Fähigkeit zu komplexerem Denken immer mehr verkümmern lässt.
Ansonsten erscheinen mir viele Gedanken doch schon älter und in weiten Teilen erinnert mich das Essay an eine moderne, nüchterne Version dessen, was schon John Lennon in Working Class Hero besungen hat … nur dass der Autor leider am Ende keinen Ausweg aus der Perspektivlosigkeit bietet, während John Lennon eine klare Perspektive bietet:
„A Working Class Hero is something to be!“ https://www.youtube.com/watch?v=Huq1_pHGl8A
Klassenbewusstsein als Basis nicht nur jeglichen politischen Bewusstseins, sondern auch des sozialen (Selbst-)Bewusstseins als stolzes Mitglied der Menschheitsfamilie.
Gen Y sind die Jahrgänge 1981-1995. Wann wäre denn jemals irgendeine Protestbewegung von 25-40jährigen ausgegangen?
In dem Alter ist man damit beschäftigt, Familie zu gründen, Karriere zu machen usw. Das war schon immer eine Lebensphase maximaler Konformität, geprägt von dem Wunsch, möglichst wenig öffentliche Angriffsfläche zu bieten.
Dass das Internet jegliche Angriffsfläche potenziert, hat da sicher auch nicht geholfen.
Rentner haben Zeit für Protest und weniger Konsequenzen zu befürchten. Kinder und Jugendliche haben Zeit für Protest und denken noch nicht an Konsequenzen.
Im mittleren Alter hat man keine Zeit und man weiß, dass man womöglich seine Lebensgrundlage verliert und seine Familie exponiert, womit auch das soziale Umfeld gemeint ist, wenn man zum „Querdenker“ wird.
Ich habe sicherheitshalber mal „Millennial“ gegoogelt:
Witzig, dass Wikipedia der Generation „Hinterfragen“ unterstellt, während der Autor eher das Gegenteil wahrnimmt.
Außerdem war ich überrascht, wie früh das ansetzt, ich dachte intuitiv immer, das seien die um die Jahrtausendwende geborenen. Meine Frau ist Jahrgang 1980, die zählt also fast noch dazu und ich bin auch nur wenige Jahre älter.
Willkommen im Alltag, in Friedenszeiten, in einem kalten, nassen und dunklen Land wie Deutschland. Für die Abwechslung musste man schon selbst sorgen (etwa in dem man Kinder macht), heutzutage sind die Ablenkungen hingegen omnipräsent und haben Suchtpotential, ich bin gespannt, wie die heutigen Generationen werden (und verkneife mir mal bewusst meinen Alterspessimismus).
Ja, die prekären 90iger halt, besonders im Osten ziemlich hart. Natürlich nicht vergleichbar mit den Kindern der Wirtschaftswunderzeit.
Habe ich überwiegend nicht so erlebt, hängt wahrscheinlich stark vom Umfeld ab. Manchen Alltags- und Bildungszwängen konnte man nicht aus dem Weg gehen, das war lästig, ist in einer Industriegesellschaft aber bis heute nicht vermeidbar, wenn man ein gewisses Wohlstandslevel halten will.
Na ja, mag der Autor so krass empfunden haben, ich finde die Darstellung ein bisschen übertrieben. Die Frage, wie man ein Kind zu einem gebildeten Erwachsenen macht, der in der Lage ist, eine Familie zu ernähren und Verantwortung zu übernehmen, ist leider absolut nicht trivial, weil tatsächlich jedes Kind anders ist und Kinder nicht wissen, was sie im Leben erwartet, sie zumindest mit „subtilem Zwang“ ein bisschen vorzubereiten, lässt sich vermutlich nicht vermeiden. Montessori und Walldorf-Schulen etc. experimentieren da ja seit Jahrzehnten, keine Ahnung, wie da die Ergebnisse sind (sind die Erwachsenen zufriedener, kreativer, gebildeter, kritischer im Denken etc.?)
Die Kritik in Ehren, aber Leute, die mit der Standardkost unzufrieden sind, entdecken ihre tatsächlichen Freiheiten normalerweise im Laufe des Lebens ganz von selbst, andere wären u.U. damit sogar überfordert und brauchen ein engeres Korsett, um sich wohlzufühlen.
Heutzutage wird mir „Trauma“ erheblich zu oft im Mund geführt! Es entwertet den Begriff! Was sollen denn meine Eltern (aufgewachsen in der trostlosen DDR) und meine Großeltern (geboren unter den Nazis, aufgewachsen in Krieg und Nachkriegszeit) sagen? Keine Sekunde würde ich mit denen wechseln wollen. Dieses Weinerliche ärgert mich regelrecht!
Bei allem Selbstmitleid: nennen Sie eine Gesellschaft, in der man sich besser und freier verwirklichen kann, als die westliche! Keine Clanzwänge, Wohlstand und soziale Absicherung, die einem erlauben, auch mal zu experimentieren, hoher (kostenlos erreichbarer) Bildungsstand, ziviler Umgang miteinander, Reisefreiheit, (theoretisch) Meinungsfreiheit etc. pp. es zeigt sich (wie immer): man kann einfach nicht schätzen, was man schon immer hatte!
Das Leben ist halt (fast immer) eine Herausforderung, spirituell könnte man sagen: wir inkarnieren hier, um genau das zu erleben (und wahrscheinlich haben wir uns sogar vorher ausgesucht, was wir erleben wollen).
Warum demonstrieren Milleniels nicht? Ich kann nur sagen, weshalb ich das nicht tue:
1) ich glaube nicht an die Wirkung (nicht bei den aktuellen ÖRR-Lügenmedien)
2) es gibt in der globalsierten Welt zu viele Krisen, die man weder wirklich einschätzen noch ändern kann, zumal man immer nur die Hälfte der Wahrheit erfährt
3) der Alltagsstress aus Familie und Beruf fordert mich ausreichend
4) ich bin bewusst weit weg gezogen, von den überteuerten und gedrängten Städten (auch eine feine Art von Freiheit)
Sehr gut nachvollziehbar und durchaus sympathisch, was Sie schreiben. Ich würde sagen, stimmt bis in die 90-er. Ab da gings bergab und mittlerweile ist es schon ziemlich ungemütlich geworden – vielleicht nicht so bei Ihnen in der Provinz.
Dass man sich bei uns frei äußern kann, stimmt zwar. Man muss aber mittlerweile einigen Mut aufbringen, um das zu tun und mit dem Risiko rechnen, mit gerichtlichen Instanzen in Berührung zu kommen und/ oder berufliche/ finanzielle Nachteile zu erleiden.
Auf jeden Fall hat sich das Binnenklima – in uns – gewandelt und wir versuchen, jeder auf seine Art, darauf zureagieren.
Die 68-er hatten den schönen Spruch: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Ist was dran.