
Bei der Frage zur Mobilisierungsfähigkeit der Friedensbewegung gibt es unterschiedliche Ansätze. „Die eine Friedensbewegung“ gibt es nicht.
Zusammenfassung eines Gespräches zu Grundsatzfragen der Friedensbewegung von Reiner Braun und Ralf Becker. Die Fragen stellte Karl-Heinz Peil, der auch die Antworten auszugsweise zusammengestellt hat.
Ralf Becker ist Koordinator der Initiative „Sicherheit neu denken“, die sich unter dem Dach des europäischen friedenskirchlichen Netzwerks „Church and Peace“ für eine nachhaltige Zivile Sicherheitspolitik engagiert. Sie wird in Deutschland, Europa und Afrika von zahlreichen Organisationen und Netzwerken unterstützt. Aktuell ist das Anfang Januar veröffentlichte Konzeptpapier „Positivszenario 2025-20240 – Europas Rolle für den Frieden in der Welt“.
Reiner Braun ist seit Jahrzehnten Initiator von Aktivitäten der deutschen Friedensbewegung und bereits langjährig in führender Position im International Peace Bureau (IPB) tätig.
Beide stehen für unterschiedliche Blickwinkel auf die Friedensbewegung, für das Grundverständnis dazu, was man überhaupt als Friedensbewegung verstehen soll, sowie kurz-, mittel- und langfristige Zielorientierungen.
Bei dem ausführlichen Videogespräch ging es um den Austausch zu Grundsatzfragen der Friedensbewegung angesichts aktueller Herausforderungen auf drei Ebenen:
- Personalisierende versus analytische Sichtweisen
- Bündniskonstellationen und Abgrenzungen
- Mobilisierungsfähigkeiten: Bedrohungsängste und positive Zukunftsvisionen
Nachfolgend in redaktionell komprimierter Form die wesentlichen Inhalte:
Karl-Heinz Peil: Inhaltliche Auseinandersetzungen sind zunehmend davon geprägt, dass im friedenspolitischen Diskurs moralisierende Sichtweisen und Personalisierungen dominieren. Ein jüngstes Beispiel dafür ist eine Titelseite der Wochenzeitschrift stern: Diese zeigt eine Karikatur mit Trump und Putin mit einer Leiche auf dem Boden, die mit der Ukrainefahne bedeckt ist. Der Titel: „Die Achse der Bösen“. Wie stellen wir uns dazu?
Ralf Becker: Gegen eine Befangenheit in personalisiertem Gut-Böse Denken zeigen wir ein friedenslogisches Szenario auf, das uns aus den mit diesem Bild verbundenen Ängsten herausführt. Es gilt, Feindbilder in alle Richtungen zu überwinden. Wenn ich Konflikte nachhaltig und gewaltfrei lösen möchte, braucht es den Blick auf die komplexen Konfliktursachen und auch auf unsere eigenen Anteile am Konflikt. Wenn ich die Gegenseite verstehe, muss ich deswegen natürlich noch nicht mit deren Vorgehensweise einverstanden sein.
Reiner Braun: Wir müssen statt der Personalisierung die politischen und geostrategischen Herausforderungen analysieren. Dazu gehören Fragen wie: Was ist die Rolle Russlands heute, nicht nur als Kriegspartei in der Ukraine, sondern als eines der führenden BRICS- Staaten mit einer herausgehobenen Rolle gegenüber vielen Ländern der Dritten Welt. Dazu kommt die Frage: Kann man mit der jetzigen russischen Führung auch wieder Entspannungspolitik aufbauen? Eine Diskussion darüber, ob Putin ein Kriegsverbrecher ist, halte ich für kontraproduktiv. Natürlich ist er das. Entspannungspolitik jedoch heißt, dass man notwendig mit politischen Gegnern, auch mit Kriegsverbrechern, reden muss, um gemeinsame Lösungen für den Frieden zu finden.
Karl-Heinz Peil: Seit Beginn der Ukrainekrise 2014 gibt es Kontroversen in der Friedensbewegung. Seinerzeit waren es die Mahnwachen, die als umstritten galten. Aktuelle Auseinandersetzungen betreffen die Entwicklungen aus der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen 2020 und 2021, woraus sich viele Aktivitäten als neue Friedensbewegung entwickelt haben – nach eigenem Verständnis. Diese werden als rechtsoffen deklariert, während man auf deren Seite von einer „Ausgrenzeritis“ durch die „alte“ Friedenbewegung spricht. Lässt sich ein Kompass entwickeln, um diese bestehenden Kontroversen beizulegen?
Ralf Becker: Das von der Initiative „Nie wieder Krieg“ zum Vorwurf der Rechtsoffenheit veröffentlichte Positionspapier ist eine hervorragende Grundlage, um dazu ins Gespräch zu kommen. Es braucht eine klare Abgrenzung von Rechtsextremismus und Faschismus. Da sind wir uns wohl alle einig. Und ich halte es für klug, zu unterscheiden zwischen Rechtsextremismus und Rechts. Rechts ist in unserem politischen Spektrum quasi die Hälfte der Bevölkerung, im Moment nach den Wahlergebnissen sogar ein bisschen mehr. Und insofern muss ich als Friedensbewegung rechtsoffen sein. Ich will nämlich eine Mehrheit der Gesellschaft, nicht nur die Linken, die oft in der Minderheit sind, für eine vernünftige Zukunftspolitik gewinnen und damit für Abrüstung und für Friedenspolitik. Auch unsere Initiative „Sicherheit neu denken“ versteht sich für alle politischen Seiten offen. Die Frage ist dann: Wo genau setze ich diese Grenze? Hilfreich ist es, Dialoge mit Personen, die Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen haben, im geschützten Raum zu führen, um zu vermeiden, Rechtsextremismus zu legitimieren.
Reiner Braun: Diese Diskussion kommt ja immer dann besonders hoch, wenn es kleine Aktionen gibt , bei denen die Differenziertheit der unterschiedlichen Kräfte sichtbar wird. Bei großen Aktionen mit entsprechender Ausstrahlungskraft setzt sich erst mal der inhaltliche Konsens fast alleine durch. Deshalb plädiere ich dafür, unsere Aktionen so überzeugend und aussagekräftig wie irgend möglich zu machen. Das heißt nicht, dass wir in irgendeiner Weise mit Rechtsextremisten zusammenarbeiten. Das gilt insbesondere für die AfD, die für uns wegen ihrer militaristischen Aufrüstungspolitik in keinster Weise eine Friedenspartei ist. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht zu früh fragwürdige Gruppierungen diese mit einem Stempel versehen und ausgrenzen.
Karl-Heinz Peil: Wenn man von zentralen Herausforderungen der Friedensbewegung spricht, dann geht es vor allem um inhaltliche Schwerpunkte, wie das derzeit gegen die geplante Raketenstationierung der Fall ist. Ebenso gravierend sind die für alle Menschen spürbaren Probleme der öffentlichen Daseinsvorsorge. Vor allem die drohenden Kürzungen von Sozialausgaben zugunsten von Rüstungsausgaben sind zu vermitteln. Wie kommen wir strategisch mit der vorhandenen thematischen Vielfalt zurecht?
Reiner Braun: Von der jetzt laufenden Hochrüstung sind wirklich mit Ausnahme der wenigen, die davon profitieren, alle betroffen. Widerstand in großer gesellschaftlicher Breite und Vielfalt heißt für mich, dass vor allem Gewerkschaften und Kirchen präsent sein müssen. Die Schwierigkeit liegt vor allem bei den Gewerkschaften in der leider engen Zusammenarbeit mit den unsozialen und kriegerischen Bundesregierungen, von der sie sich deutlich mehr versprechen als von einer Opposition mit uns. Das ist nachvollziehbar. Um dort zu überzeugen und präsent zu sein, müssen wir vor allem die kurzfristige Militarisierung ablehnen.
Ralf Becker: Konsens mit Gewerkschaften und Kirchen, also großen Bewegungen außerhalb unserer Friedensblase, erreichen wir leichter in der Ablehnung mittel- und langfristiger militärischer Aufrüstung. Ich glaube, man muss im Moment akzeptieren, dass viele Menschen eine kurzfristige Aufrüstung unterstützen wegen des Verlusts von Sicherheitsgarantien durch die USA. Wir sollten als Friedensbewegung alles dafür tun, dass unsere Gesellschaft möglichst schnell aus dieser Akzeptanz militärischer Aufrüstung rauskommt und versteht, dass wir allein schon zur Bewältigung der Klimakrise dringend eine Demilitarisierung brauchen. Wenn wir den Menschen eine positive Vision als überzeugende Alternative vermitteln, können wir auch gleichzeitig sagen: Was im Moment passiert, ist Wahnsinn und wir sind dagegen. Kurz- und langfristige Sichtweisen und Ziele zusammen wirken dann überzeugend.
Zusammenfassung
Schwierigkeiten in Bündniskonstellationen mit Gewerkschaften und Kirchen als relevante gesellschaftliche Kräfte resultieren daraus, dass sich diese aus nachvollziehbaren Gründen weniger als Opposition, sondern als Gesprächspartner für Regierende verstehen. Damit ist auch eine andere Herangehensweise verbunden, als bei dem aktionsorientierten Teil der Friedensbewegung, der sich bewusst als Opposition, d.h. gegen den Mainstream gerichtet, versteht. Dabei hat die Friedensbewegung nach wie vor große Teile der Bevölkerung hinter sich, bei denen die forcierte Aufrüstung und Kriegspolitik auf Ablehnung stößt.
Bei der Frage zur Mobilisierungsfähigkeit der Friedensbewegung gibt es unterschiedliche Ansätze.
Für Reiner Braun ist besonders wichtig, kurzfristig möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen, insbesondere gegen die unmittelbare Bedrohung mit der geplanten Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen.
Mit der von Ralf Becker koordinierten Initiative „Sicherheit neu denken“ und ihren positiv konnotierten Szenarien sollen zunächst breitere Bevölkerungskreise sensibilisiert, informiert und überzeugt werden, um mittelfristig eine breitere, wirksame Friedensbewegung aufzubauen.
Das Gespräch hat aufgezeigt, dass es nicht „die“ Friedensbewegung gibt, sondern unterschiedliche Strömungen, wofür Ralf Becker und Reiner Braun beispielhaft stehen. Dieses besagt nicht, dass hieraus strategische Kontroversen entstehen müssen. Dieses zeigt sich vor allem in einem souveränen Umgang mit dem Stichwort „rechtsoffen“. Natürlich gibt es viele Meinungsunterschiede, z.B. zum Ukrainekrieg. Diese können aber in einem respektvoll ausgetragenen Diskurs debattiert werden. Vielmehr geht es um ein wechselseitiges Verständnis dafür, dass unterschiedliche Herangehensweisen sich auch an spezifische Zielgruppen richten. Über allem steht dabei die Frage, wie eine Vervielfältigung des friedenspolitischen Engagements erreicht werden kann. Obwohl mittlerweile die mediale Kriegspropaganda sich auch in Mehrheitsmeinungen der Bevölkerung niederschlägt, ist nach wie vor eine starke Minderheit nicht „kriegstüchtig“. Diese gilt es zu aktivieren – und zugleich weitere Kreise für die Möglichkeit friedenslogischer, nichtmilitärischer Politik zu gewinnen. Es besteht Konsens darüber, dass dieses nur über Konzepte zur globalen, gemeinsamen bzw. inklusiven Sicherheit und umfassender zwischenstaatliche Kooperation erfolgen kann. Der Faktor Angst um die eigene Zukunft und die der Menschheit ist dabei natürlich nicht außen vor, wird jedoch unterschiedlich gewichtet.
Am 7. April: Podiumsdiskussion zu Europas Rolle für den Frieden in der Welt. Auf dem Podium: Ralf Becker und Reiner Braun. Moderation: Susanne Grabenhorst. Sie können sich per Zoom einwählen: https://us02web.zoom.us/j/83424115173?pwd=S21nMTRvc0tIVzBSR1pIb0I5dzF0Zz09
Mehr dazu hier.




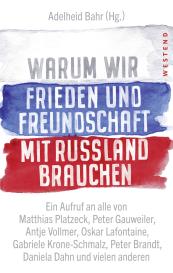
Solange 99 % der Bevölkerung lieber einen faulen Kompromiss mit dem Kapital, der kapitalistischen Wirtschafts und Eigentumsrealitaet eingehen, um ein bißchen Teilhabe am Leben zu erkaufen oder zu erbetteln, als das Krebsgeschwuer der Kapitalgier rauszuschneiden und langfristig gesund leben zu kennen, wird es keinen Frieden geben.
Mit den pathologisch gierigen Psychopaten der Elite weltweit kann man nicht verhandeln!
Was hatte ein „Habenichts“ bei einem „Handel“ zu bieten?
Wir koennen den Superreichen Kriegstreibern und deren Funktionseliten das Leben (Ueberleben) nur so teuer machen, das selbst sie es nicht mehr bezahlen kennen.
Wenn wir Menschen aber demnächst nicht einmal mehr zur Schaffung von Mehrwert benötigt werden, haben wir die letzte Waffe aus der Hand gleiten lassen.
Eine Friedensbewegung sollte verhindern helfen, das wir uns untereinander totschlagen, mit den Kriegs und Massenmordeliten sollten wir nicht mehr friedlich umgehen.
Wir sind HEUTE in einer Notwehrsituation!
wers jetzt nicht begreift steht schon vorm offenen Massengrab
„wegen des Verlusts von Sicherheitsgarantien durch die USA“
—————
Vor wem schütz(t)en uns eigentlich die USA und ist(war) ihre Anwesenheit nicht eher eine Unsicherheitsgarantie?
Jedenfalls hört sich der „atomare Schutzschirm“ schon sehr beschönigend an – es ist halt eine gegenseitige Vernichtungsdrohung. Wer natürlich der Meinung ist, „wir“ seien ohnhehin die, ähem, Guten, wird auch hier reine Selbstverteidigung sehen…
Die faktisch erfolgreichste Zeitspanne der deutschen `Friedensbewegung´ könnte die Durchsetzung einer zeitlichen Verschiebung der Stationierung von Cruise Missiles in den achtziger Jahren gewesen sein.
Nach meiner Erinnerung wurde sie seinerzeit erfolgreich, weil sie sich mit konkreten Veränderungen im eigenen Land befasste und weitgehend darauf verzichtete, verzichten konnte, sich direkt auf internationale Konflikte und die Schuld von Beteiligten zu beziehen. Moralische statt materielle Argumente fördern nämlich den Spaltpilz.
In den größen Städten hatte ein Teil der heute gern „überaltert“ genannten Bevölkerung noch eine Erinnerung an die ersten 10 – 20 Jahre nach dem Krieg. Diese Erfahrung wird aber leider in den westlichen Bundesländern gegenwärtig überdeckt durch möglicherweise gute Erinnerungen der seinerzeit bevorrechtigten Zuzügler aus den östlichen Teilen Deutschlands und Europas. Diese erfuhren nämlich in Westdeutschland eine Behandlung, die aus meiner Sicht von der örtlichen Bevölkerung nicht unbegründet als privilegiert wahrgenommen wurde.
Jeder Krieg ist eine ungeheure Vernichtung der Ergebnisse menschlicher Arbeit und hat eine Jahrzehnte dauernde Verarmung der Bevölkerung zur Folge. In ALLEN politischen Systemen. Langwierige und kostenträchtige Leistungen des Wiederaufbaus können nur von Kriegsprofiteuren als „Aufschwung“ gedeutet werden.
Wer davon spricht, dass mit dem Abschluss eines Friedensvertrages ein Krieg beendet sei, der lügt. Die zukünftig leidtragenden Teile der Bevölkerung sind als solche zu erkennen, zu beschreiben und anzusprechen. Erst Recht wenn der Kreis der Kriegsprofiteure immer kleiner wird und der Kreis der Leidtragenden unübersehbar. Selbst IGMetall-Betriebsräte, die um die politische Unterstützung von Rüstungsunternehmen betteln, taugen gegenwärtig nicht mehr zur Verschleierung dieses Unterschieds. Das zeigt das Engagement von Kollegen, die dagegen protestieren, dass man ihnen das Bauen dringend gebrauchter Bahnen unmöglich macht und sie zum Bau gepanzerter Fahrzeuge zwingt.
Am Ostersamstag findet wie immer die Auftaktkundgebung der sog. Ostermärsche 2025 in Duisburg statt. Dort wird wie in den letzten Jahren der Hauptredner Reiner Braun wieder den größten Teil der Redezeit vor einer überschauberen Zuhörerschaft für sich in Anspruch nehmen. Wenn Reiner Braun zurecht die NATO angreift, dann aber auch mal Russland als Kriegstrieber erwähnt, findet das allerhöchstens in einem Nebensatz statt. Bestanden die Teilnehmer auf der Rednerliste vor einigen Jahren u.A. noch aus Pax Christi, dem Darmstädter Signal, MLPD oder der Seebrücke, haben sich viele Organisationen zurückgezogen, so dass in den letzten Jahren auch immer weniger Demonstranten zu verzeichnen waren. Selbst das BSW mit einem kleinen Stand war wohl eher dem Europa-Wahlkampf geschuldet.
Leider ist das Bündnis Sarah Wagenknecht im Irrglauben, durch den Weg in die bürgerlichen Parlamente eine Kehrtwende in der Kriegspolitik zu erreichen. Warum setzt sie ihren Einfluss nicht durch und veranstaltet wieder wie in Berlin eine Großdemo, wo sie hunderttausende Menschen auf die Strasse gebracht hat. Änderungen in der Politik kann man nur durch Massenaufstände und Streiks erreichen. Das haben z.B. die Bergleute 1997 durch ihren Massenstreik eindrucksvoll bewiesen, denn ein Jahr später war die Kohl-Regierung weg. Dummerweise ist das Prekariat durch die anschließende Rot/Grüne Schröder/Fischer Regierung vom Regen unter Umgehung der Traufe direkt in die Jauchegrube gekommen.
Nur noch wenige Menschen haben selber den letzten Krieg auf deutschem Boden erlebt, schon gar keiner dieser verlogenen Politiker. Die Gewerkschaftsführer haben sich komplett in die Kriegstrommler eingereiht, deshalb auch kein Aufruf ihrerseits zu irgendwelchen Friedensdemos. Im Bundestag sitzen nur noch Kriegstreiberparteien, auch die AfD ist eine davon, denn sie verlangt eine Verdoppelung der Militärausgaben. Wofür, hat die sich gerne als Putin-Trump-freundlich bezeichnende Weidel noch nicht verraten.