
Politische Debatte erscheinen dieser Tage zwecklos – vorgefertigte Welt- und Menschenbilder behindern einen ergebnisoffenen Diskurs.
Sicher haben Sie sich auch schon einmal eine Talkshow oder ein politisches Magazin angesehen, bei dem Politiker von verschiedenen Parteien oder Strömungen eingeladen waren. Und dabei sind Ihnen mindestens zwei Dinge aufgefallen: Erstens ist es erschreckend leicht, vorherzusagen, welche Meinungen und Argumente die jeweiligen Politiker zu einem Thema vorbringen werden. Zweitens tragen Gesprächsrunden in den Medien bestenfalls zur Sammlung der verfügbaren Meinungen bei, jedoch nie zu irgendeiner Art von Annäherung oder Konsens. Warum das so ist erklärt Bestsellerautor Bernhard Hommel in seinem neuen Buch und zeigt, wie wir uns wieder besser verstehen können.
Roberto De Lapuente hat mit dem Psychologen Bernhard Hommel gesprochen.
De Lapuente: Herr Hommel, Sie schreiben, dass politische Debatten oft vorhersehbar und fruchtlos sind. Reden ist Silber, Schweigen Gold?
Hommel: Nun ja, meine Einschätzung der politischen Debatten habe ich wahrscheinlich nicht exklusiv: dass die vorhersagbar und fruchtlos sind, zählt also nicht als steile These. Nur habe ich mich eben in diesem Buch gefragt, warum das so ist. Leute, die in die Politik gehen, möchten ja eigentlich kommunizieren, und vielen nehme ich ihre ernst gemeinten Ziele durchaus ab. Und miteinander reden wird ja von vielen als wichtiges Ziel und als Basispfeiler unserer Demokratie verstanden. Wie also kann es sein, so habe ich mich gefragt, dass die Gespräche doch immer so fruchtlos bleiben. Und meine kurz gefasste Antwort ist, dass wir uns in unserem Grundverständnis darüber, wie Menschen eigentlich funktionieren, zu stark unterscheiden. Unsere Menschenbilder passen so schlecht zueinander, dass sie sich nicht mehr ineinander übersetzen lassen. Und so scheitern unsere Gespräche eben.
De Lapuente: Warum unterschätzen wir so stark die Rolle von Menschenbildern hinter politischen Positionen?
Hommel: Jede Annahme, jede Schlussfolgerung, jede Meinung, ob nun rational oder irrational, basiert auf bestimmten Basisannahmen, die wir in der Regel nicht hinterfragen. Das ist normal, und entspricht dem, was wir in der Wissenschaft Axiome nennen. Wir fangen nicht bei jedem Gedanken von null an, sondern setzen viel voraus. Besonders wichtig für das alltägliche Miteinander und das politische Gespräch sind dabei unsere Menschenbilder, die wir wahrscheinlich selbst gar nicht vernünftig beschreiben könnten. Weil wir sie sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen haben. Sie bestimmen, was wir normal und selbstverständlich finden, und das macht es natürlich schwer, sie kritisch zu hinterfragen.
»Etwas mehr Respekt, etwas mehr Empathie und Perspektivenwechsel beiderseits braucht es schon«
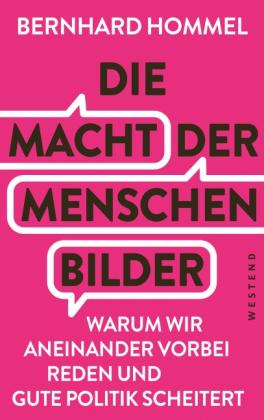
De Lapuente: Sie unterscheiden zwischen einem agentiven und einem reflektorischen Menschenbild. Wie kann man die beiden Begriffe kurz und prägnant erklären? Und welches der beiden Menschenbilder ist Ihrer Meinung nach derzeit in der deutschen Politik dominanter – und warum?
Hommel: Das sind natürlich nur zwei Extreme, und man könnte sich einige andere dazu denken. Aber zur Beschreibung der politischen Landschaft eignen sie sich ganz gut. Unsere Erfahrungen mit Corona haben beide Menschenbilder besonders schön sichtbar gemacht: Die einen denken, der Mensch sei ein rationaler Akteur und könne von guten Argumenten überzeugt werden. Sozial unverträgliches Verhalten kann dementsprechend durch die Darbietung besserer Information und überzeugenderer Argumente korrigiert werden. Die anderen denken, pädagogische Konzepte seien zur Verhaltenslenkung erforderlich, klare Regeln, die zum Beispiel vulnerablen Minderheiten schützen. Diese beiden Menschenbilder führen zu sehr unterschiedlichen Herangehensweisen und zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen von Risiken und politischen Erfordernissen, und wir haben sie beide in unterschiedlichen Phasen des Umgangs mit der Pandemie erlebt. Statt sich aber die Relativität der aus diesen Menschenbildern fließenden Perspektiven zu realisieren, und sich dementsprechend kommunikativ und versöhnlich aufzustellen, wurde jeweils eine Sichtweise verabsolutiert. Da jedes Menschenbild auch ein Körnchen Wahrheit in sich trägt, ist das natürlich außerordentlich unvernünftig.
De Lapuente: In Ihrem Buch kritisieren Sie beide Menschenbilder als unzureichend. Was müsste ein »drittes« oder erweitertes Menschenbild enthalten, um politisch tragfähig zu sein?
Hommel: Ein irgendwie besseres Menschenbild gibt es nicht. Menschenbilder dienen der kognitiven Vereinfachung, die ist einerseits individuell nützlich und vielleicht auch für den Alltag erforderlich. Aber es bleibt andererseits eine Vereinfachung, die uns vor Teilen der verwirrenden Realität schützen soll. Die Realität ist leider widersprüchlich, und die vernünftige Regulation menschlicher Interessen ja ohnehin. Deswegen ist das Haben eines Menschenbildes viel angenehmer als das Erlernen von Techniken, um mit den Widersprüchen besser umgehen zu können. Es gibt also nicht viel individuelle Belohnung dafür, das beschränkende Menschenbild über Bord zu werfen. Wenn man es aber wollte, so müssten wir mental deutlich widerstandsfähiger werden, lernen, besser mit Widersprüchen umzugehen, sie tatsächlich ganz dialektisch als Weg zu besseren Lösungen zu verstehen, und vielleicht sogar über die Zeit eine Lust an Widersprüchen zu erwerben. Als Wissenschaftler habe ich gelernt, Widersprüche richtig klasse und vor allem intellektuell anregend zu finden. Sich ihnen zu stellen führt immer zu besseren Lösungen.
De Lapuente: Sie ziehen viele Beispiele aus der Corona-Politik heran: Was zeigt uns die Pandemie besonders deutlich über die Grenzen unserer Menschenbilder?
Hommel: Interessant an dieser Zeit und den vorgebrachten Argumenten fand ich, dass jede Perspektive eigentlich sehr gut verständlich war. Was kann daran falsch sein, Menschen vor dem frühen Tod zu bewahren? Was kann daran verkehrt sein, auf die bürgerliche Freiheit zu pochen? Das intellektuell spannende an so einer Situation besteht doch darin, alles irgendwie sachlich und rational zu halten, und unter einen Hut zu bringen. Aber das hat ja keine der Seiten probiert. Im Gegenteil, jede Seite hat die jeweils andere lächerlich gemacht, verhöhnt und als irrational markiert. So kommen wir gesellschaftlich nicht weiter. Etwas mehr Respekt, etwas mehr Empathie und Perspektivenwechsel beiderseits braucht es schon, aber diese Fähigkeiten sind uns gesellschaftlich schon länger abhandengekommen.
»Es wäre doch schön, politisch ganz Andersdenkende besser zu verstehen«
De Lapuente: Bringen uns Menschenbilder, die im Grunde ja nur Stereotype sind, überhaupt weiter?
Hommel: Der Vorteil eines Menschenbildes für die jeweilige Person besteht darin, dass sie die Vielfalt möglicher Werte gewichtet und systematisch organisiert. Gewichte ich die Freiheit, und vor allem meine eigene Freiheit, höher als die gesundheitlichen Risiken für andere, auch wenn sie von mir ausgehen (weil ich zum Beispiel keinen Bock habe, eine Maske zu tragen)? Ist mir das Wohlergehen anderer Leute so viel wichtiger als die Schulbildung meiner eigenen Kinder? Dies sind sehr komplexe Fragen, auf die es keine objektiven Antworten gibt. Und zwar deshalb, weil sich Werte und Wertdimensionen nicht ineinander übersetzen lassen: wie viel Übersterblichkeit in bestimmten Bevölkerungsteilen ist mir mein abendlicher Spaziergang wert? Darauf gibt es keine objektiven Antworten, und sicher keinen Übersetzungsalgorithmus. Also halten wir uns an mentale Setzungen, so wie die beschriebenen Menschenbilder, weil sie uns diese Fragen und Bewertungen einigermaßen organisieren. Aber die Organisation des einen kann halt ganz unterschiedlich ausfallen als die des anderen, und dann sind sachliche Diskussionen kaum noch möglich. Außer eben, man verstünde irgendwann die Relativität der eigenen Position. Aber wer tut das schon?
De Lapuente: Die Identitätspolitik ist derzeit hoch umstritten. Wie hilft Ihr Ansatz, diese Debatten besser zu verstehen – oder vielleicht wenigstens sie zu versachlichen?
Hommel: Die Identitätspolitik ist mittlerweile ja schon wieder im Rückzug. Leider hat sie es so lange übertrieben, bis das Pendel brutal und unverhältnismäßig zurückgeschlagen ist, so wie in den USA bereits zu beobachten. Aber so geht es halt immer: einmal an der Macht, überreizt jede Position ihr Blatt, bis den meisten Leuten zu viel wird. Statt beizeiten den Konsens zu suchen, auch und gerade, wenn man den im Augenblick machtpolitisch noch gar nicht braucht. Aber es gibt immer ein danach: nach der Ampel, nach Schwarz-Rot. Motivationale habe ich noch keine richtig gute Idee dafür, wie man politisch denkende Menschen für andere, alternative Positionen interessieren kann. Man muss sie ja nicht immer gleich übernehmen, aber es wäre doch schön, wenn wir eine gewisse intellektuelle Befriedigung daraus ziehen könnten, politisch ganz Andersdenkende besser zu verstehen, ohne sie immer gleich abzuqualifizieren oder zu pathologisieren.
De Lapuente: Sie schreiben, dass Menschenbilder aus genetischen Anlagen, Prägungen und Kultur entstehen. Bedeutet das, dass politische Überzeugungen weit weniger rational sind, als wir glauben?
Hommel: Ja, aber das ist ja eigentlich selbstverständlich. Ein einfacher Selbsttest: Erklären Sie einmal, warum Sie für die Werte einstehen, für die Sie einstehen. Warum genau für diese spezielle Auswahl, warum finden Sie andere Werte weniger wichtig? Ich wette: Sie haben keine Ahnung. Es fühlt sich einfach vernünftig an, aber Gefühle sind keine gute Basis für Rationalität. Bei näherer Überlegung ist es doch seltsam, dass es für jede politische Position eine große Anzahl von Alternativen gibt, die auch tatsächlich vertreten werden. Warum denken so viele Menschen anders als Sie selbst? Sind die anderen wirklich alles Deppen oder wirklich einfach nur falsch informiert, während Sie natürlich besonders reflektiert und bestens informiert sind? Haben Sie dafür außer ihrer Selbsteinschätzung noch irgendwelche Belege? Ich wäre mir da nicht so sicher …
»Die kommunale Ebene die einzige, die die wirklichen Probleme der Leute im Auge hat«
De Lapuente: Wenn Menschenbilder so tief verankert sind, ist es dann überhaupt möglich, politische Lager einander näherzubringen – oder bleibt nur der pragmatische Kompromiss?
Hommel: In Wahrheit habe ich keine perfekte Lösung anzubieten, denn alle Zeichen stehen im Augenblick in die falsche Richtung. Irgendwie müssen wir es schaffen, wieder mehr Respekt für den anderen, mehr Bescheidenheit für uns selbst zu entwickeln und vor allem eine Belohnungsstruktur dafür, andere Leute zumindest intellektuell zu begreifen. Das alles klingt im Moment leider sehr utopisch. Aber da wir schon einmal mehr Respekt füreinander hatten und da wir gesellschaftlich schon einmal bescheidener waren, sollten wir im Prinzip in der Lage sein, diese Fähigkeiten wieder zu entwickeln. Aus psychologischer Sicht wäre es sinnvoll, die Leute spielerisch (gamification ist das technische Zauberwort) an ihrem Stolz zu packen – denn der ist in unseren narzisstischen Zeiten besonders stark entwickelt. Vielleicht könnte man die Fernsehshow Wünsch Dir Was! wiederbeleben, bei der man mit einem besonders guten gegenseitigen Verständnis gewinnen konnte. Vielleicht könnten wir Spiele entwickeln, in denen man bestimmte Levels dadurch erreicht, dass man die Gedanken anderer zuverlässig einschätzen kann. Vielleicht könnte man politische Talkrunden durch bestimmte Ziele strukturieren. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man Politiker nicht nur einlädt, um irgendwelche Floskeln über die Rente abzusondern, und stattdessen versucht, ihre Vorschläge in einem konkreten Simulationsmodell abzubilden? Mithilfe dessen man zum Beispiel berechnen könnte, welche finanziellen Erwartungen Menschen in verschiedenen Situationen haben dürfen.
De Lapuente: Was wäre aus Ihrer Sicht der wichtigste Schritt, um Politik in Deutschland und Europa konstruktiver zu machen?
Hommel: Das scheint mir eine Eine-Million-Dollar-Frage zu sein, und die richtet sich an einen Nicht-Politiker. Ein wichtiger Schritt, so kann ich mir vorstellen, wäre die Stärkung der bürgerlichen und kommunalen Mitbestimmung, also einer Bottom-Up-Route, die der momentan vorherrschenden zentralen Top-Down-Regulierung entgegenwirkt. Weil die kommunale Ebene die einzige ist, wo die Politik noch die wirklichen Probleme der Leute im Auge hat und haben muss, und wo man in der Regel ganz gut trainiert ist, über Ideologien und Parteigrenzen hinweg praktische Lösungen zu finden.
Bernhard Hommel, geboren 1958, ist Professor und Grundlagenforscher an der Shandong Normal University in Jinan, China. Nach dem Psychologie- und Literaturwissenschaftsstudium in Bielefeld und der Promotion in Psychologie arbeitete er am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München, war Lehrstuhlinhaber an der Universität Leiden und forschte an der TU Dresden. Mittlerweile ist er zudem Senator der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Er lebt in Kassel.
Ähnliche Beiträge:
- Lanz contra Wagenknecht – eine Anatomie
- Demokratie unter Druck
- Jenseits der Kriegslogik
- Manisches Tempolimit
- Der öffentliche Diskurs im Hygiene-Modus




Warum sollte man Physik-Leugner ernst nehmen?
Du meinst jetzt den Part über den Spaziergang mit Maske?
Sollte man Autos besser so bauen das bei Unfällen der Unfallgegner möglichst schwer verletzt wird?
Was ist denn das jetzt für eine Frage???
Wäre soziales Verhalten kein Vorteil hätte es die Evolution nicht ausgebildet.
Ja und jetzt?
@Motonomer
Die Frage und zugleich die Antwort ist, ob das nicht zu hoch für Ihren flachen Hinterkopf ist
Häääääh….Versteh ich nisch..
Natürlich nicht. Und zwar seit 1974™️.
Dann halt ned, diesmal hatte ich mir aber soo viel Mühe gegeben… seufz…
Hier, zum positiven Einstimmen auf den Tag.
I love it: https://theworldwatch.com/videos/1638113/deep-america-still-has-it-s-culture/
Was soll dieses unverständliche mysthische Gelaber?
Wie wäre es mit Klartext?
Eigentlich hatte ich mir von der Lektüre ein bisschen mehr versprochen.
Herr Hommel verwendet den ja bereits vorhandenen Begriff „Menschenbild“, bezieht ihn aber nur auf ein relativ kleines Gebiet.
—
Absolut richtig und wichtig ist natürlich sein Hinweis auf die Bedeutung der nicht hinterfragten und unbewussten Axiome!
—
Für meine Begriffe lohnt das Weiterdenken, ob es in früheren Zeiten, die durch eine etwas (!) geringere innenpolitische Erregtheit gekennzeichnet waren, innerhalb der Bevölkerung weniger unterschiedliche Menschenbilder und Axiome gab oder ob es trotz gleichermaßen verschiedener Axiome und Menschen trotzdem innerhalb der Bevölkerung noch eine größere Schnittmenge an gemeinsamen Ansichten, Werten und Überzeugungen gab?
Ich persönlich tendiere zu letzterem.
Die Menschen mit wirren Menschenbildern hatten früher kein Internet um ihre wirren Ideen unters Volk zu bringen, die saßen früher in der Dorfkneipe alleine am Tisch.
@Theo
Nichts gegen die Dorfkneipe, dort darf man als Sabbelbüddel noch Dumm Tüch reden 🙂
Spätestens nach dem dritten Mal hört keiner mehr zu.
Theo: Ich vermute Sie waren es, der immer alleine am Tisch saß.
Vermuten ist nicht wissen
Du warst ja nicht da. Du hast vor der Schule im Gebüsch gehockt.
Ich denke, die Sache mit dem Menschenbild geht am grundlegenden vorbei. Sie unterstellt nämlich, daß die Menschen, also die Politiker, tatsächlich meinen, was sie sagen. Wer also eine Polit-Talk-Show als rationalen Austausch von Argumenten ansieht, ist schon raus, wie Monotomer sagen würde.
Ich kann ja immerhin noch Angebote aus meinem antiquarischen Schrott-, Gebrauchtmöbel- und Haushaltsauflösungsladen ausstellen.
„Auf der abstraktesten begrifflichen Ebene, die in diesem Fall schlicht „Biologie“ heißt, gibt es nichts als Individuen einer Art, richtig?
Aber diese Art hat kein Dasein an sich selbst, es ist ein formeller Begriff, oder, anders gesagt, ihr Dasein zerfällt in das von Populationen.
Diese Populationen, um ganz exakt vorzugehen, bilden eine spezfische „Gesellschaft“ aus, falls sie sexuell fortpflanzen, das betrifft alle Arten. Ob sie nun eine individuierte Daseinsweise haben, oder in Rudeln / Herden leben, die Ökologie ihres Fortpflanzungsverhaltens bildet einen gesellschaftlichen Zusammenhang aus, und bestehe der nur in einem Revierverhalten.
Doch was immer die Tiere – und also Menschen – tun, es ist und bleibt individuelles Tun, just und gerade auch dann, wenn es artspezifisch genetisch sedimentiert ist.
Aber in letzterem Fall erscheint das individuelle Tun als ein art- oder populationsspezifisches Feature, es „erscheint“ also so, als würde die ökologische (oder im Fortgang: ökonomische) Daseinsweise als ein eigenes, separates Subjekt auftreten. Es ist aber keines, so wenig, wie „das Kapital(verhältnis)“ ein Subjekt von irgendwas ist, es tritt vielmehr als ein Solches in dem Umfang und der Art und Weise auf, wie ihm lebendige Menschen ihre Arbeit und sonstige Daseinsweise und -energie überantworten.“
(Und wer solche Weisheiten nicht von „Ahriman“, dem Unaussprechlichen will, der kann mehr und bessres bei Denis Noble nachlesen, unterdessen wohl auch so ein Schrotthändler …)
Ich überlege ob ich da jetzt nochmal einsteige oder ob ich das lassen sollte.
Was ist mit kooperativem Verhalten das auch nur kooperativ auftritt und nur kooperativ Sinn macht?
Man kann individuell nicht solo im Schwarm fliegen (oder schwimmen).
Ein Schwarm folgt eigenen Gesetzmässigkeiten, eigener Flugrichtung und -figuren, zu denen das Indiduum nicht in der Lage ist.
Der Schwarm erscheint nicht nur als Schwarm. Er hat eigene Physik, bei Bienen zB eine Temperaturverteilung und Kühlung. Er tritt als Subjekt auf, sucht sich seinen Nistplatz, verlässt ihn. Man kann natürlich genetisch behaupten, das sei nur ein einzelner Organismus der zufällig in losgelöste Einheiten gegliedert ist, wenn es nur eine Königin gibt. (Erdmänchen haben aber eine ähnliche Gesellschaftstruktur und sind mWn genetisch heterogen). Auf andere Schwärme trifft das nicht zu.
Anderes Beispiel, Meutejagd, ein Verhalten das Hunde in der Mehrzahl ( ab zwei ) ungemein gefährlich werden lässt. Man kann einen Hund durch einen anderen ersetzen,
es ändert sich die Erscheinung nicht.
Ein Einzelhund kann das nicht, und tut das deswegen auch nicht.
Als Extremindividualist gefällt mir das Argument zwar nicht, finde aber kein Gegenargument, und finde Deine Aussage auch etwas widersprüchlich:
Entweder etwas tritt in Erscheinung, oder nicht.
of topic
Polizei schießt bei Großübung Bundeswehrsoldaten an
https://www.n-tv.de/panorama/Polizei-schiesst-bei-Grossuebung-Bundeswehrsoldaten-an-article26113855.html
„Bei einer Großübung der Bundeswehr im oberbayerischen Erding hat die Polizei einen Soldaten angeschossen. Eine Fehlinterpretation vor Ort habe zu einer Schussabgabe zwischen der übenden Truppe und der von der Bevölkerung gerufenen Polizei geführt, sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr. Ein Soldat sei leicht verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht und bereits wieder entlassen worden.“
Die Polizei teilte mit, sie sei wegen eines Mannes mit einer Waffe alarmiert worden und mit mehreren Einsatzkräften angerückt. „Wie sich im Nachgang herausstellte, handelte es sich bei dem mitgeteilten Waffenträger um einen Bundeswehrangehörigen, der im Rahmen einer Übung vor Ort war“, hieß es weiter.
Bei der Großübung Marshal Power sollte der Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall geübt werden – zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Das Besondere: Die etwa 500 Soldaten der Feldjäger und die rund 300 zivilen Einsatzkräfte üben nicht auf abgezäunten Truppenübungsplätzen, sondern in der Öffentlichkeit. „
Warscheinlich wohl den Häuserkampf gegen Putins Schärgen. 🙂
Unklar, aus Seiten der olivgrünen warens Feldjäger (Militärpolizei) beim Üben. Ein besorgter Bürger hat dann die blaue Trachtentruppe herbeigerufen, die offenbar von der olivgrünen Fraktion für einen Teil der Übung gehalten wurde.
Einem Jagdkameraden ist kürzlich sowas ähnliches, nur ohne Verletzte, passiert. Der wurde von einem Pärchen (m/w) eilends von einem ebenso besorgten Bürger herbeigerufenen Streifenhörnchen in Zivil am frühen Sonntagmorgen in seinem Jagdrevier mit vorgehaltener Waffe (und offenbar zitternden Knien) gestellt. Da er selbst lange Zeit Feldjäger war wusste er wie man mit Pozilei umgeht. Allein, das nutzte nix, die waren beide in der Ausbildung Kreide holen als Waffen- und Jagdrecht unterwiesen wurde. Die konnten sich absolut nicht vorstellen daß ein Bürger ein Erlaubnis haben könnte mit einer geladenen Waffe irgendwo im Wald herumzulaufen. Erst die herbeigerufene Verstärkung hat dann Nachhilfeunterricht erteilt.
Da kann man ja froh sein das der Jäger nicht von einer Notwehrlage (Jagstschutz) ausgegangen ist wenn er da von „Zivilisten“ bedroht wird.
https://de.wikipedia.org/wiki/Putativnotwehr
Der Jäger ist einer der entspanntesten Leute die ich kenne, insofern war es zu keinem Zeitpunkt anzunehmen daß der Leute die sich als „Pozilei“ vorstellen und vom Verhalten den Eindruck machen solche zu sein einfach umlegt, auch wenn er ggf. aufgrund der Erfahrung als lange gedienter Zeitsoldat eine Idee hätte, wie man die beiden niederkämpft obwohl sie mit gezogener Waffe dastehen.
Der war nur bissl verschnupft darüber daß die so kernblöde waren, obwohl er ihnen alle Hilfestellungen gab sich nicht vor der herbeigerufenen Verstärkung zu blamieren.
War das ein Polizist mit Migrationshintergrund oder warum ist das erwähnenswert?
Theo: Ja genau, es war ein Bayer!
Da waren ein Paar Feinddarsteller (Feindkommandos) in Räuberzivil unterwegs. Und die Feinddarsteller dachten die Polizisten gehören zur Übung und haben gleich das Feuer auf diese eröffnet. Und die Polizei dachte es sind die Russen die da Angreifen und haben das Feuer scharf erwidert.
Eine BW-Verbindungsperson im Lagezentrum der Polizei hätte das Sicher verhindern können!
Friendly Fire kommt halt auch bei den besten vor. Vor allem wenn die Polizei in Zivil agiert ist das schon mit Eingepreist und normalerweise ist es keine Größere Sache.
Weiß man das mit dem Räuberzivil? Das wäre zumindest eine naheliegende Idee, ich trau der heutigen Pozilei aber auch zu auf uniformierte mit Manöverpatronengerät an der Mündung scharf zu schießen.
Im Dunkeln sind alle Katzen Grau,
es wurden ja auch schon mehrfach Schwarzwild in Flecktarn erlegt.
Gestern gegen 17 Uhr … da muss die Pozilei schon sehr müde gewesen sein. [1]
Hier ists grad kurz nach 17 Uhr und regnerisch, aber die Sichtverhältnisse sind eher noch kein Problem. Nicht mal auf 100+ Meter Entfernung.
Das mit dem Schwarzwild ist mir noch aus meiner – äh – Grunzausbildung geläufig, das war seinerzeit aber nur einfarbig olivgrün.
[1] https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/strasse-schuesse-bei-altenerding-grosser-polizeieinsatz-hubschrauber-gesperrt-94000280.html
@All,
hier mal ein bisschen Aufklärung : https://augengeradeaus.net/2025/10/missverstaendnis-bei-bundeswehr-uebung-polizei-erwidert-feldjaeger-schuesse-mit-scharfer-munition/
Wie die Ahrtal Katastrophe
mangelhafte Kommunikation
geht immer noch!
Trotz besseren Wissen aus der Vergangenheit.
Und hier eine kurze Erklärung was die da Genau Üben : https://soldat-und-technik.de/2025/10/taktik-ausbildung/45832/bundeswehr/
Vielen Dank für die Links. Klappt also im Ernstfall prima. Die grünen und die blauen legen sich gegenseitig um, die irregulären Angreifer lachen sich tot und sind dann neutralisiert.
Nicht dafür,
es gibt Murphys Gesetz, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und es gibt die Zwangsläufigkeit den Feind des Zufälligen!
Merksatz : Arbeitsunfälle passieren nicht sondern werden gemacht!
Auch mit unterschiedlichen Welt- bzw. Menschenbildern kann man diskutieren, wenn man die Unsauberkeiten, Unlogiken des anderen in dessen (!) Welt- und Menschenbild aufzeigt. Dazu bräuchte man aber auch Kompetenz und die Bereitschaft, sich in den anderen hineinzuversetzen. Beides stelle ich bei vielen Menschen in Frage.
In meinen Augen sind die sog. „Sozialen Medien“ eines der Grundübel, weil sie politische Idioten dazu ermuntern, sich kompetenzlos zu äußern und einfach jeden niederzubrüllen, der es wagt, ihr halluziniertes und frei von Argumenten zusammengezimmertes Weltbild zu hinterfragen. Social Media ist im Grunde die Rache von Idioten an den Belesenen, bei denen man sich früher wie ein Trottel vorkam. Anstatt nun selbst zu lesen und sich in jahre-/jahrzehntelanger mühsamer Kleinarbeit ein hohes Maß an Wissen anzueignen ist es halt einfacher, zu blöken und zu canceln. Ich werde es der politischen Linken nie verzeihen, dass sie nicht mehr analysiert, sondern Vollidioten dazu bringt, sich links zu „fühlen“ und alles zu überbrüllen, was auch nur ein bisschen an den paar auswendig gelernten Glaubenssätzen kratzt. Die linken Spießbürger und geistigen Gartenzwergbesitzer zerstören inzwischen jede Art von linker Politik.
Nein, es ist nicht „links“ den Sozialstaat durch Überdehnung von Migration zu zerstören, es ist reaktionär.
Nein, es nicht „links“ den Militarismus von Union und SPD (die ich nichtmal mehr als pseudolinks empfinde) zu befördern, es ist reaktionär.
Nein, es ist nicht „links“ den Klima-Bullshit nachzuplappern, der nichts als ein Hoax ist, um den Leuten ein neues Auto, eine neue Heizung, eine neue Waschmaschine anzudrehen, obwohl Auto, Heizung und Waschmaschine intakt sind und noch lange genutzt werden könnten (was ressourcenschonend und damit umweltfreundlich wäre). Es geht nur darum, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und die sog. „Linken“ sind auch nur noch gute Verkäufer der globalen Industrie und wenn die Leute nicht freiwillig konsumieren, dann werden sie durch das Verbrennerverbot und das Heizungsgesetz dann halt gezwungen.
Auch das ist reaktionär.
Ich könnte noch endlos so weiterschreiben. Warum reden viele angebliche Linke so schnell? Nun, die sind wie amerikanische Actionfilme, bei denen die Anzahl der geschrotteten Autos und die Schnelligkeit der Schnitte darüber hinwegtäuschen sollen, dass die Story hanebüchen oder gar nicht vorhanden ist.
Wer keine Argumente hat, der kann nicht diskutieren, der kann nur verlautbaren. Das ist das ganze Geheimnis, warum keine Diskussionen mehr stattfinden.
Sie sprechen mir aus der Seele!!! Vielen Dank dafür.
Autor: „Irgendwie müssen wir es schaffen, wieder mehr Respekt für den anderen, mehr Bescheidenheit für uns selbst zu entwickeln und vor allem eine Belohnungsstruktur dafür, andere Leute zumindest intellektuell zu begreifen.“
Mehr als Moral hat er also auch nicht anzubieten, genau das was die herrschende Elite schon mit ihrem Volk versucht. Vielleicht soll die Religion, die uns ja abhanden gekommen ist, wieder mehr Bedeutung bekommen?
Autor: „Vielleicht könnte man politische Talkrunden durch bestimmte Ziele strukturieren.“
Auch das wird doch bereits von den Medien verfolgt. Zu den großen politischen Themen (wie Ukraine und Israel) werden nur Leute eingeladen mit gleichen Meinungen und den selben Zielen.
Und im Übrigen ist es doch eine Binse, dass unser Welt- und Menschenbild auch unsere Vorurteile bestimmt. Und die sind bei uns im Westen liberal-individualistisch voreingestellt, etwa im Gegensatz zu Ostasien, wo eine autoritär-kollektivistische Tradition vorherrscht, die selbst in Japan noch bemerkbar ist, dem ja sei 80 Jahren der individualistische Liberalismus aufgezwungen wird.
Sollte Japan mal wieder andere Länder überfallen?
Wäre das besser?
Andere Länder zu überfallen sollte natürlich dem Westen, speziell den USA vorbehalten bleiben. Eine Unverschämtheit, dass sich Japan da eingemischt hat. Ihre westlichen Vorurteile schreien zum Himmel.
„In meinen Augen sind die sog. „Sozialen Medien“ eines der Grundübel, weil sie politische Idioten dazu ermuntern, sich kompetenzlos zu äußern und einfach jeden niederzubrüllen, der es wagt, ihr halluziniertes und frei von Argumenten zusammengezimmertes Weltbild zu hinterfragen.“
Das ist in den sogenannten „Qualitätsmedien“ nicht wesentlich anders.
Man sollte zunächst einmal ganz profan zwischen Meinung und Fakt unterscheiden ‒ da könnte man sich dann schon manche sinnbefreite Diskussion sparen. Man kann ja wie bei Corona der Meinung sein, „Inzidenzen“ bei deren Berechnung man einfach den mathematisch wichtigen Bezugswert der Test-Quantität weglässt, seien aussagekräftige Werte ‒ Fakt ist, dass so etwas grober Unfug ist. Viele scheinen heutzutage den Unterschied nicht mehr zu kennen und so wird das in endlosen Talkrunden und Diskussionen munter vermengt, ohne dass etwas Sinnvolles dabei herauskommt.
Kognitive Kriegsführung, der wir ja allenthalben ausgesetzt sind, bedient sich bewusst der dieser Auflösung bzw. Gleichsetzung ‒ ganz offensichtlich mit Erfolg.
Ist mit „kognitiver Kriegsführung“ der Kampf von Putin-Russland gegen diese drogensüchtigen pädophilen und schwulen Nazizionisten gemeint?
[+]
Die Steigerung ist dann der Versuch, die Anerkennung einer offensichtlich faktenwidrigen Meinung als Tatsache zu erzwingen.
Des einen „Fakt“ ist des anderen „Desinformation“.
Es gibt keine integere Einrichtung mehr, die sich der Aufklärung, ob Fakt oder Desinformation, verpflichtet fühlt.
Alle öffentlichen „Narrative“ sind nur noch interessengeleitet von EU, Regierung, ÖRR, …
Alle singen das gleiche Lied.
Und ein falscher Ton führt zur Hausdurchsuchung.
Fakten spielen keine Rolle mehr. So weit sind wir schon.
https://norberthaering.de/propaganda-zensur/dsa-verfassungsbeschwerde/
Denke das Buch liefert eine falsche Ursache, den Mensch, und damit keine Lösung.
Ja das Diskussionsklima ist ein anderes. Der Mensch hat sich aber mindestens in den letzten 70 Jahren, evtl in den letzten 5000 Jahren, nicht geändert. Wer beim Menschen sucht, sucht damit an der falschen Stelle. Meiner Meinung hat sich die Politik verändert. Man hetzt die Leute gegeneinander auf, indem man die eine Meinung zur guten und richtigen erklärt und die andere zur falschen und bösen. Politiker (und Parteien) mit Unterstützung der Medien haben es geschafft einen Keil zwischen die Menschen zu treiben, mindestens seit Corona, evtl seit 2014. Das ist nicht nur schlechte Politik sondern regelrecht bösartig, aus Absicht oder als Mitläufer, aus meiner Sicht beides Täter.
Jaja.. ich habe auch immer „die Politik“ als eigenständige Entität, die völlig unabhängig vom Menschen agiert, im Verdacht, Grund alles Übels zu sein.
„Der Kapitalismus“ und „der Konsum“ sind, wie „die Umweltverschmutzung“ auch so fiese Wesen. Gut, haben wir damit nichts zu tun.
Das sehe ich auch als die richtige Ursache.
Zumal diese degenerierte Debatten“kultur“ ja vor allem in den „wertewestlichen“ NATO-Staaten anzutreffen ist.
Meine Theorie für das ganze:
Divide et impera!
Die „Eliten“ wissen, dass 99% der Bevölkerung nicht damit einverstanden ist, was da in den letzten Jahrzehnten getrieben wird und bevor sie sich gegen die Ursache des Problems wenden, hetzt man sie schön gegeneinander auf.
Da gehört so gut wie jedes von den Medien gehypte Thema dazu: Klimaleugner wer nicht den Glauben ans durch menschliche CO2-Emissionen erwärmte Erdklima in der Form vertritt, wie von den „Eliten“ vorgegeben.
Corona-Leugner, wer nicht die verordnete Maske und die Impfpflicht befolgt.
Putin-Versteher, wer die Propaganda des unprovozierten Angriffskriegs gegen die Ukraine (dreimal falsch) bezweifelt und mit Fakten in Frage stellt.
Rassist, wer die woke Theorie nicht ernst nimmt, sich dem Gendern verweigert, nicht daran glaubt, dass es 70+ Geschlechter gibt, dass man sein Geschlecht frei selbst festlegen kann usw.
Rassist, wer die unkontrollierte Massenmigration hauptsächlich muslimisch geprägter junger Männer nach Westeuropa kritisiert,
usw.
Alles richtig, aber an Deinem Beispiel fällt unmittelbar auf: Der Typus des diskussionsunfähigen Gläubigen ist in allen 3 Fällen das dumme Schaf. Je dümmer, desto überzeugter von der eigenen Unfehlbarkeit. Der Klügere gibt so lange nach bis er dann der Dumme ist, das ist aber auch keine ertragbare Lösung.
Ein Bekannter von mir liest eben die Biografie von Wolfgang Schäuble. Das kommt er auch auf sein Menschenbild und das besteht aus schwachen, verführbaren und manipulierbaren Personen. Sünder eben im katholischen Sinne. Korrupt hatte er vergessen, er wollte nicht allzu sehr in eigener Sache sprechen.
Hieraus aber folgt fast zwingend die Tendenz zu einem autoritären Staatsmodell. Da muss doch jemand diesen Haufen im Zaum halten, ein Autokrat, ein König oder Diktator. Was sich im Tun des Schäuble wiederspiegelte.
Der Demokrat hingegen ist der Ansicht, dass das Volk insgesamt klug sei und die besten Entscheidungen treffen würde. Meine ich auch. Dass nun nur Alternativen unter falscher Flagge existieren, ist nicht schuld der Demokratie. Der waltende Kapitalismus schon eher.
Das sind mal die zwei Hauptrichtungen.
„vorgefertigte Welt- und Menschenbilder behindern einen ergebnisoffenen Diskurs.“
Was für eine selbstgewählte Blindheit wieder.
Der öffentliche Diskurs wird vor allem dadurch behindert, dass er durch bezahlte Agenten gezielt gestört und fehlgeleitet wird.
Wer das Offensichtliche ausblendet hat gar kein Interesse an einem ergebnisoffenen Diskurs.
+++++
In einer kaputten, dem Untergang geweihten Welt, kann es keine gelungene, herrschaftsfreie Kommunikation mehr geben, wobei der Begriff „Kommunikation“ bereits problematisch ist.
„Sprichst du noch, oder kommunizierst du schon?“, fragte dereinst der sehr lesenswerte Wiglaf Droste, ein Dichter, Gelegenheitssänger und Vorleser, alles Tätigkeiten, mit denen heutzutage kein Blumentopf mehr zu gewinnen ist.
Einigen Nervensägen gerade hier im Forum den Saft abdrehen, rettet auch nicht die schöne „Kommunikation“, wäre aber mal ein Anfang.
„Interessant an dieser Zeit und den vorgebrachten Argumenten fand ich, dass jede Perspektive eigentlich sehr gut verständlich war. “
Eine völlig neue Technologie in Form einer Impfung, völlig neue Produktionsstätten und Verfahren und das fast ohne ausführliche Tests per Gesetz in den Körper von Menschen bringen zu wollen und dabei Milliarden verdienen, und das alles indem man geltende Vorschriften und Recht außer kraft setzt über das Argument “ Notfall“
Bitte , hier hört jegliches Verständniss auf, Mengeles Weltanschauung war nicht viel anders ….
Je weiter einer weg ist von Macht um so eher Verständniss wie auch das Gegenstück ..
Wir verteidign ja auch Unser Land auf dem Boden anderer Völker. Gleiche Logik .
Macht muss kontrollierbar sein, nur dann sind Kompromisse noch möglich über Diskurse .Hier geht es um Veranwortung deren Konsequenzen die Verantwortlichen heute fast vollständig aber ablehnen, bzw sogar Gesetze erlassen um Sich davon befreien zu können. Demokratie brauch andere Ausgansbasis. Übrigens, auch Argumente verlieren Ihre eigentliche Funktion wenn man Sie auf ein Alibi dekradiert , wie das heute überall zu sehen ist bei den “ Profis“
„Debatte“, „Diskurs“? Hausdurchsuchung!
https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/hausdurchsuchung-autor-norbert-bolz-wegen-x-beitrag-sie-sollten-vorsichtiger-sein-was-sie-posten-li.10002206
„Einer der Polizisten habe ihm mit auf den Weg gegeben: „Sie sollten in Zukunft vorsichtiger sein, was Sie posten.“ o)))
Staatsgewalt sollte den Staat schützen und nicht Politiker mit Ihren aktuellen Ideologie solange keine Gefahr für Personen vorliegt.
Wir schon aus den Geschichtsbüchern, was passiert solche Dinge in den Alltag einziehen von Menschen .
Das könnte aber auch auf den Zunehmenden Einsatz von Software zurückzuführen sein die auch bei Staatsanwaltschaften nun Einzug hält , mit KI zum teil .. KI und Kontext einer Sache, das ergibt nie etwas gutes o))
Apropos „woke“: Seid ihr von Meldungen dieser Art auch stets so überrascht, wie ich?
https://www.berliner-zeitung.de/news/kinderpornografie-ermittlungen-gegen-bekannte-drag-queen-li.10002237
Das, Herr Hommel, ist schlichtweg gelogen.
Die folgende Passage zeigt sehr schön, wie ein Wissenschaftler ein reales Problem nur durch seine eigene Brille betrachtet:
„Irgendwie müssen wir es schaffen, wieder mehr Respekt für den anderen, mehr Bescheidenheit für uns selbst zu entwickeln und vor allem eine Belohnungsstruktur dafür, andere Leute zumindest intellektuell zu begreifen. (…) Aber da wir schon einmal mehr Respekt füreinander hatten und da wir gesellschaftlich schon einmal bescheidener waren, sollten wir im Prinzip in der Lage sein, diese Fähigkeiten wieder zu entwickeln.“
Er sieht das alles rein psychologisch, kommt sogar noch mit abstrakt-weltfremdem Begriffen wie „Belohnungsstruktur“, vernachlässigt dabei aber den soziologischen und gesellschaftspolitischen Blickwinkel.
So müsste man doch fragen, durch welche Umstände und Kräfte wir es heute mit weniger Respekt für den anderen und weniger Bescheidenheit im Hinblick auf die eigene Person zu tun haben? Er schreibt nur „irgendwie müssen wir es schaffen“ – so, als ob es sich in erster Linie um ein psychologisches Thema handelte und eine Therapie helfen könnte.
Das ist ein eher skurriles Menschenbild vom Professor Hommel.
Es setzt voraus, dass die menschliche Entwicklung an einem Punkt festgezurrt und somit statisch wird. Es setzt weiterhin Voraus, dass menschliche Rationalität und Vernunft grundsätzlich von der eigenen Basis gestört und verzerrt wird, und somit praktisch keine rationale und/oder vernünftige Entscheidung mehr getroffen werden kann. Auf welcher Basis des Autoren Forderung nach intensivierend-kommunikativen Verhaltens dann beruht, ist die Frage. Keine Basis?
–
Tipp: Immer, wenn das Wörtchen ‚wir‘ Verwendung findet, immer auch auf Projektionen abklopfen.
–
Nein, das ist falsch. Axiome sind Grundsätze, die von allen geteilt und somit als grundlegend anerkannt werden.
Und schon hier ist es Zeit, über das Menschenbild des Autors reflektierend zu sinnieren:
Vorab einige Infos zum Begriff Menschenbild(er)
Und genau hier fängt die Spekulation an. Wieso umgeht der Autor diese entscheidende Frage oder muss ich dazu erst das Buch gelesen haben?
(Interessant am Wikipediatext ist der Sachverhalt, christliches und humanistisches Weltbild nebeneinander aufzulisten.)
Ich erwarte von einem Professor eine klare Aussage und kein Larifari. Vielleicht bin ich da zu altmodisch oder gar schon konservativ; letzteres soll ja modisch angesagt sein. 😉
Mit dem Beispiel der Coronazeit hat sich der Autor schwer verhoben und tut sich damit keinen Gefallen. Implizit die Coronamaßnahmen haben gezeigt, dass „Diese beiden Menschenbilder“ genau von einer Gruppe vollständig getragen wurde, indem sie den „pädagogischen Konzepten“ mit nachgeschobenen wissenschaftlichen Argumenten angeblich begründeten. Wichtig ist hierbei die Reihenfolge: Um den teilweise auch willkürlichen Coronamaßnahmen eine Legitimität anzudichten, wurde meistens versucht, nachträglich diese durch wissenschaftliche Evidenz (beispielsweise Übersterblichkeit, Inzidenzen) zu rechtfertigen, welche spätestens mit der Veröffentlichung der RKI-Files zu großen Teilen widerlegt werden konnte.
Insofern ist die Schlussfolgerung
falsch.
@ Dan: DANKE!
Und Danke an RdL: 20,00 Euro gespart.
Für mich lohnt es sich definitiv nicht, dieses Buch des Bestsellerautors (Ist das eigentlich eine Berufsbezeichnung oder worauf zielt dieser Hinweis ab?) Hommel zu kaufen.
Das heißt nicht, dass mich das Thema Menschenbilder nicht interessiert, aber wie es in dem Interview aufgearbeitet wird, halte ich schlichtweg für nicht nur oberflächlich und einseitig, sondern sogar über weite Teile für falsch.
Das fängt schon damit an, dass behauptet wird, man würde „Menschenbilder sozusagen mit der Muttermilch aufsaugen“.
Und sind damit ein Leben lang unveränderlich oder wie? Und so richtig bewusst werden sie „uns“ auch nicht, weil „wir“ sie gar nicht genau definieren können?
Genau definieren kann Hommel aber durchaus die beiden „Menschenbilder“ von Politikern: Argumente vs „pädagogische Konzepte“ = Regeln, um „sozial unverträgliches Verhalten“ zu korrigieren. Die Vertreter beider Bilder vom Menschen vereint die Überzeugung, man müsse Menschen beeinflussen, erziehen. Auch geht es dabei mitnichten in erster Linie um Sozislverträglichkeit, sondern vielmehr um Systemverträglichkeit.
Es handelt sich dabei also überhaupt nicht um Menschenbilder, sondern um Methoden der Manipulation.
Die Menschenbilder dahinter unterscheiden sich nämlich nicht: Der Mensch, hier die Masse, das Volk, ist nicht fähig von sich aus richtig zu handeln, ist also unmündig, und muss daher entweder davon überzeugt oder dazu gezwungen werden, sich so zu verhalten, wie es sich gehört. Daher ist es für die, die in welcher Form auch immer regieren, so wichtig zu ergründen, wie Menschen funktionieren, wobei das Wort ‚funktionieren‘ schon verräterisch genug ist.
Würde man wirklich danach fragen, was der Mensch ist, müsste man danach fragen, wozu er fähig ist, welches Potenzial er hat, wie frei er ist und was ihn in seiner Entfaltung einschränkt, nicht aber, wie er im Sinne eines von außen bestimmten Ziels funktioniert.
Das Menschenbild, dasHerrscher von den Beherrschten haben, hat sich seit Jahrhunderten nicht gewandelt.
Es ist eine Lüge, wenn Hommel behauptet, es gäbe kein besseres Menschenbild.
Sein Rat, wir müssten „mental deutlich widerstandsfähiger werden“ , ist in einer Linie zu sehen mit der immer wieder beschworenen Resilienz gegen unerträgliche gesellschaftliche Zumutungen. Statt die Zumutungen abzuschaffen, müssen „wir“ nur stärker werden im Ertragen.
Dass für die Unfähigkeit miteinander zu kommunizieren sogenannte Polittalkshows bemüht werden, ist genauso daneben. Als ob es in Shows jemals um ergebnisoffene Diskussion gegangen wäre. Die haben schon immer einzig der Selbstdarstellung und der Transformation von Deutungshoheiten nach außen (fürs Publikum) gedient . Privat trinken die bestimmt gerne ihr Bierchen (oder ihren Champagner ) zusammen.
@Frau Lehmann
Gut geschrieben!
Jau!
Man sollte Herrn Hommel nicht vorwerfen, den psychologischen Aspekt bei Gesprächsrunden hervorzuheben. Das ist sein Fachgebiet, er steuert eine Reihe kluger Gedanken bei, die zur Selbstreflexion anregen („wie wir uns wieder besser verstehen können“).
Leider hängt sich das Gespräch mit Roberto an „politischen Debatten“ auf, gemeint sind „Gesprächsrunden in den Medien“. Da spielt die Psyche der Diskutanten jedoch kaum eine Geige, es handelt sich um sorgsam orchestrierte Schaukämpfe mit geplantem Ergebnis, also um Propaganda. Sicher könnte man über die mentale Verfasstheit der Selbstdarsteller spekulieren, aber damit wird man dem Sinn und Zweck dieser Verkaufsveranstaltung nicht gerecht.
Den Beteiligten solcher Schauläufe zu unterstellen, sie wären an einem gegenseitigen Verständnis oder gar an einer Einigung interessiert, ist vollkommen naiv: Am Sakko jedes Protagonisten hängt ein Preisschild, sie müssen nur die dazugehörige Botschaft möglichst effektiv unter’s Volk bringen. Um den reibungslosen Transport in die Hirne der Konsumenten sorgt sich der Zirkusdirektor mit seiner gut geölten Medienmaschinerie.
Hommel hat Recht, wenn er feststellt: „So kommen wir gesellschaftlich nicht weiter“. Deshalb wünscht er sich „etwas mehr Respekt, etwas mehr Empathie und Perspektivenwechsel beiderseits“ – das stünde uns Foristen gut zu Gesicht, hilft aber einer Gesellschaft nicht auf die Sprünge, die von objektiven Gegensätzen und Machtinteressen geprägt ist.
Ein besseres Verständnis für „politisch ganz Andersdenkende“ ist gewiss hilfreich, um mit meinem AfD-Nachbarn in’s Gespräch zu kommen – die gängige Dämonisierung verhindert jede Verständigung über seine Wut auf den Wahlzirkus, die ich unbedingt teile. Daran anknüpfend kann man über die Ursachen reden, vielleicht gar zu überraschenden Einsichten gelangen.
Themen wie „Kriegstüchtigkeit“ oder die Demontage des Sozialstaates – die uns in den medialen Verkaufsveranstaltungen nahegebracht werden sollen – sind dagegen nicht verhandelbar – mit Merz, Stahlgewitter oder Zack-Zimmerflak ist keine Verständigung möglich: die wollen schlicht etwas anderes und nutzen die Medienmacht (sowie das Gewaltmonopol ihres Staates), um ihre Ziele durchzusetzen.
Um aber zu verhindern, dass die Propagandisten mir aus der Röhre heraus im Hirnkasten herumfingern, hilft mir der Psychologe nicht weiter. Da geht nur eins: Abschalten.
„Jede Annahme, jede Schlussfolgerung, jede Meinung, ob nun rational oder irrational, basiert auf bestimmten Basisannahmen, die wir in der Regel nicht hinterfragen. Das ist normal, und entspricht dem, was wir in der Wissenschaft Axiome nennen.“
Axiome sind die Bausteine der Logik
so ähnlich wie Atome die Bausteine der Materie sind.
Die dazugehörige Wissenschaft ist also die Logik.
Diese Axiome haben nicht unbedingt mit
jeder
ob rational oder irrationalen
Annahme, Schlussfolgerung oder Meinung zu tun.
Eine Basisannahme ist nicht unbedingt ein Axiom sondern kann sich auch auf Wunderglauben beziehen.
Gerade als Grundlagenforscher sollte man sowas auseinanderhalten.
Auch wenn es sich erstmal superintellektuell anhört.
Wegen Griechisch und so.
https://www.paulwatzlawick.de/axiome.html
.
Wenn wir schon bei Axiomen sind, sind wir bei Gödel.
Es lässt sich kein widerspruchsfreies System logischer Verknüpfungen aus wahren Axiomen aufstellen.
Grundsätzlich nicht.
Selten so ein Geschwurbel gelesen, denn hätte Bernhard Hommel recht, dann müsste man als freiheitlich demokratisch denkendes Wesen beispielsweise auch ein nationalsozialistisches Menschenbild irgendwie verstehen: »Warum denken so viele Menschen anders als Sie selbst? Sind die anderen wirklich alles Deppen oder wirklich einfach nur falsch informiert, während Sie natürlich besonders reflektiert und bestens informiert sind? Haben Sie dafür außer ihrer Selbsteinschätzung noch irgendwelche Belege? Ich wäre mir da nicht so sicher …« (Hommel)
Jedenfalls ich bin mir meiner Wertvorstellungen sicher und denke dabei etwa an das zivilreligiöse Konzept der Menschenwürde oder überhaupt die Menschenrechte, die doch einem bestimmten Menschenbild entspringen, das sich spätestens als Folge der Weltkriege international etablierte. Natürlich mag dessen Exegese im Detail strittig sein, aber ein Grundkonsens wird wohl bestehen.
Gruselig auch Fragen mit Bezug zur COVID-19-Pandemie: »Gewichte ich die Freiheit, und vor allem meine eigene Freiheit, höher als die gesundheitlichen Risiken für andere, auch wenn sie von mir ausgehen (weil ich zum Beispiel keinen Bock habe, eine Maske zu tragen)? Ist mir das Wohlergehen anderer Leute so viel wichtiger als die Schulbildung meiner eigenen Kinder? Dies sind sehr komplexe Fragen, auf die es keine objektiven Antworten gibt. Und zwar deshalb, weil sich Werte und Wertdimensionen nicht ineinander übersetzen lassen: wie viel Übersterblichkeit in bestimmten Bevölkerungsteilen ist mir mein abendlicher Spaziergang wert? Darauf gibt es keine objektiven Antworten, und sicher keinen Übersetzungsalgorithmus.« (Hommel)
Doch, es sollte Objektivität geben, und der entsprechende Algorithmus nennt sich Wissenschaft.
Außerdem war für die Fragen Roberto De Lapuente zuständig, der allerdings für Leute wie mich vielleicht noch hätte ermitteln können, was denn unter einem agentiven und einem reflektorischen Menschenbild genau zu verstehen sein soll. Klingt ziemlich kryptisch – womöglich ein geheimer Code innerhalb einer esoterischen Subkultur? Eventuell uraltes menschliches Erfahrungswissen?
Bestimmt irgendwas mit Hexerei –, die doch für die unzähligen SARS-CoV-2-Übertragungen beim Abendspaziergang im Freien genauso verantwortlich war wie in den 1980er-Jahren für all die HIV-Infektionen beim gemeinsamen Essen mit Virenpositiven. Wohl eine Frage des Menschenbildes in dessen unübersetzbaren Wertdimensionen, wo und wie Viren überall herumflattern; und Unfälle gibt es immer wieder. All diese Fälle, in denen ein Blutspritzer von einem HIV-Positiven nach einem versehentlichen Schnitt in den Finger genau ins Auge Gesunder sprang, und bald darauf waren alle tot damals in den 80ern, und da soll man nicht an Hexerei glauben? Genau wie in den letzten Jahren die hohe Übersterblichkeit durch abendliche Spaziergänge zumindest der Ungeimpften, die uns diese ganze Unfreiheit doch erst eingebrockt haben; sie haben die gute alte Wissenschaft Hommels verhext mit neuen Menschenbildern, viralen Wertdimensionen und uns alle vergiftet.
Nein, das kann jetzt nicht stimmen, denn wenn Hommel kein irgendwie besseres Menschenbild kennt, dann auch kein schlechteres, und gleiches muss auch für Wissenschaften gelten, die aus diesen Menschenbildern resultieren. Es ist eben alles relativ, nicht zuletzt das Wissen um Hexerei.