
Seit Gottfried Wilhelm Leibniz sind weite Teile des bewohnten Erdkreises einem unverzeihlichen Irrtum verfallen. Die meisten Menschen glauben, sie leben in der besten aller möglichen Welten. Beileibe nicht!
In seinem tiefsten Innern weiß es ein Jeder: Die Leibniz’sche Formel gilt nur für die Wiener, denen der Allmächtige die Leichtigkeit des Seins von Natur aus beschieden hat. Denn die liebreizende Sisi, der väterliche Franz Joseph I., die beschwingten Bälle im Burgtheater und – ach – all die schönen Kaffeehäuser mit den leckeren Sachertorten gehören dem unbedarften Touristen nur für die Dauer seines monetär entgoltenen Aufenthaltes. Es wird niemand ernsthaft bestreiten wollen: Die beste aller möglichen Welten sind auf immer und ewig ausschließlich Eigentum der Wiener.
Das war jedoch nicht immer so. Denn mitten in der „Wiener Moderne“, die Frankophile euphemistisch als „la Belle Époque“ bezeichnen, veröffentlichte die Wiener Schriftstellerin und Übersetzerin Marie Herzfeld einen Text mit dem Titel „Fin-de-siècle“ (1892), in dem sie ihrer Zeit eine große „Müdigkeit“ bescheinigt:
„Dies Jahrhundert der Kritik und Wissenschaft, das unsere Ideen von Gott und Welt über den Haufen warf und uns gebot, von unten anzufangen; dies Jahrhundert der Erfindungen, welches das Tempo unseres Lebens verzehnfachte und unsere Körperkraft wohl kaum verdoppelte; dies Jahrhundert, das die Gewohnheit hat, uns die schmerzliche Überraschung des Besseren an den Kopf zu schleudern, ehe wir die Wohltat des Guten zu genießen vermochten; – es hat uns müde gemacht. Wir sind umgeben von einer Welt absterbender Ideale, die wir von den Vätern ererbt haben und mit unserem besten Lieben geliebt, uns fehlt nun die Kraft des Aufschwunges, welcher neue, wertvolle Lebenslockungen schafft.“[1]
Was war da in Wien los? Hatte Europa nach der blutigen Schlacht von Solferino (1859) und dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) nicht in einem goldenen Äon des Friedens geschwelgt? War nicht dieser Grundstein Ursache für eine Hochzeit von Wirtschaft und Kultur, in der Schwerindustrie, Elektrotechnik und neue chemische Fabriken das Leben der Bevölkerung erleichterten? Sorgten nicht moderner Verkehr, die Fortschritte in Medizin und Hygiene dafür, dass es allen immer besser ging und die Lebenserwartung stieg? Und stattdessen schrieben gleich zahlreiche Schriftsteller von Décadence und Tod. Unter ihnen befanden sich beispielsweise prominente Autoren wie Arthur Schnitzler mit seinen Erzählungen „Sterben“ und „Die Toten schweigen“, Hugo von Hoffmannsthal mit seinem lyrischen Drama „Der Tor und der Tod“ und Richard Beer-Hoffmann mit dem Roman „Der Tod Georgs“. Selbst der Bambi-Erfinder Felix Salten veröffentlichte in seinem Novellenband „Der Hinterbliebene“ gleich mehrere Erzählungen, in denen er Heldentode und Kriege prophetisch vorwegnahm.[2] Jedenfalls ist es dem Verdienst des geheimnisvollen Kunst- und Literaturkritikers Clemens Sokal zu verdanken, dass die „Schuldigen“ für diese Misere ausgemacht werden konnten. Nein, dieses Mal waren es nicht die Künstler und Musiker, sondern die Schriftsteller, die zunächst in den Pariser Kaffeehäusern beisammensaßen und dann nolens volens eine Steinlawine des Trübsinns über ganz Europa ins Rollen brachten: „Es fehlt nicht an anderen geringeren Beispielen, die dartun, daß der Todesgedanke einen der Grundtöne in den literarischen Harmonien des heutigen Tages bildet.“[3]
Ein prophetischer Autor: Leo Silberstein-Gilbert
 Wie sehr mag es die müden Seelen in der K.-u.-K.-Monarchie gefreut haben, dass Leo Silberstein, der bekannte Naturwissenschaftler und „einer der meistgelesenen Feuilletonisten der [Wiener Zeitung] ‘Zeit’“,[4] im Jahr 1907 unter seinem Pseudonym Leo Gilbert einen „phantastisch-satirischen“ Roman unter dem Titel „Seine Exzellenz der Automat“ publizierte, der Lachmuskeln und Zwerchfelle seiner Zeitgenossen gehörig zum wilden Auf- und Abtanzen brachte.[5] Wie die geneigte Leserschaft erfahren wird, war er der Mensch, dem es durch heineschen Witz gelang, die Welt – zumindest für einige Jahre – vor Depressionen und dem Untergang zu retten.
Wie sehr mag es die müden Seelen in der K.-u.-K.-Monarchie gefreut haben, dass Leo Silberstein, der bekannte Naturwissenschaftler und „einer der meistgelesenen Feuilletonisten der [Wiener Zeitung] ‘Zeit’“,[4] im Jahr 1907 unter seinem Pseudonym Leo Gilbert einen „phantastisch-satirischen“ Roman unter dem Titel „Seine Exzellenz der Automat“ publizierte, der Lachmuskeln und Zwerchfelle seiner Zeitgenossen gehörig zum wilden Auf- und Abtanzen brachte.[5] Wie die geneigte Leserschaft erfahren wird, war er der Mensch, dem es durch heineschen Witz gelang, die Welt – zumindest für einige Jahre – vor Depressionen und dem Untergang zu retten.
Silberstein-Gilbert wurde am 28. Dezember 1861 als Kind jüdischer Eltern im rumänischen Galați an der unteren Donau geboren, studierte und promovierte am Eidgenössischen Polytechnikum Zürich und der Universität zu Berlin, bevor er seinen Lebensunterhalt als Wissenschaftsjournalist zu verdienen begann. So arbeitete er unter anderem für die Wiener Zeit, die Neue Freie Presse, die Frankfurter Zeitung, das Berliner Tagblatt, die Gartenlaube, die New York Times[6]und die Scientific American.[7] Sein Erfolg lässt sich im Wesentlichen auf seine Begabung zurückführen, komplexe technische Prozesse und neue Erfindungen verständlich und spannend in narrativer Form zu vermitteln. Silberstein-Gilbert verstarb am 7. März 1932 in Wien – in einer Zeit, die bereits stark von den Transformationsprozessen des Nationalsozialismus geprägt war. In Hinblick auf eine literarische Kritik an der Ausgestaltung der Zukunft verstanden diese totalitären Futuristen keinen Spaß. Doch stießen sie sich vor allem an der jüdischen Herkunft Silberstein-Gilberts.
Schon das NS-Nachschlagewerk mit dem eindeutigen Titel Semi-Kürschner hatte bereits 1913 versucht, Silberstein-Gilbert als Jude zu diskreditieren.[8] Das auf Philipp Stauffs ruchlosen Vorarbeiten basierende „Verzeichnis Jüdischer Autoren“ wurde von der „Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums“ als ein Werkzeug geschaffen, um die abweichenden Ideen in den kreativen Branchen zu überwachen und zu zensieren.[9] Mit der „Ausmerzung des undeutschen Geistes aus öffentlichen Büchereien“[10] und privaten Bibliotheken wurde versucht, auch Silberstein-Gilberts Name und Werk zu vernichten, sodass sie heute nur durch aufwändige Recherchen zu ermitteln sind.
Handlungsstränge und ihre Triebfedern
Kein geringerer als der jüdische Soziologe und Philosoph Rudolf Goldscheid übernimmt die Funktion des „Weckers“, um die „müden Seelen“ der Zeitgenossen aus ihrem Dämmerzustand wach zu klingeln. Er hatte für seinen Freund die ehrenvolle Aufgabe übernommen, dem Roman ein „Geleitwort“ voranzustellen, das Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ in weitaus liebevoll-eleganterer Form vorwegnimmt. Wir können annehmen, dass sich die Wiener Centralisten beim Lesen der ersten Zeilen Goldscheids vor Lachen die Schenkel klopften, Felix Salten aus ihnen Inspirationen für seine sagenumwobenen Berichte über die neusten Hofskandale schöpfte, während der ebenfalls stilsichere Karl Kraus vor Neid erblasste:
„Lieber Bürger, edler loyaler Untertan, der du kritiklos bewundernd vor allem und jedem devotest auf dem Bauch rutschest, was man dir als groß und glänzend hinstellt, für den nichts dumm genug ist, als daß er nicht täppisch darauf hineinfiele, für den nichts lächerlich genug ist, als daß er es nicht ernst nimmt, für den nichts ernst genug ist, als daß er es nicht frech begrinst, der bereitwilligst den Genius blutig verfolgt, wenn er dafür ein Trinkgeld, ja nur das huldvolle Kopfnicken der Lakaien einheimsen kann – Ihr alle von der edlen Gilde derer, die nicht alle werden: hier habt Ihr den Künstler gefunden, der Euch liebevoll Euer Porträt vorhält, den Biographen, der den Mechanismus Eurer ganzen Beschränktheit rücksichtslos freilegt.“[11]
Nein, liebes Lesepublikum, bitte verdrehen Sie angesichts dieser eloquenten Querschreiberei nicht Ihre Augen! Lassen Sie sich nicht provozieren – denn genau das möchte ja ein journalistischer Teaser.
Protagonist des Science-Fiction-Romans ist der Skandinavier Frithjof Andersen, der vor seiner neugierigen Nachbarschaft „die ungeheuerlichsten Dinge“ verbirgt. Zunächst gelingt es lediglich der Vermieterin Frau Mantzen, einen Blick in eine schlecht verschlossene Kiste in der geräumigen Wohnung des Junggesellen zu werfen. Hier entdeckt sie Gerippe und andere menschliche Gliedmaßen, deren Ursprung ihr höchst verdächtig ist und bald das ganze Haus in Aufruhr versetzen. Bald stellt sich heraus, dass der hier einsam hausende Erfinder einen alten Traum respektive Alptraum der Menschheit zu realisieren versucht. Auf die enthusiastisch-progressiv vorgetragene Frage: „Was wird der Mensch noch schaffen! Was wird der Mensch noch erfinden?!“ antwortet der Doktor schlicht: „Den Menschen!“[12]
Und so scheint bereits der mechanische Portier, der den ungebetenen Gästen den Zutritt verwehrt, der berühmten gothic novel „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ von Mary Shelly entsprungen zu sein: „Da stand der dunkle Dämon mit den grinsenden Zähnen, schillernden Augen und dem Grabesschimmer im Gesicht, von dem ein phosphoreszierender Hauch Moderduft aufzusteigen schien. Er stand noch immer an der Wand neben der Tür, kerzensteif und regungslos. Den beiden jungen Damen war es etwas gruselig.“[13] Das Lesepublikum darf erwarten, dass das eigentliche Projekt, der künstliche Mensch, weitaus überzeugender gestaltet sein wird als der Portier – in jedem Fall deutlich attraktiver.
Die verschiedenen Handlungsstränge werden im Wesentlichen durch eine Triebfeder beherrscht: Sowohl der überaus geniale und sympathische Doktor, Physiker und Ingenieur Frithjof Andersen als auch dessen von kabbalistischen Narben gezeichnete Diener Gunnar Bobbe sind jeweils beide für sich Hexenmeister und Zauberlehrling in einer Person – quasi zweieiige Zwillingsbrüder, von denen der eine die apollinische Rolle des nach Höherem strebenden Dr. Fausts, der andere die des dionysischen Mephistos übernimmt. Es bleibt bis zum Ende des Romans unklar, wer wirklich Herr und wer nur Gehilfe ist. Denn dem Genie Andersen unterläuft der entscheidende Fehler, seinen Androiden ohne Fehler zu schaffen, sodass ihm im Laufe des Romans nicht nur sein Geschöpf, sondern auch sein ganzes Leben entgleitet. Demgegenüber ist es der Diener Gunnar, des Chaos wunderlicher Sohn, der sich im Räderwerk des künstlichen Menschen besser auszukennen scheint als sein Herr und Meister und so das vollkommene Werk noch etwas vollkommener macht: Denn er fügt der neuen Kreation just jene Prise des gewissen Etwas hinzu, die uns erst zum wahren Menschsein verhilft und die wir in der Regel bei unserem Nächsten suchen: das Böse.
Und so steigt die Spannung, als gegen Ende eines Verkaufsgesprächs zwischen Frithjof Andersen und einigen geneigten Investoren das Produkt selbst sein „Leben“ in die eigenen Hände nimmt, während Erfindern und Geldgebern die goldenen Verheißungen durch die Finger rinnen. Binnen kürzester Zeit gelingt es dem Androiden unter dem bürgerlichen Namen Lars Andersen als Großindustrieller Karriere zu machen, seinem Schöpfer Braut und künftige Schwiegermutter auszuspannen und gar vom König zum Minister ernannt zu werden. Als er schließlich durch strategische Kommunikation einen militärischen Konflikt vorbereitet und es zu Massendemonstrationen kommt, die dazu aufrufen, sich gegen den Feind zu verteidigen, sieht sich der geniale Wissenschaftler dazu gezwungen, seiner eigenen Hände Werk zu zerstören.
Die Achillesfersen zwischen Fortschrittsoptimismus und ruchlosem Machtgebrauch
Es bleibt nun noch die Frage zu beantworten, warum der SciFi-Roman eine anspruchsvolle Trainingseinheit für die Lachmuskeln darstellt.[14] Mit wienerischer Leichtigkeit bettet Leo Silberstein-Gilbert die gesamte bürgerliche Gesellschaft der K.-u.-K.-Monarchie auf den Objekttisch seines Mikroskops und analysiert die unterschiedlichsten Bedürfnisse ihrer einzelnen Zellen: Stellt der Autor zu Beginn des Romans die Anfeindungen einer kleinbürgerlich-neugierigen Nachbarschaft gegen den genialen Wissenschaftler Frithjof Andersen in den Vordergrund, provoziert er schon wenig später das Bildungsbürgertum mit der Frage, ob die eingeübten Erziehungsmethoden nicht eher darauf ausgerichtet sind, mechanisch operierende Automatenmenschen zu programmieren. Dabei scheut er nicht davor zurück, selbst seine eigene Zunft, die Wissenschaft, einer freundlichen Nabelschau zu unterziehen.
Im Laufe des Romans lässt Silberstein-Gilbert sein literarisches Figurenkabinett während der sich anschließenden Sommerfrische ins österreichische Südtirol reisen, das vom internationalen Tourismus und der Wiener High-Society bevölkert wird. Angefangen von den modischen Freizeitaktivitäten Wandern, Radfahren und Tennisspielen über die aufkommende Jugendkultur, der Frauenemanzipation einschließlich der Infragestellung traditioneller Geschlechterrollen bis hin zum Klatsch und Tratsch während der Mahlzeiten bietet Silberstein-Gilbert seinem Lesepublikum unzählig erheiternde Perspektiven durch ein vorzüglich arrangiertes Kaiserpanorama auf die europäischen Gesellschaften im „Fin-de-siècle“.
Darüber hinaus spielt der Witz des Romans mit kreativen Veränderungen bekannter Motive. Während der Prager Golem stumm ist und über keinen eigenen Willen verfügt, kann der Android sprechen – ja, sein eigentliches Talent besteht darin, dass er über einen phrasendreschenden Sprachautomaten verfügt, der es ihm ermöglicht, Karriere zu machen und die Gesellschaft seinem Willen zu unterwerfen. Im Unterschied zum Golem reicht es auch nicht, dass ein Kabbalist ein paar Schriftzeichen an der Stirn wegwischt, um einen einfachen Lehmroboter außer Gefecht zu setzen. Der geniale Wissenschaftler hatte die dumme Idee, den Notschalter für seinen perfekten Androiden an einer nahezu unerreichbaren Stelle des menschlichen Körpers zu verstecken und dann noch mit entsprechenden „Passwörtern“ zu schützen.
Silberstein-Gilberts Leistung besteht darin, dass er Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, dem „August-Erlebnis“ der Massen und der Ragnarök mitteleuropäischer Monarchien mit prophetischen Blick die Achillesfersen zwischen Fortschrittsoptimismus und ruchlosem Machtgebrauch diagnostiziert. Doch im Unterschied zu den biblischen Bußpropheten schwingt er nicht die Geißeln des göttlichen Strafgerichts, sondern ergreift heinesche Spitzen und Finessen, mit denen er das Lesepublikum zum schallenden Lachen und kritischen Nachdenken anregen möchte.
Traum oder Alptraum vom künstlichen Menschen
Selbstverständlich war Silberstein-Gilbert Kind seiner Zeit und gestaltete die „Wiener Moderne“ mit. Das permanente Schwanken zwischen Zukunftseuphorie und Endzeitstimmung, zwischen Leichtlebigkeit und Weltschmerz ist in einigen Figuren und Motiven des Romans stark eingeschrieben. Auch wenn Silberstein-Gilbert keineswegs mit dem Protagonisten Frithjof Andersen identisch ist, verlieh er ihm einige seiner Gedanken und Sichtweisen.
Leo Silberstein-Gilbert inspirierte andere Menschen dazu, sich mit dem Traum respektive Alptraum vom künstlichen Menschen intensiver auseinanderzusetzen. Einer von ihnen war Otto Widmann, der mit seinem noch recht unbeholfenen Roboter namens „Occultus“ mehrere Jahre durch europäische Staaten tourte.[15] Inzwischen sind die Bastelprojekte des Menschen „digital“ geworden und überflügeln die Fähigkeiten ihrer Schöpfer. Seit einigen Jahren existieren sogar schon KI-basierte „virtuelle Politiker“, die hinsichtlich ihrer Interessen als „neutral“ gelten dürften, sofern wir von denen ihrer Investoren absehen. Neben dem neuseeländischen SAM (2017), der russischen ALICE (2017) erinnert der dänische LARS (2022) zumindest namentlich an den Androiden Lars aus dem Roman „Seine Exzellenz der Android“. Wir warten mit Spannung darauf, ob Künstliche Intelligenzen sich dem Wahlvolk einer demokratischen Gesellschaft lediglich verbal verpflichtet fühlen werden.
[1] Marie Herzfeld: Fin-de-siècle, in: Die Wiener Moderne: Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Herausgegeben von Gotthart Wunberg, Stuttgart 1981, S. 260-265, hier S. 260. Siehe zu ihr Herzfeld, Marie, in: Lexikon deutsch-jüdischer Autoren. Band 11: Hein–Hirs. Hrsg. vom Archiv Bibliographia Judaica, München 2002, S. 194-201.
[2] Barbara Beßlich: Das Junge Wien im Alter. Spätwerke (neben) der Moderne (1905-1938), Wien Köln Weimar 2021, S. 122.
[3] Clemens Sokal: Sterben, in: Die Wiener Moderne: Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Herausgegeben von Gotthart Wunberg, Stuttgart 1981, S. 266-267, hier S. 267.
[4] [Red.], Leo Gilbert gestorben, Der Abend, 18 (8.3.1932) Nr. 56, S. 3.
[5] Leo Gilbert: Seine Exzellenz der Android. Ein phantastisch-satirischer Roman. Mit einem Geleitwort von Rudolf Goldscheid und einem Nachwort zur Neuausgabe von Nathanael Riemer, Frankfurt am Main 2023.
[6] Franz Planer (Hrsg.), Das Jahrbuch der Wiener Gesellschaft, Wien 1929, S. 383.
[7] Vgl. u.a. Leo Silberstein-Gilbert: Spark-Producing Metals, in: Scientific American (8.2.1908), S. 97-98.
[8] Philipp Stauff, Semi-Kürschner, oder, Literarisches Lexikon der Schriftsteller, Dichter, Bankiers, Geldleute, Ärzte, Schauspieler, Künstler, Musiker, Offiziere, Rechtsanwälte, Revolutionäre, Frauenrechtlerinnen, Sozialdemokraten usw. jüdischer Rasse und Versippung, die von 1813 – 1913 in Deutschland tätig oder bekannt waren, Berlin 1913, Sp. 121, 471.
[9] Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums: Verzeichnis jüdischer Autoren vorläufige Zusammenstellung des Amtes Schrifttumspflege bei dem Beauftragten des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP und der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, Teil 6: S-V, [Berlin 1939], S. 18.
[10] Die deutsche Studentenschaft: Zwölf Thesen „Wider den undeutschen Geist“, (12.4.1933) https://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0207_gei&object=facsimile&st=&l=de (letzter Zugriff am 14.6.1933).
[11] Rudolf Goldscheid: Geleitwort, In: Seine Exzellenz der Android von Leo Gilbert, S. 5.
[12] Gilbert: Seine Exzellenz der Android, S. 34.
[13] Gilbert: Seine Exzellenz der Android, S. 25.
[14] Die zwei folgenden Absätze habe ich meinem Nachwort zur Neuausgabe entnommen: Gilbert: Seine Exzellenz der Android, S. 304-318, hier S. 309-310.
[15] Vgl. dazu u.a. den Artikel [Red.], Der künstliche, mechanische, sprechende Mensch „Occultus“, in: Die Neue Zeitung, 4 (Wien 27.3.1911) Nr. 85, S. 4 sowie [HNF], Auf den Spuren von Occultus, in: HNF-Blog. Neues von gestern aus der Computergeschichte, https://blog.hnf.de/auf-den-spuren-von-occultus/ (18.2.2022).


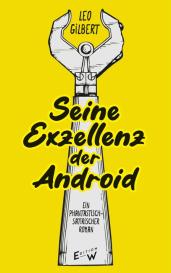
Taucht man in Realitäten, dann taucht man in einer endlosen Fiktion.
Hollywood ist alles Fiktion und Realität ist das gleiche, eine ständige Unruh, die keinem die Zeit gibt daraus zu entrinnen, zumindest für einen großen Anteil.
@ PRO 1
Hmm, ein bisschen kryptisch …
Immerhin verstehen Sie, was Sie meinen.
Schade, dass der Neu-Herausgeber und Autor dieses Artikels den Originaltitel verfälscht und damit dem Buch ein wesentliches Element seines Witzes nimmt. Seine Exzellenz ist im Original ein Automat, also ein seelenloses, rein mechanisch reagierendes Wesen, das sich dennoch in der Wiener Gesellschaft behaupten kann. Riemer macht daraus einen Androiden, einen Menschenabkömmling, der durchaus eigenständig untrainiert agieren kann.
Im Buch gibts den seltsamen, eigentlich nur durch den Originaltitel herleitbaren Satz:
„heute ist die emanzipierte Frau an der Reihe. Die Frauen sind Automaten der Liebe“
Unter dem verfälschten Titel wird die Boshaftigkeit dieses Satzes unerklärlich.
Sowas ärgert mich.