
Der Vater des Autors Sebastian Schoepp war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Noch Jahre später prägten ihn die Erfahrungen aus dieser Zeit.
An sichtbaren Zeichen hatte Vater aus dem Krieg mitgebracht: die handtellergroße Narbe einer Granatsplitterverletzung an der Schulter, einen Leistenbruch, den er sich beim Bäumeschleppen in Russland zugezogen hatte, sowie einen Koffer aus Hartpappe. Den fand ich als Halbwüchsiger auf dem Dachboden und benutzte ihn, um Schlagzeugstöcke und anderen Musikkram darin aufzuheben. Das war 1980, und ich hatte angefangen, in einer Band zu trommeln. Das war damals für einen Sechzehnjährigen eine ebenso wenig ungewöhnliche Beschäftigung wie 36 Jahre später. Keller oder Garagen, in denen man die ersten Akkorde probt, gehören zu einer kollektiven popkulturellen Erfahrung, die inzwischen mehrere Generationen von Vätern mit ihren Kindern teilen können.
Keine Antworten, keine Fragen

Vater und ich hatten keine solche Gemeinsamkeit. Wenn er 1980 daran zurückgedacht haben mag, was 36 Jahre vorher passiert war, so landete er nicht in einem Übungskeller oder einer Disco, sondern in einem Wald bei Brody, Ukraine. Dort irrte er im Sommer 1944 durch Birken und Himbeersträucher, von denen er sich Früchte abrupfte, um seinen Hunger zu stillen. Ein 21-Jähriger mit Kindergesicht und Bartflaum, verloren, allein, verängstigt, statt eines Musikinstruments eine Wehrmachtspistole in der Hand. In deren Magazin steckte noch eine Kugel. Die hatte er für sich selbst aufgehoben.
Solche Sachen hat Vater erst ganz spät erzählt, wenn ich an seinem Krankenbett saß und die Demenz einen Schlitz in den Schleier des Schweigens riss, den er sich selbst in den Jahrzehnten zuvor auferlegt hatte. Praktisch alles, was im Krieg passiert war, abgesehen von ein paar Anekdoten, hatte er weggesperrt, eingekapselt, verdrängt, siebzig Jahre lang.
Das Prägende, wahrscheinlich Traumatische, das er als junger Mensch im Krieg erlebt hatte, blieb außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Hatte er Menschen erschossen?
Was fühlt man im Angesicht des Todes?
Kann man je Frieden schließen mit solch einer Erfahrung?
Keine Antworten, keine Fragen. Ich hatte das akzeptiert – bis zu dem Moment, da Vater pflegebedürftig wurde. Die Krankheit brachte die Todesangst zurück. Plötzlich tauchten Bilder vom Krieg am Krankenbett auf, sogenannte Flashbacks, an die der Leidende sich nicht im strengen Sinne erinnert, sondern die er jedes Mal neu durchlebt, wenn ein äußeres Ereignis die knarzende Tür im Gehirn aufstößt.
Berge voller Leichen habe er gesehen, stammelte er im Krankenbett.
»Was für Leichen? Wann?«, fragte ich hilflos.
»Im Winter 45.«
Wo? Keine Antwort.
Die emotionale Abkapselung der Kriegsgeneration ist ausgiebig erforscht. Laut Autoren wie Sabine Bode, Luise Reddemann, Udo Baer und Gabriele Frick-Baer sind die Unfähigkeit zu fragen und die Unfähigkeit zu reden zwei Seiten derselben Medaille. Viele Eltern erzählten nichts, um den Kindern grausame Dinge zu ersparen. Und umgekehrt fragten Kinder ihre Eltern nichts, weil sie das Gefühl hatten, sie müssten sie vor ihren Erinnerungen schützen. Die Psychiaterin Luise Reddemann leitet daraus die »sprichwörtliche Sprachlosigkeit in deutschen Nachkriegsfamilien« ab.
Krankheit als Überlebensstrategie
Nur von Zeit zu Zeit schafften es bei Vater Anekdoten an die Oberfläche. Aus vielen dieser Geschichtchen, die er im Laufe seines Lebens erzählt hatte, konnte ich mir ein Bild zusammensetzen, aus dem man schließen musste, dass Vater als Soldat eher unbegabt war. Als Kanonier beschoss er wegen eines Rechenfehlers die eigene Einheit, er wurde zur Infanterie versetzt, dort verbummelte er beim Waffenreinigen die Sprungfeder einer tschechischen Beutepistole, mit der er sich nicht auskannte. Man warf ihm Sabotage vor, was aber ohne Folgen blieb, wohl weil man ihn für harmlos hielt. An der Front auf Wache schoss er im Dunkeln wahllos auf die Geräusche klappernden Kochgeschirrs und löste damit eine mittlere Feldschlacht aus. Von diesen immer wiederkehrenden Erinnerungsschnipseln abgesehen, lebte Vater wie der Großteil der deutschen Kriegsgeneration nach dem Motto, das Walter Kempowski in einem Roman formuliert hat: »Ohne Schwamm-drüber läßt sich das Leben nicht ertragen.« Verdrängen wurde zur Überlebensstrategie.
Erst Jahre später, nach seinem Tod, ging ich der Frage tiefer auf den Grund, was hinter seinen Anekdoten stecken, was Vater im Ganzen erlebt haben mochte. Ich stellte Rechercheanträge beim Wehrmachtsarchiv in Berlin und beim Roten Kreuz in München, das Zugriff auf die Kriegsgefangenenakten aus Moskau hat. Es war, um offen zu sein, ein madiges Gefühl, dem eigenen Vater nachzuspionieren. Auch wenn die freundliche Dame vom Wehrmachtsarchiv tröstend versicherte: »Sie sind da beileibe kein Einzelfall.« Doch war es nicht irgendwie erbärmlich, posthum herausfinden zu wollen, was man sich im Leben nicht zu fragen getraut hatte? So war diese Suche letztlich auch die Suche nach dem Urgrund der eigenen Feigheit.
Die Unterlagen schufen einen historischen Rahmen für Vaters spärliche Erzählungen. Das Übrige taten Feldpostbriefe, die er an seine Familie in Berlin geschrieben hatte und die ich in einem Schrank im Arbeitszimmer aufstöberte. Sie legten den Schluss nahe, dass Vaters Kriegserlebnisse insgesamt alles andere als anekdotisch gewesen waren.
Vater wurde 1942 eingezogen. Das erste Foto in Wehrmachtsuniform zeigt einen zarten, schüchtern dreinblickenden Neunzehnjährigen mit hellen Augen, dünnem Haar, feinen Zügen, eher ein Junge als ein Mann. Nach der Ausbildung sollte er 1943 an die Front, doch die ersten Monate verbrachte Vater fast ausschließlich im Lazarett – wegen einer Diphtherie, die er sich in Brest-Litowsk eingefangen hatte. Diese Infektionskrankheit verlief vor Erfindung von Antibiotika häufig tödlich, als Medikament hatte man im Krieg nichts Besseres als das vermeintliche Wundermittel Salicylsäure – besser bekannt unter dem Markennamen Aspirin. Man brauchte allerhand Zähigkeit, um eine Diphtherie ohne stärkere medikamentöse Hilfe zu überwinden. Aber die Infektion ersparte ihm Fronteinsätze. Hatte er daraus im späteren Leben unbewusst abgeleitet, dass Krankheit eine Überlebensstrategie sein konnte?



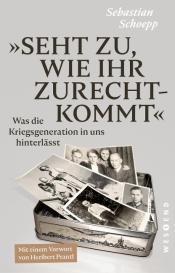
Rheinmetall -7%, Thyssen-Kripp -9% – Friedensplan lässt Wehraktien purzeln!
Die Bagage fährt ja schon wieder massiv gegen den „Friedensplan“ auf – wobei auch der sicher mit Vorsicht zu genießen ist.
Aktien sind keine realen Werte. Entscheidend ist, daß die Gelder weiterhin sprudeln sollen. So lange die Politik die Milliarden bereitstellt, ist deren Geschäft leider super.
Dies stimmt zwar, aber dennoch spiegeln die Aktienkurse Erwartungen der Spekulanten wieder. Hier wird mit einem großen künftigen konventionellen Krieg gezockt – alles was ihn irgendwie gefährdet, drückt schon die Kurse und die Kriegstreiber verlieren Milliarden. Der „Hauptgewinn“ wäre ein konventioneller Dritter Weltkrieg, bei dem Deutschland irgendwie als „Sieger“ hervorgeht. Dies ist natürlich unwahrscheinlich, es wird entweder zu einem (mehr oder weniger stabilen) Frieden oder zum Atomkrieg kommen, als dass Russland eine Operation Barbarossa 2.0 zulässt. Doch solange jemand darüber fantasieren kann, werden die Aktienkurse stetig steigen und viel Geld in die Kassen der Kriegstreiber spülen, die dieses dann für weitere Kriegstreibereien nutzen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit klein ist, bleibt der Erwartungswert der Kriegsgewinne dennoch hoch. Irgendwann (vielleicht schon bald) wird die Wehrblase aber dennoch platzen.
Ja, die Angst vor dem Frieden!
Ist Thyssen-Kripp ein neuer Zweig von Thyssen-Krupp?
der Fluch der 4. Generation: die Omerta des Grauens
– mein Opa war einer der ganz wenigen, der mir über seine Erlebnisse im WK2 berichtete. wie sie durch die Lande ziehen mussten, kein zuhause, Vater im KZ längst ermordet, Mutter Kommunistin (die rote Else). krumme Geschaeffte machen, klauen, allgegewaertige Gewalt –
als Bastard und Rassenschandbalk blieb meinem Opa die Traumatisierung durch Mordstüchtigkeiten erspart und so erzählte er von seinen Erlebnissen und ermöglichte mir ein Fenster in diese Zeit. – die meißte Menschen handeln gut deutsch: runterschlucken, weitermachen, i-wann geisteskrank werden. DAS ist die Saat der erneuten Katastrohpe, die in der 4. Generation erneut diesen Prozess initiert.
Ich hatte mal „das Glück“ die Briefe eines Angehörigen zu lesen, der als Soldat an der Ostfront war und dann am Ende in russischer Gefangenschaft gestorben ist.
Das sind wichtige Zeitzeugnisse ohne die es kaum möglich ist zu verstehen was und warum es geschah.
Die Briefe fangen mit großer Euphorie und Überheblichkeit an als sie mit dem Zug durch Polen Richtung Front gereist sind. Er war wirklich der Meinung Teil einer besseren Rasse zu sein.
Enden tut es dann damit, dass er sich mehr und mehr von seinen Kameraden abgesondert hat und für diese nur noch Ekel empfand. Sein ganzes Weltbild stand am Ende auf dem Kopf. An dem Punkt hören die Briefe dann auch leider auf und ich weiß nur von den Erzählungen anderer, dass er in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben ist.
Mein Vater kam mit einer Granatsplitterverletzung am Oberschenkel aus Russland ins heimische Lazarett. Nach Kriegsende musste er sich nochmals melden und kam für Wochen auf die Rheinwiesen. Als ich von dem Leid der Bevölkerung in Leningrad erfuhr, war ich froh das mein Vater dort nur Melder auf einem Motorrad gewesen war. Von den Menschen in Russland konnte er mir nur Positives berichten. Kriegsspielzeug war in meiner Familie Tabu, das rechne ich ihnen heute noch als absolut gute Entscheidung an. Was die Väter meiner Generation erlebt haben, darf sich nicht wiederholen.
Danke, guter Artikel, passend zum Totensonntag und eine Woche nach dem Volkstrauertag.
Wer sich für Feldpost interessiert (ich kann das nur empfehlen, Erzählungen aus erster Hand sind von unschätzbarem Wert), es gibt da einige Bücher dazu und eine kostenlose Briefesammlung:
https://www.briefsammlung.de/feldpost-zweiter-weltkrieg/
Man kann z.B. rechts einen Zeitraum eingeben und bekommt dann alle passenden Briefe des Archivs angezeigt, mit Faksimile.
Hier findet man auch welche und zusätzliche Informationen:
http://www.feldpost-archiv.de/
Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Briefe zensiert wurden:
http://www.feldpost-archiv.de/11-zensur.shtml
also nicht immer geschrieben wurde, was man dachte und z.B. wo man stationiert war.
Mein Opa väterlicherseits war auch als junger Mann im Krieg, erst in Russland, wo er eine Granatverletzung erlitt, dann in Frankreich, wo er in amerikanische Gefangenschaft geriet (was er immer mehr oder weniger positiv erinnerte, weil die nicht hungerten). Leider war ich für tiefschürfende Fragen einfach zu jung damals, so dass ich nur wenig direkt von ihm erfahren habe, bevor er verstarb.
wow, danke für die Links!
Und bei „ich kann das nur empfehlen, Erzählungen aus erster Hand sind von unschätzbarem Wert“ gehe ich voll mit!
Der eine Opa erzählte nichts , fand auch keine Photos über diese Zeit, der andere erzählte von einem Krieg , vor allem Frankreich, der mit der Ostfront nichts gemeinsam hatte..
Einmal erzählte er mir von einer Schlacht in irgendeiner Stadt in Frankreich, aber nicht Franzosen , sondern Wehrmacht gegen SS .. o(
Er war Adjudant irgendeines Generals da ….
Nur eines war bei allen Erzählungen gleich, Nazi Kollaborateure war der niedrigste Soziale Rang an allen Fronten, zumindest bei den Deutschen selber ..
Verrat wurde geliebt, aber niemals der Verräter …
Tja dann die Traumas. Der Krieg ist irgendwann zu Ende, und doch geht Er weiter.
Kriegstraumas gehen über 7 Generationen, spricht 7 Generationen Kinder erwartet dann oft noch Gewalt, deren Ursachen in einem Krieg zu finden sind ..
7 fckn‘ generations ? gibts da i-wo mehr darueber zu lesen ?
Das ist reiner Unsinn.
Schon mal ein Anfang das Du es bei irgendeinem Sinn zumindest noch lässt ….
Das war DDR Stand Forschung, und erzählt hat mir das ein Professor bzw Oberstleutnant Abteilung Psychatrie Haftkrankenhaus Meusdorf ..Rocke war sein Name, wobei Ich mir nicht sicher bin über die Schreibweise seines Namens ..
Sogar Googles KI hat Wissen zu diesem Thema .. o)))
„Übersicht mit KI
Kriegstraumata können sich über mehrere Generationen erstrecken, wobei Studien darauf hindeuten, dass die Weitergabe mindestens bis in die dritte oder sogar vierte Generation erfolgen kann
. Dies geschieht sowohl durch die Weitergabe von Verhaltensmustern und sozialen Umfeldern, die von den Traumata geprägt sind, als auch durch neurowissenschaftliche Forschung, die auf eine mögliche epigenetische, also eine Art genetische, Weitergabe hinweist“
Mein Kindlicher Arsch sah oft schlimmer als ein Schlachtfeld aus, wenn ich Blödsinn angestellt hatte. Und mich hat einfach Interessiert später woher so ein Jähzorn kommen kann bei Menschen die in der Gesellschaft sogar für Vorbild standen ..
Ich habe mich geschämt wenn ich Sport lange Hosen tragen musste damit niemand das sieht wie alles aufgeplatzt war .
DDR Zeiten , hätten solche vor Gericht gehört, aber das war ja Ihre politische Elite…
Beiseite, dass ich transgenerationale, also generationsübergreifende Weitergabe von Traumata auf genetischer bzw. epigenetischer Grundlage als rein spekulativ bewerte, solange noch nicht mal geklärt ist, ob dabei das Trauma an sich oder das unverarbeitete Trauma oder ein von unverarbeiteten Traumata verursachtes spezifisches Verhaltensmuster (genetisch) übertragen wird, bleibt festzuhalten, dass die Zahl 7 vom normalerweise verbreiteten Unsinn eines über 3 – 4 Generationen vererbten Traumas abweicht. Extrem abweicht.
Vielleicht ist ihnen ja nur die Zahl verpurzelt und sie meinten 3 statt 7. 😉
Eine Vererbung über 7 Generationen würde immerhin bedeuten, dass wir Traumata aus dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 zu verarbeiten bzw. psychoanalytisch aufarbeiten müssten. Wahrlich eine fast ewige Erbschuld.
Außer Frage steht, dass möglicherweise von Traumata verursachte spezifische Verhaltensmuster wie massive Gewaltanwendung Schäden beim Opfer dieser Gewalt verursachen können und dann traumatische Erlebnisse verursachen, die dann wiederum weiter auf die nächste Generation fatale Wirkung zeitigen (können).
„Das ist reiner Unsinn.“
steht bei mir weniger für Übertreibung o)
Ja lange her, könnte durchaus sein das ich hier falsche Zahl im Kopf hatte, was aber nichts am Grundlegenden Problem ändern, das ein Krieg nicht zu Ende ist, nur weil Waffen schweigen, worum es ja im Kern ging..
Das Problem liegt ausschließlich bei der Behauptung genetisch bzw. epigenetischer Vererbung, die somit als unausweichlich, als nicht vermeidbare Vererbung impliziert wird.
Dieser Buchsuszug schildert das heutige Dasein!
Hier geht es nicht um Wahrheit, sondern über menschliche Entscheidungen, über richtig und falsch.
Ist diese Menschheit verrückt geworden, das diese ihre Menschheit mehr erkennt?
Für die eigene Recherche:
https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/aus-unserer-archivarbeit/die-zentrale-personenkartei-der-wehrmachtauskunftstelle/
https://www.bundesarchiv.de/das-bundesarchiv/aus-unserer-archivarbeit/unterlagen-der-abteilung-personenbezogene-auskuenfte-zum-ersten-und-zweiten-weltkrieg/
https://www.bundesarchiv.de/im-archiv-recherchieren/archivgut-recherchieren/personen-und-familienforschung/militaerische-verbaende-und-einheiten-bis-1945/
Mein Vater hat mir immer alles erzählt, auch weil ich immer alles wissen wollte, wie das so ist bei Hochbegabten.
Von seiner Musterung 1937, 2 Jahre Wehrdienst und dann direkt rein in den Krieg nach Polen.
Ich kenne seine Waffengattung, seine Fahrzeuge, wo er wann so ziemlich genau war.
Wie er sich gefühlt hatte als sein Zug durch einen Volltreffer in der Ukraine 42 bis auf ihn und noch einem Kameraden vernichtet wurde, danach Zuhause etwas Erholung und dann rüber nach Frankreisch, wo er sich zum Schluss bei Rückzugsgefechten 2 Kugeln in den Unterbauch einfing.
Lazarett bei Lons le saunier, nur weil er französisch konnte wurde er überhaupt von einem guten Arzt operiert, mit dem er noch über Jahre hinaus einen Briefwechsel führte.
Er wurde deportiert, kam in die Kriegsgefangenschaft nach England, wo er im Lager als Koch fungierte.
Wahrscheinlich resultiert meine Leidenschaft für das Französische, als ich als vorpubertärer Junge seine vielen Briefe las, die auf französisch geschrieben waren, inklusive der Antworten des Arztes, die ich unbedingt verstehen wollte.
Mein Großvater war in Russland, und hat mit 22 sein rechtes Bein verloren, höchstwahrscheinlich durch Friendly Fire.
Er hat den Krieg zwar überlebt, aber die Folgen wirken bis heute nach. Als Familienvater war er ein cholerischer, grausamer Tyrann, der seine Kinder geprügelt hat, bis sie nicht mehr sitzen konnten. Seine Frau: einsam. Sie hat ihn später betrogen. Seine Kinder: allesamt traumatisiert und hoffnungslos zerstritten. Deren Kinder (also unter anderem ich) haben diese Nachwirkungen sogar noch gespürt. Meine Mutter war psychisch schwer krank (Narzissmus, Depressionen, Messi-Syndrom, passive Aggressivität). Sie konnte ihre Traumata bis zu ihrem Tod nicht verarbeiten, geschweige denn ablegen. Mein Vater: Borderline. Er kam mit den Problemen meiner Mutter nicht klar. Ich bin ebenfalls seit 20 Jahren schwer depressiv.
Mein anderer Opa war Nazi bis zum Schluss, aber er hatte wesentlich mehr Glück, denn er war zu jung für den Einsatz an der Front und hatte wohl auch Offiziere, die ihn und andere junge Männer gegen Ende des Krieges nicht mehr opfern wollten. Höchstwahrscheinlich war es auch seine Flugausbildung, die ihm am Ende das Leben rettete, denn es gab keine Kampfflugzeuge mehr, daher war er nur an Flugabwehrstützpunkten im Einsatz. Er konnte später ein einigermaßen gutes Leben führen, unter anderem auch deshalb, weil sein Elternhaus von den Bomben verschont geblieben war. Ein Großteil der Stadt lag nämlich in Schutt und Asche.
Krieg ist scheiße!
Ein lesenswerter Artikel.
Auch meine Eltern haben so einiges als Augen- und Zeitzeugen erzählt.
Schlimm wird es, wenn es nur noch Menschen an den Schalthebeln der Gesellschaft und der Macht gibt, die nicht mehr die Gelegenheit hatten, persönlich mit Zeitzeugen zu reden.
Im Grunde beginnen die Jahrgänge dieser Ahnungslosen schon bald nach der Geburt des Autors im Jahre 1964, spätestens wohl (von Ausnahmen abgesehen) ab Geburtsjahr 1970. Ab da gab es eigentlich nur noch die Großeltern, die hätten erzählen können, und Großväter hatten nicht so viele überlebt.
Ohne solchen Kontakt mit Zeitzeugen aus der eigenen Familie fehlt der emotionale Bezug.
Es ist etwas irritierend, dass Kanzler Merz noch zum Jahrgang 1955 gehört …
Guten Abend Herr Wirth!
Wie ich weiter unten bereits in Form biographischer Berichte erläuterte, sind manche sowohl während als auch nach Ende des Krieges weicher gefallen als andere. Nur wer die Schrecken wirklich selbst erlebt hat, bekam die Chance zu einem persönlichen Perspektivwechsel. Und dann soll es ja noch Menschen geben, die grundsätzlich nichts dazu lernen. Überzeugungstäter nennt man diese.
Merz entstammt einer Juristenfamilie, also grundlegend staatsnah. Er hat Wehrdienst geleistet und nicht verweigert. Sein Vater hat jedenfalls direkt nach dem Krieg seine Karriere als Richter fortsetzen können. Womoglich ist auch darin eine Erklärung zu finden.
Ich kenne einige Leute, die es eigentlich besser wissen müssten, und es dennoch nicht tun.
@DasNarf
Hallo!
Ja, Sie sprechen etwas Wichtiges an.
Ja – nur, wer den Schrecken selbst erlebt hat!
Auch wer 1945 – sagen wir mal – schon 25 Jahre alt war – also Jahrgang 1920, hatte keineswegs automatisch dieselben Eindrücke, Erfahrungen, Entbehrungen usw. wie andere Angehörige dieses Jahrgangs.
Da gab es die Landbevölkerung, etwa in Niedersachsen, die die Bombergeschwader nur immer rüberfliegen sah und dann beim Schwarzmarkt gut tauschen konnte. Nicht jeder Bauer war eingezogen worden.
Da gab es die Etappen- und Schreibstubensoldaten – etwa in Dänemark – die einen vergleichsweise lockeren Job hatten.
Da gab es Soldaten, die vergleichsweise früh in amerikanische Gefangenschaft geraten waren, z.B. in Nordafrika, denen vieles erspart blieb.
Dann gab es Familien, die nicht ausgebombt wurden (vielleicht in Bayern oder Schlesweig-Holstein), die nicht vertrieben wurden und die durch glücklichen Zufall auch kaum Gefallene zu beklagen hatten und vielleicht vor 1945 sogar wirklich relativ wenig von den Untaten des Regimes erfahren hatten. Ja, auch das gab es.
Man denkt immer zuerst an jene, die Furchtbares erlitten haben und meint, dass das fast alle gewesen seien, aber das waren eben auch damals nicht alle. Und was für den einen schon schlimm war, das wäre für einen anderen an der Ostfront vielleicht noch beinahe alltäglich gewesen.
—
Ihre Sätze zu Merz sind interessant und mir teilweise neu.
@ Wolfgang Wirth
Schauen Sie mal hier nach:
„Der Opa von Friedrich Merz“
Overton Magazin, 30.07.2023
Autor – Peter Bürger
Incl. der Kommentare und Links ein abendfüllender Artikel.
Ich vermute, dass hinter solchen Leuten einfach hoffnungslose Opportunisten stecken, sie tun, was erwartet wird, wenn sie damit erfolgreich sind, tun sie gern auch noch ein bisschen mehr, um aufzusteigen. Zögerlich sind sie nur in Umbruchphasen, wenn noch nicht klar ist, wer künftig den Ton angibt.
Deprimierende Menschen, aber ich glaube genau dasselbe prinzipienlose Verhalten auch beim Friedrich zu erkennen. Mit so einer Einstellung fällt man halt in jeder Gesellschaft nach oben.
lieber herr m. – ganz herzlichen dank für die info –
seit dieses spillerige männchen wieder aufgeploppt ist, frage ich mich nach seinen ‚herstellern‘ … – verlinke hier mal den genannten bürger-artikel:
https://overton-magazin.de/top-story/der-opa-von-friedrich-merz/
die beschäftigung mit den eigenen eltern und großeltern ist nicht nur herausfordernd, sondern m.e. zwingend erforderlich, will man nicht wieder irgendwelchen rattenfängern in den abgrund folgen –
über 30 jahre gab ich mich mit dem etikett ‚depressionen‘ zufrieden – erst eine traumatherapeutisch begleitete selbstbegegnung 2018 mit dem auf einige wortzeichen konzentrierten anliegen („angst – und ich weiß nicht warum“) setzten eine erdrutschartige entwicklung in gang, die bis heute andauert –
als who-tedros ende 2019 in der tagesschau was von globaler gefahr rumschwadronieren konnte, bekam ich angst und ließ mich erstmal gegen pneumokokken impfen – dennoch nahm die frühtraumatisierten innewohnende existenzielle angst durch maskenzwang, zutrittsverbote ff massiv zu und hält mich bis heute in form von schmerzbegleiteten panikattacken (wider besseren wissens) alltäglich in ihren klauen – ohne meine therapeutin, die mich u.a. auf sucharit bhakdi und wolfgang wodarg aufmerksam machte, hätte ich diese skrupellose top-down agenda nicht überstanden, da mein freundes- und familienkreis seit 2020 sich bis auf zwei menschen pulverisiert hat –
unser derzeitiger kanzler scheint bis heute in irgendeines ahnen spuren zu wandeln, sonst bliebe ihm sein zynismus im halse stecken und er könnte vergangenheits- resp. (groß-)eltern-schonend nicht derart blind fürs eigene tun sein und 80 jahre nach hitlers angriffslüge ‚opas‘ russland-bashing wiederholen
Nicht zu vergessen das er ein Adlat von Blackrock ist, der uns an die herrschende Klasse verkauft und das dürfte sein eigentliches monaitaires Interesse darstellen.
An dieser Stelle mal vielen Dank an die Kommentatoren! Das ist wie damals bei Telepolis ein echter Mehrwert.
ja, alte Telepolis …ich selber war damals als „mz250ts“ da unterwegs… War eine Interessante Zeit damals, konnte viel lernen .. o))
Mein Vater war Jahrgang 1929, Arbeitersohn, die Eltern sparten sich die Mittelschule vom Mund ab.
Er und seine Jungensklasse wurden 1943 ins KLV-Lager nach Mariazell geschickt, weil im Ruhrgebiet (Gelsenkirchen im Falle meiner Familie) die Luftangriffe begannen!
Die 30 Jungens gehörten einer Sonderformation der HJ an, der Flieger-HJ!
Mein Vater erzählte begeistert von dieser Zeit, als Bergmannssohn in dieser Umgebung lernten die Jungen Skilaufen und Segelfliegen, das wäre ihm sonst nie möglich gewesen; nur Hunger hatten sie immer, wie er sagte.
Ende März 1945 wurde die gesamte Klasse zur Luftwaffenmotorschule geschickt (Flieger-HJ!) um dort „richtig“
fliegen zu lernen, alle waren begeistert!
Motorflug war aber nicht, sondern Stahlhelm und Karabiner, drei Wochen „Ausbildung“. Trotz ihrer Enttäuschung waren sie aber doch begeistert, als sie im Rahmen einer Luftwaffeneinheit dann Anfang April 1945 an die Front geschickt wurden.
„Wir waren wie besoffen,“ sagte er immer wieder und sehr stolz, das sie nun Deutschlands Schicksal wenden würden, sie jetzt Männer seien und es auf sie ankäme.
Diesen Fronteinsatz haben nur sieben (!) überlebt!
„Die Hälfte haben sie schon erledigt, als wir aus dem Zug kletterten, Tiefflieger….“
Dann machte er immer eine Pause, war weit weg, um mich dann anzusehen und mir das Geräusch vormachte, wie es sich anhört, wenn Geschosse in menschliche Körper einschlagen!
Das habe ich mehrfach von im gehört und er wollte mich unbedingt zum Pazifisten erziehen!
Kriegsspielzeug war verboten, da war ich sehr traurig, weil meine Klassenkameraden alle kleine Soldaten und Panzer hatten, nur ich nicht!
Ich wurde geweckt, als ich noch in der Grundschule war, um mit ihm den Film
„Die Brücke “ zu sehen, ich musste Nachrichten sehen, den Weltspiegel, wo man die Bilder aus Vietnam und Biafra gesehen hat, da war ich sieben/acht Jahre alt ( bin 1959 geboren); unvergessen für mich das Mädchen, das nackt, von Napalm verbrannt schreiend auf die Kamera zulief.
Meine Oma erzählte mir sehr plastisch über die Luftangriffe auf meine Heimatstadt, meine Mutter ( Jahrgang 1936) fing an zu zittern und zu weinen, wenn in meiner Kindheit die Sirenen zur Probe heulten.
Als die Sowjetunion 1968 in die CSSR einmarschierte, kam ich aus der Schule, wurde von ihr Tränenüberströmt empfangenen, in den Arm genommen und habe mit ihr und meinem jüngeren Bruder in der Küche auf dem Boden gehockt, bis mein Vater nach Hause kam
und sie beruhigte!
„Nur kein Krieg mehr, nur kein Krieg mehr „, wiederholte sie dabei unisono!
Da war ich neun Jahre alt!
Mir blieb gar nichts anderes übrig, als mich mit Kriegs-und Militärgeschichte zu befassen, ich musste das irgendwie verstehen und habe keinen anderen Weg
gesehen, ich tue das bis heute!
Ich halte mich durchaus für traumatisiert,
obwohl ich den Krieg selbst nicht erlebt habe, später hatte ich professionelle Hilfe durchaus nötig; mit 10 habe ich noch ins Bett gemacht!
Wenn ich irgendetwas zutiefst verabscheue, so ist es das Militär!
Pazifist bin ich geworden, aber kein gewaltloser, auf Demos habe ich in jungen Jahren durchaus mich mit der Staatsmacht angelegt, nicht nur verbal!
Unsere kriegsgeilen Politiker kann ich nur zutiefst verachten!
Danke!
Danke für einen Einblick in Ihre Biographie. Ich finde es immer wieder großartig, wie unglaublich produktiv dieses Forum ist.
Ich habe selbst auch keinen Krieg erlebt. Aber witzigerweise bin ich traumatisiert. Einmal durch die vielen Erzählungen und Dokumentationen, die ich bereits als Kind/Jugendlicher mitbekommen habe. Bin wohl sehr synästhetisch veranlagt. Dann durch die alltägliche Gewalt, die ich an vielen Stellen mitbekommen oder auch selbst erlebt habe.
Traumatisiert bin ich aber vor allem durch etwas anderes: Die Abgebrühtheit vieler Zeitgenossen. Mir wird regelmäßig übel, wenn ich Gespräche über Alltagsgewalt, Armut/Reichtum oder historische Kriege höre. Für manche Menschen scheint z.B. der Ukrainekrieg eine Art Sportevent zu sein. Da wird dann gefachsimpelt über strategische Situationen oder den taktischen Nutzen neuer Waffensysteme. Wieso kommt den Leuten eigentlich nicht in den Sinn, dass da echte Menschen sterben??
Vor ein paar Jahren stieß ich durch „Empfehlung“ eines Freundes auf ein Videospiel namens „Hell Let Loose“. Auf deutsch etwa „Die Hölle bricht los“. Das ist ein Kriegsspiel, in dem man in die Rolle eines Soldaten im zweiten Weltkrieg schlüpft. Man spielt das Game online, also ausschließlich mit bzw. gegen andere Menschen. Die Perspektive ist die Ego-Sicht, man hat also das Gefühl, wirklich dort zu sein. Und ich kann sagen… ich habe dort alles erlebt. Von Hitlergrüßen bis hin zu Blödeleien war alles dabei. Und das Spiel ist krass, man stirbt an jeder Ecke. Der Realismus ist gewollt. Gegen Artillerie hat man kaum eine Chance. Scharfschützen knipsen dich aus, ohne dass du siehst, woher. Panzer überrollen Hindernisse und Infanterie als wäre es Papier. Ein permanentes Gefühl des Ausgeliefertseins, der Panik und Paranoia stellt sich ein.
Und die Leute zocken das einfach, als ob es Fußball wäre. Tja, am Computer kann man jederzeit neu starten, in der Realität hat man nur ein Leben. Ich bin nur schockiert, dass es anscheinend so wenige schaffen, aus einer Simulation wie dieser auf das reale Leben zu abstrahieren. Es findet halt im Kontext der „Unterhaltung“ statt, ebenso wie viele Actionfilme, wo mich die ständige Gewalt inzwischen nur noch anekelt.
Ist das langjährige Gehirnwäsche? Und warum erzeugt die in mir das Gegenteil?
@DasNarf
Zu Ihrer Frage:
„Und warum erzeugt die in mir das Gegenteil?“
Ja, das geht mir ähnlich. Mich stößt das auch ab, und mich irritiert bereits die Begeisterung, mit der viele Leute Krimis gucken. Kriegsspiele wie die von Ihnen geschilderten habe ich noch nie gesehen.
Ja, warum ist das so, warum wirkt Gewalt auf die Menschen so unterschiedlich?
Die Menschen sind anscheinend noch tiefgehender verschieden als man gemeinhin denkt und seltsamerweise sind sie selbst bei ähnlicher Prägung und Erziehung trotzdem unterschiedlich reif. Ein Umstand, der schwer zu erklären ist.
Und ja – vielleicht spielt da das asiatische Konzept der Reinkarnation und der jüngeren oder älteren Seelen eine Rolle? Zumindest halte ich es für gut möglich.
Den Gedanken habe ich auch oft, es scheint so, als ob manche Gewalt und Horror erleben wollen, aber sicherheitshalber doch nur aus zweiter Hand 🙂
Ich erzähle das, was mein Großvater, der es nach fünfjähriger Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion mir erzählt hat, meinen Kinder… Hier aufzuschreiben wäre zu viel., deckt sich inhaltlich mit dem, was ich hier gelesen habe.
Der andere Großvater liegt in einem Grab mit vielen irgendwo in Russland, unidentifiziert …
Großmütter waren auch eine gute Quelle.
NIE WIEDER KRIEG