
Die neoklassische Ökonomie wollte einst präzise wie ein Uhrwerk sein. Sie war damit nichts anderes als Kind ihrer Zeit.
Ein Auszug aus dem Buch »Raus aus dem Ego-Kapitalismus. Für eine Wirtschaft im Dienste des Menschen«.
Um das Selbstverständnis des Mainstreams zu verstehen, der seit den 1980er Jahren die Politik dominiert, ist eine Reise in die Anfänge der neoklassischen Denkschule hilfreich. In der Tat verdankt die Neoklassik ihre Entstehung der Physik des späten 19. Jahrhunderts. Der Historiker und Ökonom Philipp Mirowski ist der Entstehungsgeschichte des Mainstreams auf den Grund gegangen und hat dabei erstaunliche Erkenntnisse gesammelt. Er stellte fest: »Die Geschichte der Physik und die Geschichte der Wirtschaftswissenschaft sind so eng miteinander verbunden, dass es als skandalös angesehen werden könnte. (…) Die Begründer der neoklassischen Wirtschaftstheorie kopierten in den 1870er Jahren einfach die vorherrschenden physikalischen Theorien. (…) [Sie] imitierten die Physik nicht nur oberflächlich oder flüchtig. Nein, sie haben ihre Modelle weitgehend Wort für Wort und Symbol für Symbol kopiert und dies auch gesagt.«
Ökonomik und Mechanik

Tatsächlich haben die Neoklassiker ihre »Inspiration« nie verheimlicht. Immer wieder kamen Bezüge dazu, dass die Ökonomie im Grundsatz die zentrale Idee der »Kraft und Bewegung« (Marshall) sein sollte, »kaum ein Ökonom« es versäumt habe, einen »Vergleich zwischen Ökonomie und Mechanik anzustellen« und sich den »Großteil seines Vokabulars von der Mechanik [zu leihen]« (Walras), oder »ein Ökonomiestudent in den Prinzipien der Mechanik denkt« (Fisher). Selbst heute noch sind die Bezüge zur Mechanik deutlich, wenn die Ökonomen beispielsweise von »Friktionen« sprechen. Eine solche Sprache suggeriert, dass die Marktmechanismen per se eigentlich wie eine gut geölte Maschine einwandfrei laufen müssten, es aber aufgrund irgendwelcher Gründe nicht tun.
Im Laufe der Zeit war es insbesondere Irving Fisher, einer der einflussreichsten Ökonomen der Geschichte, der in seinem »copy-paste« Ansatz sehr transparent vorging. Er kopierte in aller Offenheit die wesentlichen Elemente und Konzepte der damaligen Mechanik und entwarf ein »ökonomisches Äquivalent« dazu. Energie wurde auf diese Weise zum Nutzen, Teilchen entsprachen Individuen, Kraft wurde dem Grenznutzen gleichgesetzt, kinetische Energie entsprach den gesamten Ausgaben und so weiter. Diese Tabelle, festgehalten als die sogenannten »Übersetzung Fischers«, ist unten in der übersetzten Fassung abgedruckt. Wie wir unschwer erkennen können, wurde nur die Bezeichnung der Variablen geändert. Nicht mehr.
| Mechanik | Ökonomik |
| Ein Teilchen | Ein Individuum |
| Raum | Raum aller Güter |
| Kraft | Grenznutzen oder negativer Grenznutzen (disutility) |
| Arbeit | Negativer Nutzen (disutility) |
| Energie | Nutzen |
| Arbeit oder Energie = Kraft × Raum | Nutzen = Grenznutzen x Ware |
| Kraft ist eine vektorielle Größe. | Der Grenznutzen ist eine vektorielle Größe. |
| Kräfte werden durch Vektoraddition addiert. | Grenznutzen werden durch Vektoraddition addiert. |
| Arbeit und Energie sind Skalare. | Negativer Nutzen (disutility) und Nutzen sind Skalare. |
| Die Gesamtenergie kann als Integral der treibenden Kräfte definiert werden. | Der Gesamtnutzen des Individuums ist das Integral der Grenznutzen. |
| Mechanisches Gleichgewicht (Equilibrium) stellt sich ein, wo die Nettoenergie (Energie minus Arbeit) maximiert ist, bzw. wo die treibenden Kräfte und Widerstandskräfte gleich sind. | Das Gleichgewicht ist, wo der Zuwachs (Nutzen – negativer Nutzen) maximiert ist; oder das Gleichgewicht wird dort sein, wo der positive und negative Grenznutzen gleich sind. |
| Die Differenz aus Gesamtarbeit minus Gesamtenergie (anstatt andersherum) ist das Potential und ist minimal. | Wenn der Gesamtnutzen von gesamten Negativnutzen subtrahiert wird (anstatt andersherum) kann die Differenz als Verlust definiert werden und ist minimal. |
Physische Präzision
Die Neoklassik entstand somit, wie Mirowski schreibt, auf der Grundlage einer »Piraterie der Physik durch eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern.« Wenig verwunderlich liefen die damaligen Physiker Sturm dagegen, dass man so vorging, denn Natur- und Sozialwissenschaften unterscheiden sich grundlegend voneinander. In der Ökonomie, die untrennbar in eine soziale und natürliche Umwelt eingebettet und dabei unzähligen, endogenen (systemimmanenten) Wechselwirkungen ausgesetzt ist, ist es absurd anzunehmen, dass man dieselben Gesetze anwenden könnte wie in der mechanischen Physik. Ganz zu schweigen davon, dass die Akteure, die in der Wirtschaft agieren, ihre Entscheidungen nicht nur in fundamentaler Abhängigkeit voneinander treffen, sondern dies auch noch bei fundamentaler Unsicherheit tun! Zudem entdeckten die Physiker viele Fehler und logische Inkonsistenzen in dem Ansatz der Ökonomen (allen voran die Nichtbeachtung der Erhaltungsgesetze). Doch die Neoklassiker scherten sich nicht um eine solche Kritik und »zogen los, um den klassischen, historizistischen und marxistischen Ökonomen den Kampf anzusagen.«
Viel wichtiger als Realitätsnähe war dabei der Wunsch, man könnte in den Wirtschaftswissenschaften mit einer ähnlichen Präzision und »Wertneutralität« wie in der Physik arbeiten. Wenn man die Bewegung von Körpern und die Wirkung von Kräften in der Ökonomie finden würde, so wäre es möglich, akkurate und objektive Vorhersagen über die weitere Entwicklung zu treffen. Ursache und Wirkung wären leicht zu identifizieren, kritisches Nachdenken wäre unangebracht. Zudem glaubte man damals, die Mechanik wäre auf dem Weg zu einer einzigen, allumfassenden Theorie. Eine solche Welt der allgemein gültigen »Gesetze«, die sich im Idealfall mit einer einzigen Formel beschreiben könnte, wollte man in der Ökonomie ebenfalls haben.
Passend zum Thema: Roberto De Lapuente im Gespräch mit Patrick Kaczmarczyk.
Ähnliche Beiträge:
- »Ökonomie, die sich in wissenschaftlicher Präzision und Unfehlbarkeit wähnt, macht sich lächerlich«
- Wirtschaftswissenschaften heute: Weltanschauung im Wissenschaftsgewand
- Zentrale Regelungen und Institutionen einer anstrebenswerten nachkapitalistischen Wirtschaft
- Deng Xiaoping und die Wende zum Kapitalismus
- Walter Ötsch über Lippmann „Die Politiker haben sich in eine Sackgasse hineinmanövriert“


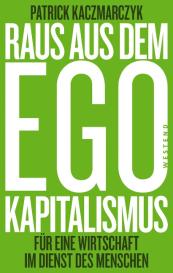
Präzise wie ein Uhrwerk. Das Handwerk Uhrmacher war eine filigrane Tätigkeit und ich empfand diese Arbeit als sehr schön. So gab es sehr viele Berufe, damals, die jedem mit Stolz erfüllte, weil jeder ein Teil innerhalb der Gesellschaft war und die einen mehr oder die anderen weniger von diese stolzen Könnern etwas benötigten.
Man ging in die Geschäfte wurde bedient, kommunizierte (im guten wie bösen), und am Ende hatte der Mensch eine Erfahrung gemacht.
Heute bestellen wir online, plappern mit Maschinen oder Maschinenartigen Subjekte und erfreuen uns über das schnäppschchen oder ärgern uns über virtuellen Mist.
Soll jeder machen was dieser will, aber ich vermisse in der Schweizer Strasse Sachsenhausen, den damaligen alten Uhrenverkäufer und seine Werkstatt für mechanische Uhren. Was für ein netter Mann er doch war…
Nur ist eben der Mensch kein Teilchen mit vorhersehbaren Eigenschaften. Der Mensch ist ein Individuum mit wechselnden Launen und Gefühlen, deren Vorhersagbarkeit sehr begrenzt ist. Wie oben beschrieben, wollte man die Wirtschaftswissenschaften zu exakten Naturwisseschaften erheben. Das ist aber grandios gescheitert. Die Ökonomie gehört zu den Gesellschaftwissenschaften, die das Verhalten von Individuen und Gesellschaften unter vielen verschiedenen Einflüssen zu beschreiben versucht.
Aber die Zahlentabellen und Tortendiagramme sehen aber total (natur-)wissenschaftlich aus! Die MINT-Fächer haben ja nicht grundlos einen besseren Ruf als die Geisteswissenschaften. Aber durch die heutigen Abhängigkeiten von Drittmitteln kann man den Naturwissenschaften leider auch nur nach skeptischer Prüfung trauen. Wer bezahlt bestimmt eben, welche Musik gespielt wird.
Wie haben Physik, Chemie und Biologie, als Wissenschaften.
Wie haben Cargo-Kult, Religion und Geisteswissenschaften als Pseudowissenschaften.
Als Skeptiker braucht man nachprüfbare Beweise und keine Theorien die sich erfüllen.
Die Wirtschafts-„wissenschaften” hat der olle Alfred Nobel aus eben diesem Grund nicht mit einem Preis in seinem Nachlass bedacht. Leider haben die Plappermäuler und Cargo-Kultisten auch im Nobelpreiskomittee das Sagen. Gab zum Beispiel 1949 einen Medizinnobelpreis für Lobotomie. Ernsthaft? Nobelpreis für eine Methode Menschen in geistige Brötchen zu verwandeln? Das hätte man damals schon ausschließen müssen. Und noch so einige andere zweifelhafte Preisverleihungen.
Für ein Gehirnchip stehen schon die ersten Menschen freiwillig bei Neuralink in der Schlange.
Da sagt ich mal viel Spaß, bei der kultisch-rituellen Handlung durch Trepanation. Früher wollten Die ihren Göttern näher sein, heute wollen Die nur ins Internet.
Generell ist nichts dagegen einzuwenden, nach der Erkenntnissicherheit „exakter Wissenschaften“ zu streben. Aber immer, wenn man eine Methodik überträgt oder übernimmt, muss das „salva veritate“ erfolgen, die Bereiche müssen Isomorphie- oder Homomorphiebedingungen genügen.
Aber die Grundvoraussetzung der Wirtschafts“wissenschaft“ ist bereits an der Wurzel faul, nämlich am Gleichgewichtspostulat. Es wird, und so werden dann auch die mathematischen Modelle konstruiert, von dem Ergodizitätspostulat ausgegangen, das besagt, dass Prozesse (Marktprozesse) schar- und zeitinvariant zum Gleichgewicht streben.
Ergodizität ist in der Physik präsent in der Mechanik idealer Gase, ähnlich in vielen anderen Bereichen bis in die Quantenmechanik, und auch in der statistischen Probabilistik. Es ist für das statistische Ergebnis egal, ob ein idealer Würfel eine Million mal, oder eine Million idealer Würfel einmal geworfen sind.
Die „neoklassische“ Wirtschafts“wissenschaft“ übernimmt diese Voraussetzung ungeprüft, sie ist eines der Dogmen dieser Religion. In der wirklichen Wirtschaftsgesellschaft ist das Stuss. Ökonomische Prozesse sind Ungleichsgewichtsprozesse, sie tendieren zu Hierarchisierung, zu sich zuspitzenden Ungleichgewichten und Krisen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hatten die bürgerlichen Ökonomen keine Krisenerklärung, bis sie auf das etwas dümmliche Modell des „Schweinezyklus“ kamen.
Eine Reihe der in der Tabelle behaupteten mechanischen Zusammenhänge sind einfach falsch. Das zb Energie nicht Kraft mal Raum ist sollte jeder Realschulabsolvent wissen. Hätte man, @Patrick Kaczmarczyk ruhig mal gegenchecken können, bevor man Copy & Paste klickt. Im übrigen orientiert sich die Neoklassik nicht an komplexer Mechanik, sondern lediglich an den absoluten basics der newtonschen Mechanik. Komplexere Rechenmodelle würden eventuell eine realistischere Betrachtung der Realität ermöglichen und sind deshalb aus Sicht der Ideologen strikt abzulehnen.
Und damit zeigt sich das ganze Elend der Pseudowissenschaft, zu der die Ökonomie verkommen ist. Diese Leute lieben es mit Formeln zu klotzen weil Formeln in ihren Augen = Wissenschaft ist. Dabei bewegen sich sämtliche verwendeten Formeln auf Unterstufenniveau – weil der Großteil der Studenten sonst keine Chance hätte, ein Studium zu beenden. Ökonomie ist heute eine ideologische Kaderschmiede. Wer brav nachplappert, was ihm vorgekaut wird, beweist, dass er für Verwaltungsaufgaben geeignet ist, bei denen eigenständiges Denken nur hinderlich wäre.
Egal ob marxistische oder bürgerliche Ökonomie (zb Schumpeter), der Stand der Wissenschaft war schon erheblich höher. Selbst Klassiker wie Adam Smith (auf die man sich beruft) werden nicht im Original gelesen, sondern nur in ideologisch aufbereiteter Sekundärliteratur.