
Ulrike Guérots „Zeitenwenden“ – ein Auf- und Abriss.
„Ich habe nicht mehr viel zu verlieren“, kündet uns Ulrike Guérot in ihren „Skizzen zur geistigen Situation der Gegenwart“ freimütig an und liefert uns die Abrechnung mit der „extremisierten Mitte“ in einem maliziösen Spaziergang durch die „Zeitenwenden“ gleich mit: Abschied von dieser Art Demokratie, Abschied von der Vernunft, Abschied von dieser Art Europa.
Von Plato bis Sartre, von Kant bis Winkler bedient sie in wechselnden Bildern den Reißwolf, um die Fassade der „simulativen Demokratie“ (Ingolfur Blühdorn) einzureißen, in der die „Polis“ (Aristoteles) der „Stasis“ (Giorgio Agamben) gewichen ist, einer „gestockten Gesellschaft“, die nicht mehr zu Kompromissen fähig ist, sondern in der Sehnsucht nach Eindeutigkeit, erstarrt in „political correctness“, die res publica strukturell reformunfähig macht: „form follows function“ vice versa „function follows form“. Eine Gesellschaft, in der dem Menschen in der Pandemie das Klopapier zu kaufen empfohlen, gleichzeitig dem Bürger die Grundrechte gestohlen wurden. Sie folgert: „Je unbestimmter die Rechtsbegriffe, desto autoritärer das System.“
Bürger als gärende Hefe im System
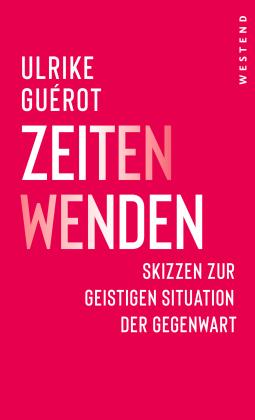
Sie geißelt das Versagen des Staates, das Denken in Geiselhaft zu nehmen: „Demokratie ist eine permanente Revolte“ – kein Zustand, sondern ein Prozess. Die Ausgeburten der Bildungs-, Sprach- und Denkarmut seien mittlerweile in Amt und Würden ins „Zeitalter der Geistlosigkeit“ aufgestiegen – allein dies sei keine Zeitenwende mehr, sondern ein „Epochenbruch“, in der die KI als Höchststufe geliehenen Verstandes, nicht aber mehr als Vernunft agiert. Unterstützt – „follow the science“ – durch eine Wissenschaft, die sich mit ihrer zuwachsenden Drittmittelfinanzierung zum gemieteten „Wahrsager“ macht – aus Lehrstühlen werden Leerstühle.
Angelehnt an ihre Schrift „Endspiel Europa“ sucht sie nach einer angemessenen Identität Europas, gewachsen aus der Vielfalt ihrer Herkünfte, Sprachen und Kulturen, die sich in der „pax americana“ – der Einheit von EU und NATO – nicht bewahren lässt, sondern politisch im „american way of life“ verkommt. Sie fordert ein neues Denken wie eine neue Ordnung, die sie in einer Neutralität Europas – ohne NATO – als Friedensprojekt findet, das föderal, regional, sozial und friedlich „in vielem eins“ ist. Dieses Ziel ist, so findet sie, politisch nicht mit den imperialen Zielen der USA/NATO, wohl aber mit einem in die Sicherheitsstruktur Europas eingebunden Russland zu erreichen. Auch wirtschaftlich sind diese Ziele wegen des gegenwärtigen Raubtierkapitalismus unerreichbar, der sich die Politik als Sklavin hält.
Wer sich an die Deutung der „Zeitenwende“ als Verschlüsselung einer Kriegslüsternheit wagt und sich politisch daran stößt, dass die Lüge von gestern nicht mit der Wahrheit von heute entlarvt, sondern mit der Lüge von morgen verschleiert wird, findet in den Skizzen von Ulrike Guérot ausreichend Nahrung und Sichtung. Sie begibt sich mutig und unerschrocken an die Klärung substanzieller Begrifflichkeiten wie Demokratie und Liberalismus und deren Verbrämung im „wehrhaften Staat“, in dem die „Volksvertreter“ von gestern mit der Regierungsbildung merklich zu „Staatsvertretern“ werden, die den Souverän als Gegner erfahren, der sich der politischen Korrektheit entzieht. Sie fordert, den Bürger nicht weiter zu entmündigen, sondern als gärende Hefe im System eines demokratischen Prozesses wieder zu entdecken, um die Risse in der Gesellschaft zu kitten und jene Demokratie zu wagen, in der die Freiheit gegen die Angst verteidigt wird.



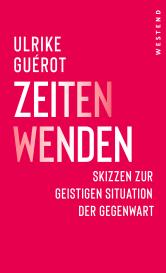
Frau Guérot „rechnet ab“. Mit dem eigenen Leben bis 2020. Eine Art „Selbstreflexion“ also.
Du geiferst wie ein Feuer in der Wüste. Die Sonne macht Dich unsichtbar.
Was wäre daran – Reflexion des eigenen Lebens – so schlimm? Ist Gegenstand (oder zumindest Aufhänger) einiger der größten literarischen und philosophischen Werke. Im übrigen kann man Frau Guérot nicht vorwerfen, dass sie ihre Herkunft aus dem Establishment verberge – damit kokettiert sie ja vielmehr selber dauernd.
Unabhängig von der Personalie Guérot ist es durchaus aufschlussreich, mit was für staatstragenden Biographien man es heute zum sanktionierten Dissidenten bringen kann – das ist durchaus ein Indikator für den Wandel, den die Republik (und Europa) durchlaufen haben. Man sollte es Leuten wie Guérot (oder selbst Varwick) nicht als Makel anrechnen, dass sie früher keine Dissidenten waren. Es ehrt sie, dass sie trotz ihrer Vorgeschichte heute welche sind. Und dass jemand wie Guérot Kasse machen muss, ist ja wohl auch nachvollziehbar.
Von irgend etwas muss sie ja leben…
Nichts gegen einzuwenden…
Schließlich ist ihre Systemkritik vollkommen berechtigt und Aufklärung tut not!
Viel mehr kann man sagen, dass sie irgendwo eine Grenze gezogen hat und sich hat nicht weiter billig hat kaufen lassen! Und das rechne ich ihr wirklich hoch an.
Die „Stasis“, das Bild von einer „gestockten Gesellschaft“ bringt es auf den Punkt: geistige Erstarrung, intellektuelle Apathie und politische Ausweglosigkeit.
Karl Marx hätte an dem Buch seine Freude gehabt. Das Bürgerlich-Idealistische in Reinform, das hätte ihm die Grundlage für eine beißende Satire geliefert. Da kommt ein Aristoteles, ein Agamben, dann solche, die der Stasis verfallen sind und die political correctness. Und der american way of life. Wenn die nur anders wären, würde es besser.
Nö, sagt Marx. Das, was hier geschieht, ist eine Notwendigkeit innerhalb des kapitalistischen Verwertungssystems. Deshalb wird das gemacht.
Das Buch ist für mich ein Beleg dafür, wie sehr man sich verirren kann, wenn man den Marx unbedigt draußen haben will.
Scheisse, wie Du wiedermal Recht hast.
Ich beziehe mich hier aber ausschließlich auf diesen Kommentar von Dir.