
Nach dem UN-Drogenbericht zum „Weltdrogentag“ steht Cannabis auf Platz 1, Alkohol und Tabak werden nicht einbezogen. Über Merkwürdigkeiten des Umgangs mit Drogen.
Am „Weltdrogentag“, dem 26. Juni, veröffentlichte das Büro für Drogen und Kriminalität der Vereinten Nationen seinen neuesten Drogenreport. Demnach haben im Jahr 2023 – ohne Alkohol und Tabak – mit 316 Millionen Menschen mehr denn je Drogen konsumiert. Das sagt schon sehr viel über die fragliche Effektivität der nach wie vor von konservativen Parteien befürworteten Verbotspolitik aus.
Nähme man die beiden bei uns traditionell eher als Genussmittel bekannten Substanzen Alkohol und Tabak dazu, käme man auf mehrere Milliarden. Darüber schweigt der Drogenreport aber. Darin äußert sich eine westliche Sichtweise auf das Problem, denn in islamisch geprägten Kulturen sieht man Alkohol wegen des im Koran erwähnten Verbots des Konsums vergorener Trauben kritischer. Doch auch hier gab es zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten mehr oder weniger strenge Interpretationen.
Willkürliche Grenzziehung
Aus biochemischer Sicht ist diese Grenzziehung aber willkürlich. Als „Droge“ könnte man hier am ehesten diejenigen Substanzen auffassen, die durch die Blut-Gehirn-Schranke gelangen, die Aktivität der Hirn-Botenstoffe verändern und so zu bestimmten Veränderungen im Erleben und Verhalten der Konsumierenden führen.
In der gesellschaftlichen Praxis sieht man es pragmatisch: Für die Medizin sind diejenigen psychoaktiven Substanzen Drogen, die die Menschen ohne Rezept beziehungsweise nicht über die etablierten pharmakologischen Wege beziehen. Und für Juristen und die Behörden ist die Aufnahme der Substanzen auf eine Drogenliste, in Deutschland im Wesentlichen die Anlage zum Betäubungsmittelgesetz (BtMG), entscheidend.
Das führt zu der merkwürdigen Konsequenz, dass ein und dasselbe Molekül mal Lifestyle- oder Genussmittel, mal Medikament und mal verbotene Droge sein kann. Wenn zum Beispiel jemand Amphetamin („Speed“) auf Rezept zur Behandlung von ADHS-Symptomen erhält, ist das rechtlich ein Medikament; besorgt sich dieselbe Person aber vielleicht sogar aus denselben Gründen genau dieselbe Substanz, dann ist es rechtlich eine Droge und kann der Besitz bestraft werden.
Straftat ohne Opfer
Nach § 29 Abs. 1 Nr. 3 BtMG ist das eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Das ist dasselbe Strafmaß wie für eine Körperverletzung (§ 223 StGB). Doch während man bei Letzterer tatsächlich jemandem schadet, bezeichnen Kritiker zumindest die einfachen Drogendelikte mitunter als „Straftat ohne Opfer“.
Darauf erwidert man, dass vielleicht nicht jeder Drogenkonsum unmittelbar zu einem körperlichen, psychischen oder gesellschaftlichen Schaden führt, doch wenigstens das Risiko hierfür erhöhe. Dass das aber auch für die nicht verbotenen Substanzen gilt und sogar für viele „normale“ Freizeitaktivitäten wie Autofahren, Sonnenbaden oder Sport, darüber sieht man hinweg.
Was ich damit sagen will: Wenn wir über Drogenpolitik reden, schauen wir immer durch eine bestimmte gesellschaftlich geprägte Brille auf das Problem. Das fängt schon beim Begriff der Droge selbst an. Im Endeffekt läuft es auf die Logik hinaus, dass bestimmte Substanzen verboten sind, eben weil sie auf einer Verbotsliste stehen; und dass sie auf der Verbotsliste stehen, eben weil bestimmte, einflussreiche Gruppierungen sie daraufgesetzt haben.
Man könnte es auch so sagen: Drogen sind genau dann verboten, wenn und weil sie verboten sind.
Die Durchsetzung dieser „Logik“ lassen sich moderne Rechtsstaaten, deren Vorläufer noch bis ins frühe 20. Jahrhundert als Kolonialmächte selbst die größten Drogendealer waren, heute Milliarden kosten. Und wie erfolgreich das ist, darüber gibt zum Beispiel der Weltdrogenreport der Vereinten Nationen jährlich Aufschluss.
Rangliste der Drogen
Die vorangegangenen Ausführungen sollen uns daran erinnern, dass bei diesem Thema traditionelle, machtpolitische und moralische Fragen durcheinandergehen. Zu anderen Zeiten und an anderen Orten dachte man anders über Drogen – oder hatte man vielleicht noch nicht einmal einen besonderen Begriff davon. Ob das bessere oder schlechtere Zeiten und Orte waren, ist ein interessantes Forschungsgebiet.
Doch der Drogenreport handelt von der Realität, in der wir heute leben. Und demnach stand Cannabis in dem erhobenen Jahr 2023 mit 244 Millionen Konsumierenden auf Platz 1. Danach folgten Opioide (61 Millionen), Amphetamine (31 Millionen), Kokain (25 Millionen) und Ecstasy (21 Millionen).
Das wird mit der Meldung flankiert, dass im selben Jahr auch von den Polizeibehörden mehr Amphetamin und Methamphetamin denn je beschlagnahmt wurde. Ob das auf bessere Polizeiarbeit, mehr Schmuggel oder beides zurückgeht, lässt sich nicht genau sagen. Denn aufgrund der Verbote findet der Handel ja im Dunkelfeld statt.
Teure Konsequenzen
Das Büro für Drogen und Kriminalität der Vereinten Nationen weist auch auf die teuren Folgen des Problems hin: So habe 2023 nur eine von zwölf Personen mit problematischem Substanzkonsum dafür eine Behandlung erhalten. Und sowohl bei der Herstellung als auch der Bekämpfung von Drogen könne es zur Verschmutzung oder gar Zerstörung der Natur kommen.
Wenn man schon Drogenkrimineller ist, braucht man den Umweltschutz auch nicht mehr ernst zu nehmen. Und bei Razzien werden die Plantagen in der Regel zerstört, mit Kollateralschäden für Flora und Fauna. Das gilt natürlich nur für Drogen wie Kokain oder Opiate (z.B. Diamorphin/Heroin, Dihydrohydroxycodeinon/Oxycodon), die nicht vollständig synthetisch im Labor hergestellt werden. Bei Letzteren fallen aber chemische Abfälle an, die man dann oft illegal irgendwo verbuddelt oder einfach liegenlässt.
Dabei sind, wohlgemerkt, die Kosten für die Aufrechterhaltung der Verbotspolitik noch nicht einmal eingerechnet: Man denke an die Finanzierung der Polizeiarbeit und Justiz, die für die Gesellschaft und Individuen verlorene Produktivität durch Gefängnisstrafen, die Kosten für die Gefängnisse und so weiter.
Dieser ganze Apparat war, jedenfalls im heutigen Ausmaß, in der Menschheitsgeschichte lange Zeit unbekannt. Es handelt sich um eine gesellschaftliche „Innovation“ vor allem auf Betreiben religiös-fanatischer Politiker der USA. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Verbotspolitik über den Völkerbund und dann die Vereinten Nationen international durchgesetzt.
Vervielfältigung von Problemen
Wenn man meint, nicht schon genug gesellschaftliche Probleme zu haben, dann kann man sie politisch vervielfältigen. Mit der geschürten Angst – sowohl vor den Konsumierenden als auch den kriminellen Organisationen – kann man im Wahlkampf auf Stimmenfang gehen.
Dass das bis heute gilt, sah man zuletzt bei der Entkriminalisierung von Cannabis im letzten Jahr. Dafür scheuten manche Unionspolitiker nicht einmal vorm Rechtsbruch zurück: Man erinnere sich zum Beispiel an die historische Abstimmung im Bundesrat vom 22. März 2024, bei der Ministerpräsident Michael Kretschmers Verhalten zur Disqualifikation seines Bundeslands führte.
Man wollte die Welt oder jedenfalls Deutschland retten. Der Versuch scheiterte, insbesondere dank der Standhaftigkeit von Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Und trotzdem ist das Land nicht untergegangen. Jedenfalls nicht wegen des Cannabiskonsums.
Dabei finden die Jugendlichen, deren Schutz einem (angeblich) am meisten am Herzen liegt, Cannabis zunehmend langweilig. Auch das zeigt der neue Drogenbericht der Vereinten Nationen, wonach von den späten 1990ern bis zur Coronapandemie konstant um die 15 bis 17 Prozent der 15- und 16-Jährigen Cannabis zumindest schon einmal probiert hatten. Das fiel in den letzten Jahren auf 12 bis 13 Prozent.
Und laut der Frankfurter Drogentrendstudie hatten 2015 noch 34 Prozent der 15- bis 18-Jährigen immerhin im letzten Monat Cannabis konsumiert. 2024 waren es nur noch die Hälfte, nämlich genau 17 Prozent. Auch Drogenkonsum kennt seine Moden, die sich nicht zwingend an die Logik der Drogenpolitiker hält.
Paradoxien
Die ist sowieso äußerst flexibel. Wo man vor der letzten Bundestagswahl noch vollmundig ankündigte, Cannabis sofort wieder verbieten zu wollen, weil Gesundheitsschutz und so, steht das Vorhaben nun nicht einmal im Koalitionsvertrag. Man will nun erst einmal die Evaluationen abwarten.
Und was die Verbote nutzen sollen, wenn die Leute im Endeffekt doch das konsumieren, was sie wollen, darauf gibt man nie eine Antwort. Wie gesagt: Drogen sind genau dann verboten, wenn und weil sie verboten sind. Noch Fragen?
Paradoxerweise lassen sich nicht einmal Justizvollzugsanstalten drogenfrei halten. Im Gegenteil werden die Mittel dann zu einer Ersatzwährung. In US-Gefängnissen, in denen sogar Zigaretten verboten sind, fängt das mit einem Häufchen in Toilettenpapier gewickelten Tabak an. Und manch ein Wärter verdient mit dem Schmuggel ein paar Hundert Dollar pro Woche nebenbei. Steuerfrei, versteht sich.
Paradoxerweise waren – daran soll hier noch einmal erinnert werden – die im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend dämonisierten und als Geißel der Menschheit dargestellten Substanzen wie Opium, Morphium, Kokain und sogar das angeblich Übelste aller Üblen, Heroin, medizinisch für lange Zeit so angesehene wie wichtige Stoffe.
Und obwohl Diamorphin/Heroin so übel sein soll, hat man mir nach meiner Gallenblasenoperation 2018 das vielfach stärkere Oxycodon, das auf demselben Mechanismus beruht, einfach so gespritzt. Einfach so, ohne mich zu fragen. Ihnen vielleicht auch schon einmal. Und Sie haben sich wahrscheinlich nichts weiter dabei gedacht, weil man es ein „Schmerzmittel“ nannte und Sie sich damit gut fühlten.
Ja, Wörter haben eine besondere Macht: Besonders ärztliche Worte machen aus bösen Drogen gute Medikamente.
Motive, Nutzen, Zwang
Trotz alledem überbietet man sich in Diskussionen zum Thema üblicherweise mit Angaben über mögliche Risiken und Schäden. Über die Motive und den Nutzen des Substanzkonsums verliert man aber kein Wort. Das sah man jüngst wieder beim Tagesschau-Bericht „Zahl der Drogenkonsumenten auf Rekordhoch“ zum neuen Drogenreport am 26. Juni.
Man muss kein Einstein sein, um die Antwort auf die Frage nach dem Warum zu beantworten: Menschen nehmen psychoaktive Substanzen in der Regel, weil ihnen die Auswirkungen auf ihr Erleben und Verhalten gefallen; weil, mit anderen Worten, psychoaktive Substanzen Instrumente zum Erreichen bestimmter Zustände sind.
Das kippt natürlich an dem Punkt um, wo die freiwillige Entscheidung zum Zwang wird. Dann wird aus der Suche nach einem psychischen Zustand, der einem besser gefällt, die Flucht vor einem, den man nicht ertragen kann. Anders als oft angenommen steckt in der „Sucht“ nicht nur das Siechen, also Krankheit, sondern durchaus auch das zwanghafte, das die eigene Kontrolle übersteigende Suchen nach etwas. (Sprachliebhaber mögen sich die zahlreichen im Wörterbuch auf „-sucht“ endenden Substantive anschauen – und staunen.)
Nach dieser Darstellung des Status quo beschäftigen wir uns im zweiten Teil des Artikels mit den gesellschaftlichen und drogenpolitischen Konsequenzen.
Der Artikel wurde zuerst auf dem Blog „Menschen-Bilder“ des Autors veröffentlicht.
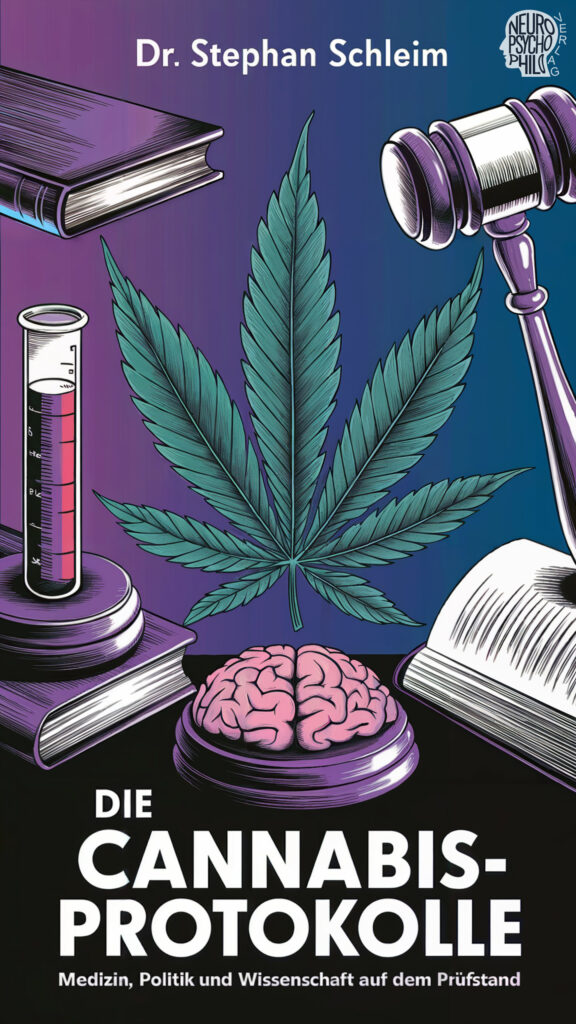
Erfahren Sie mehr über die Cannabis-Gesetzgebung sowie wichtige Grundlagen: Was ist eine Droge? Was ist Abhängigkeit? Seit wann gibt es Cannabiskonsum in der Menschheitsgeschichte? Und was sind sein Nutzen und seine Risiken? Das neue Buch von Stephan Schleim gibt es als eBook für nur 9,99 Euro bei Amazon, Apple Books und Google Play Books.
Ähnliche Beiträge:
- Über Nutzen und Risiken von Cannabis-Produkten
- Entkriminalisierung des Drogenkonsums
- Cannabis: Es spricht viel gegen die These von der Einstiegsdroge
- »Eine Gesellschaft auf Kokain, in der wir endlose Wirtschaftskriege führen, wünsche ich mir nicht«
- Das Win-Win der Cannabis-Legalisierung




ach, Lottchen du Gottchen, das allerschlimmste Cannabis mal wieder…Mann, oh, Mann, wie oft ist diese müde Sau schon durchs Dorf getrieben worden…Ablenkung von den wahren und ernsthaftesten Problemen heutzutage, Völkermord, Mafia Herrschaft etc. oder was sonst?
Viele dieser wirklichen Probleme werden durch Drogengeld finanziert.
Zwei Fliegen mit einem Streich?
Cannabis ist wie grüner Strom ein rotes Tuch für viele Unions-Politiker.
Trassen für Atomstrom – ja bitte, das steht für Fortschritt und Macht.
Trassen für grünen Strom – bitte unterirdisch, dass der Siegeszug wenigstens optisch begraben ist.
Schnaps und Bier – deutscher Kult.
Cannabis – Hippies in den Knast.
Ich kenne Leute, die Kiffen schon seit über 60 Jahren, jeden Tag und die sind fast normal… 😉
Mama, gib ihm die Möhrchen
Ich geh auf die 60 zu und überlege, ob ich nicht doch mal kiffe.
Dieses Land ist, mehr denn je, nur noch mit Drogen zu ertragen
Was wäre der mensch ohne Drogen?
Autonomer: Viele jedenfalls noch am leben! Ich wurde mit knapp 18 schon mit
dem Tod einiger meiner Freunde und Bekannten durch Drogen konfrontiert.
Ich habe miterleben müssen, wie sich deren Körper immer mehr zersetzten.
Das ist kein Spass. Dealer sind für mich Mörder!!
Es kommt auf die Drogen an,
Da sollte man schon ein wenig differenzieren. 😉
@Träumer: Allein 2021 sind z.B. in Deutschland mehr als 47.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums gestorben. Sind Alkoholproduzenten (Brauereien etc.) deshalb für Sie auch Mörder?? Oder die Tabakproduzenten etc.?
Oder geht’s mal wieder um die von Herrn Schleim völlig zu Recht kritisierte willkürliche Unterscheidung zwischen „guten“ (legalen) und „bösen“ (illegalen) Drogen, deren fatale Wirkung Sie zu erkennen nicht in der Lage sind, ohne dass ich damit den Tod ihrer Freunde in irgendeiner Weise relativieren will.
Aber da diese offensichtlich Opfer „böser“ Drogen geworden sind, stellt sich doch dringlichst die Frage, ob diese Menschen nicht trotz, sondern insbesondere wegen der Illegalität der von ihnen konsumierten Substanzen gestorben sind.
Kenn ich sehr gut….
Man sollte aber auch darauf hinweisen, daß durch das Verbot Fälschungen und wahnwitzige Mischungen provoziert werden weil jede Qualitätskontolle entfällt. DAS plus falsche Dosierung sind die häufigsten Ursachen für den Verfall.
Ich kenne genug Leute die jahrelang bzw quasi lebenslang von Gras bis Heroin konsumieren und genug Geld haben um sich gute Qualität zu gönnen und gesund sind und arbeiten.
Nicht die Droge ist das Hauptproblem sondern der blinde Krieg gegen Drogen!
@Faber: „Nicht die Droge ist das Hauptproblem sondern der blinde Krieg gegen Drogen!“
👍👍👍
So normal wie Sie?
Naja, wenn die Birne weg gedröhnt ist wird man sich selbst als Irrer normal finden. Wenn man sich schon tudröhnen muss wozu dann auch noch die Drogenmafia finanzieren wo doch die heimische Natur soviel mehr Möglichkeiten bietet und das auch noch kostenlos.
Wer mit der bösen Drogenmafia argumentiert, sollte eigentlich für Legalisierung sein, dann ist die nämlich weg.
Yuval Noah Harari zu der Frage, was man denn mit den überflüssigen (durch Roboter und KI) gewordenen Menschen anfangen soll: „Drogen und Computerspiele“. Ganz verkommene würden vielleicht noch eine Biowaffe konstruieren, die möglichst unauffällig die Menschen reduziert. Es gab mal einen Film (war es Akte-X?), da war die Biowaffe als Impfung getarnt..
Nette Ideen.
Also sind wir mit den Drogen auf gutem Wege. Und sonst auch.
Für die Meisten von uns ist das sicher keine schlechte Lösung, was der gute Harari da propagiert.
Die Impfung hat immerhin bisher schon mal 20 Millionen Menschenleben gekostet.
Das ist doch gar nicht sooo schlecht für den Anfang!
20 Millionen bloß? Wie lange soll denn das dauern?
Die Oligarchen investieren ganz munter in Impfstoffabriken.
Nach der Pandemie ist vor der Pandemie.
Die WHO schätzt (!) die Zahl der Corona-Toten auf 20 Millionen (der WHO traust du doch sonst auch nicht), statista schätzt auf 7 Millionen.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1102667/umfrage/erkrankungs-und-todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland/
Es werden erheblich weniger als 20 Millionen sein.
70-80% der Toten waren über 80 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen.
Deswegen nochmals meine Frage: Wie lange soll das dauern?
Und in diesem Zusammenhang nicht unbedeutend die Frage: Wie schützen sich Milliardäre und dessen Familie und Freunde vor einem tödlichen Virus? Oder gibt’s neuerdings Viren, die um sehr reiche Menschen einen Bogen machen?
Statista, eine meiner Damen hat für die mal gearbeitet…lächel
Es wird doch schon lange an Krankheiten gebastelt, die nur bestimmte Ethnien befallen,
Ich rede auch nicht von Coronatoten, sondern von Impftoten.
Keiner weiß, wieviele Coronatotees gab.
Wie lange soll was dauern?
Wenn du dich jetzt schon dumm stellst, können wir das Gespräch als nutzlos beenden.
Versteh ich nich…???
Die Verspikung oder was?
Ich bezog mich ja auch nicht auf die WHO. und ich meinte eben auch nur Impftote von daher es ebenfalls nur Schätzungen gibt.
Sind Sie Unterhaltungsdamen Manager, oder wie soll ich Ihre Bemerkung einschätzen. Nur mal neugierig ob Ihre Damen Sie wirklich mit verlässlichen Informationen versorgen können? :))
Im allgemeinen schon, da ich meist Damen links wie rechts, als es das noch gab, entweder der herrschenden Klasse oder in gut ausgewählten Positionen bevorzuge.
Woher haben Sie diese Zahl? Ich weiß die Impfung war nicht ohne Nebenwirkungen, davon kann ich selbst ein Lied singen, Verdacht von mir 6 Monate nach der dritten Impfung wurde ich mit Prostata Krebs diagnostiziert, Zufall oder nicht, bin aber auch schon 75, also Prostataprobleme in meinem Alter nicht ungewöhnlich, aber 20 Millionen Tote wegen der Impfung bezweifle ich doch sehr…solche Leichenberge hätte man kaum verschleiern können?! Problem mit der Medizin ist immer noch die Unmöglichkeit einen unbestreitbaren Grund für eine Krankheit zu nageln…ist doch immer nur eine Korrelation feststellbar, mehr nicht..die Mediziner fummeln hier, sie fummeln da, aber nichts genaues wissen sie wohl alle nicht, sonst würden viele mehr Krankheiten geheilt.
Das war mal eine Schätzung, die ich bei Multipolar gelesen hatte.
Die errechnete sich aus der Übersterblichkeit der einzelnen Länder aufgrund der Überssterblichkeit durch die 2021 einsetzende Impfung.
Es sieht ja so aus als wäre das Virus die Biowaffe: https://multipolar-magazin.de/artikel/corona-biowaffe
Man hat nur keine Ahnung wer sie gebaut hat: Natürlich gibt es zwei Hauptverdächtige.
Wars der Ami, könnte es sein das Impfung wirkt: Aber erst in der nächsten Stufe.
Dann stünden die Schafe plötzlich alleine da: Die aufmüpfigen Impfverweigerer sind verschwunden.
Wars der Chinese: Dann Gnade uns Gott, oder Wer oder Was auch immer.
„dass bestimmte Substanzen verboten sind“
Bei dem von mir soeben entwickelten¹ LAVORIN mache ich mir keine Sorgen über ein Verbot, denn schon eine Kapsel² erzeugt (nach kurzer Euphorie) schwerste Arbeitssucht für mindestens eine (120 Stunden) Woche. Über die sonstigen, gelegentlichen Nebenwirkungen³ wollen wir den Laborkittel des Schweigens ausbreiten, so wie es Karligula befahl…
¹Und erfolgreich an anderen getesteten. Siehe auch Edward Jenner
²Bitte nur eine, sonst kann es beim Betteln um unbezahlte Überstunden zu peinlichen Szenen kommen
³Dass kann doch einen Junkie nicht erschüttern, keine Angst, keine Angst, Impfmarie!
Kokain tuts meistens auch, da kann man auch laufen ohne Grenzen, nun ja, nicht für immer, aber relativ lange schon:)) ach die Drogen, leider auch die vermeintlich besten keine ohne Nebenwirkungen und die sind meistens nicht yogurt sowieso:))
Ich hab mal versucht, Brokkoli zu rauchen. Das war vielleicht beschissen!
Die Blätter oder die Blüte?
Ich würde eine Umbenennung in Robotrin vorschlagen.
Danke @ Stephan Schleim für diesen Beitrag und einige der darin enthaltende Beobachtungen, obgleich sie für langjährige Mitleser etwas repetitiv sind. Noch ein paar ergänzende Groschen:
„Interpretationen“ – interessante Umschreibung für „Besäufnisse“. Merke ich mir, Herr Schleim. „Lass am Wochenende mal wieder einen
hebeninterpretieren gehen!“ Ich werde es dem trinkaffinen Bekanntenkreis vorschlagen.Nun mal ein Fallbeispiel. Der pöse Iran. Man hat ja als Forist hier auch einen Bildungsauftrag und ich bin ja schließlich auch Don Quixote van Trivia Fellow am Chair of Obscure Erudition der Nexus University for Applied Oddities in Strunzenöd. Also, zunächst einführend:
Das ist, notgedrungen, aus Westipedia, weil die gescheiten Aufsätze hinter Bezahlschranken stehen oder die interessanten Bücher in irgendwelchen Bibliotheken vor sich hin stauben.
Hier noch ein Link zum Thema (Qualität des Scans: naja).
Moneyquotes:
Oder:
Oder:
Dann:
Bevor jetzt wer ankommt – ja, seit der Iranischen Revolution 1978 f. ist der Weinbau geplättet und Alkoholkonsum verboten worden. Zwischenstand? Erfolge? Nun ja:
Quelle: hier
Und im Westen halten sich Leute für „hart drauf“, weil sie mal am Standard-Whisky nuckeln…
Davon abgesehen erscheint mir jenes post-1979-Verbot nicht als Ausdruck irgendeiner „islamischen Kultur“ – sondern als eines des antikolonialen Kampfes. Genauso wie bestimmte Kleidungsverbote / -gebote, Kampf gegen Pornografie und diese und jene westlichen Produkte. Kein Schmarrn! Alkohol-, Pornografie- etc. werden heute zuvorderst als westliche Güter identifiziert, auf die man – anders als vielleicht bei Maschinen oder High Tech – einfach verzichten kann. Die gelten vornehmlich (und auch nicht ganz zu Unrecht) als Ausdruck westlicher Dekadenz und kultureller Dominanz sowie als moralisch verwerflich. Auf diesem Feld stießen daher westlicher Imperialismus und iranischer Nationalismus zusammen und die Revolutionäre von 1978 f. versuchten so ihre (neue) Nationalidentität und ihre nationalstaatliche Unabhängigkeit unter anderem über den Ausschluss jener Güter und somit das Zurückdrängen von westlicher Imperialkultur zu rechtfertigen. Selbstverständlich ging es dabei auch um Konsolidierung / Erhalt der (neu gewonnenen) Macht und die Kontrolle des öffentlichen und privaten Lebens; letzteres nicht nur aus anti-kolonialen, sondern sicherlich auch aus anderen (u.a. religiösen) Motiven. Doch gerade der Fortbestand des äußern Drucks, zwang diese neue Regierung ständig – bis heute – dazu ihre Legitimität und Kontrolle im Innern sichern zu müssen. Was oft eben durch kulturelle, nationalistische und religiöse Akte geschieht. Und gerade der religiöse Überbau ist ein prima Mobilisierungsinstrument, um die Bevölkerung hinter der Regierung zu vereinen, insbesondere in Kriegs- und Krisenzeiten.
Wobei die iranische Nationalidentität aber ein zentraler Punkt bleibt. Der Iran ist ein extrem stolzes Land, mit sehr langer kultureller Tradition, die weit über den Islam hinausreicht; einschließlich der persischen Dichtkunst, die Wein und Erotik in diversen islamischen wie nichtislamischen Epochen wiederholt glorifiziert hat. Die Revolutionäre von 1979 und die sich in der Folgezeit – auch dank westlicher Schützenhilfe gegen linke Gruppen – etablierende Theodemokratie haben jedoch eine sehr selektive und spezifische Auslegung des (schiitisch-iranischen) Islam genutzt, um eine redesignte Nationalidentität zu konstruieren, die sich gerade durch ihre Abgrenzung von westlichen und US-amerikanischen Einflüssen definiert. Es sollte eine von jeglichem unterdrückenden Einfluss bereinigte Identität geschaffen werden, die sowohl schiitisch-islamisch als auch nationalistisch ist. Diese Purifikation machte es notwendig, Teile der eigenen kulturellen Vergangenheit auszublenden, umzuinterpretieren – oder in den Orkus zu gießen und schlicht abzuleugnen. Allein um eine kohärente „Abwehrfront“ gegen die äußere Bedrohung bilden zu können.
Was freilich alles andere als neu ist. Das ist schlicht eine (mögliche) Signatur von Identitätskonstruktionsprozessen in revolutionären und / oder antikolonialen Kontexten: Man bedient sich selektiv aus der Vergangenheit oder anderen Quellen, wenn es zur (neuen) Ideologie passt und verwirft oder reinterpretieret den Rest. Und die Ablehnung von als fremd oktroyiert empfundenen Einflüssen ist auch keine iranische Eigentümlichkeit, sondern ebenfalls ein bekanntes Phänomen von Gesellschaften der Peripherie, wo sich lokale Identitäten durch Abgrenzung von westlichen (und sonstigen) Einflüssen zu stärken versuchen. In der Türkei zeigte sich das übrigens das ganze 19. Jahrhundert hindurch im Aufbegehren gegen bestimmte Westkleidung und sonstige Moden sowie in der bis heute anhaltenden Spannung zwischen „Modernisierung“ und „Bewahrung von (lokaler) Identität“ oder zeitgenössischen Anschlussversuchen an den (Pan-)Turanismus. Das so ziemlich prominentes Beispiel ist der Fes-Streit, denn der Fes ist – man höre und staune – alles andere als eine türkische Erfindung (wie man vom Namen her sich freilich schon denken könnte):
Der Fes wurde dann von Atatürk verboten. Und ich warte derweil noch immer auf eine Fatwa von Khamenei, die iranische Pornos oder zumindest den Konsum von Schiras-Wein religiös billigt…
Man mag diesen (Kultur)Kampf ablehnen, ihn für bescheuert erachten und darauf verweisen, dass hier das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, zumal gerade der Iran eben eine sehr lange und auch sehr islamisch-spezifische Erotikdichtung und Weinproduktion / -konsumption hatte. Aber man sollte hier einfach den (anti-kolonialen) Kontext kennen, in dem und warum das stattfindet. Und sich erinnern, dass nach dem Scheitern des Imperialprojekts „Vietnam“ eine Menge der dortigen westlichen Berater, NGOs und sonstigen nach Teheran übersiedelten, wo sie in den 1970ern die Segnungen westlicher Zivilisation in Gestalt von massenhaftem Genuss westlichen Alkohols, westlichen Porns, westlichem Films etc. auslebten. (Vielen Einheimischen gefiel das nicht ganz so gut, diese Barbaren.)
Da gibt es sicher noch einige andere, die eine Rolle spielen – persönliche, religiöse, ökonomische, kulturelle. All diese mag man unter „system- / gesellschaftlich geprägt“ subsumieren – aber sie haben doch ihre eigenen Features. Nicht nur die Gesellschaft prägt, auch die persönliche (Nicht-)Erfahrung trägt ihre Unzen bei.
Das ist Staatshandeln 101 – wie beim Fes und sonstigem. Und genau das ist das Problem.
Für mich ist der Staat keine legitime oder gar neutrale Instanz und schon gar keine, die irgendwie „berechtigt“ ist mal eben ex cathedra zu entscheiden, was ihre zufälligen Bewohner konsumieren oder anziehen oder mit ihrem Körper sonstwie anstellen dürfen. Der Staat sind nicht „wir alle“, der Staat ist geprägt, benutzt und dominiert von bestimmten Gruppen und deren Interessen, die sehr oft nicht mit denjenigen übereinstimmen, die unter ihren Entscheidungen zu leiden haben.
Verbotslisten sind darum nichts anderes als eine der üblichen etatistischen Machtdemonstration – willkürlich, krude begründet und oft bloß wirtschaftlichen oder politischen Interessen dienend. Sei es der Kontrolle bestimmter Gruppen oder der Bereicherung am (vorgeblichen) Schwarzmarkt.
Was Leute konsumieren, anziehen oder mit ihrem Körper anstellen, sollten die Leute selbst entscheiden, solange sie niemandem Dritten damit schaden. Verbotslisten dagegen sind paternalistisch, luzider Ausdruck von Willkür und Doppelstandards sowie eine Verletzung der persönlichen Autonomie.
Ich sehe nicht, wo da das Problem ist. Also die Betroffenen und die Umwelt schauen in die Röhre – aber die zählen ja nicht. Die Kosten des einen jedoch, sind die Einnahmen des anderen. Dieser ganze Apparat läuft in genau der Form, weil es eine Menge Leute gibt, die ein Interesse daran haben, dass er in genau der Form laufen soll. Und die davon profitieren. Ja, das mag jetzt wieder vielen (zu) zynisch klingen – aber leider ist es in meinen Augen einfach so. Wollte man die Zustände ändern, müsste man ans System ran. Und wer will das schon? Es läuft doch alles für zu viele sprichwörtlich wie geschmiert.
Ein kapitalistisch-imperialistisches System erzeugt qua seiner Struktur Umweltzerstörung, Ausbeutung und „soziale Probleme“. Der Drogenmarkt – ist auch nur ein Markt. Er reproduziert sich durch die Logik von Angebot und Nachfrage, gestützt durch die soziale Misere, die Konsumenten in die Abhängigkeit treibt – ob vom produzierten Gut oder von seinem Anbau. Und mit „soziale Misere“ meine ich nicht nur Armut, sondern auch Leistungsdruck und Hamsterrad. Das System ist ein Teufelskreis, der sich solange selbst erhält, wie die Leute mitspielen und seine Strukturen nicht überwinden wollen.
Und der „War on drugs“ – ist nicht minder ein Markt. Die Staatskasse, Polizeien, Waffenproduzenten, Gefängnisse – sie alle profitieren doch von der Kriminalisierung bestimmter Drogen. Man kann aus jedem Kriminalisierten, Drogenlaboranten und Inhaftierten Einnahmen generieren, „neue Produkte“ erproben oder für ihn Fördermittel zwecks „Resozialisierung“ abgreifen – was ein super Anreiz ist, hohe Inhaftierungsraten, militärische Bekämpfungsstrategien oder noch die lausigsten „Wiedereingliederungsmaßnahmen“ in aeterna aufrechtzuerhalten. Zumal einmal etablierte Institutionen wie die DEA (oder die EU) ein natürliches Eigeninteresse haben, ihre Existenz zu bewahren – selbst wenn sie völlig ineffektiv sind und mehr Schaden als Nutzen bringen. (Fun fact am Rande: Die USA haben mit ca. 650 Inhaftierten pro 100.000 Einwohner eine der höchsten Inhaftierungsraten weltweit, wovon ein erheblicher Anteil – Achtung, Trommelwirbel! – auf Drogendelikte entfällt).
Exakt. Und zwar bei egal welchem Thema. Dahinter stecken diverse Antriebskräfte, aber Profitstreben und Divide et Impera sind immer ganz vorne mit dabei.
„Drogen“ sind ein Thema, mit dem man die Leute immer wunderbar identitär verhetzen und aufeinander loslassen kann. Und Angstschüren ist sowieso eine super Methode – dieses System kennt einfach einen ganzen Supermarkt der Ängste: Drogen, Ausländer, Russen, Mullahs, Brexit, Viren, Klima, Schulden, Inflation, Kinäs, Kriminalität / Terror, Fleischkäs… jedes Jahr wird eine neue Angst durchs Dorf getrieben.
Diese Angstpolitik hilft hier so einfach wie natürlich die Klassenstruktur zu erhalten. Die herrschende Klasse und ihre angeschlossenen Medienhäuser verwandeln Phänomene in Ängste oder erschaffen diese gezielt, um die Leute gespalten und abgelenkt zu halten, während die eigentlichen Ursachen und Verursacher unangetastet bleiben. De la Boéties würde hier übrigens eine triviale Lösung offerieren – die kollektive Verweigerung gegen das System und seine Profiteure. Aber wer liest schon de la Boétie?
So wird es verkauft und es gibt in der Tat mehr als genügend identitäre Bürger – ob kaviarlinks-idenitär oder rechts-identitär – die dem auf dem Leim gehen.
Abgesehen von einigen Ottokatalog-Politikern und ihren persönlichen Motiven, geht es dem Rest wohl vor allem um den Erhalt der Geldmaschinerie.
Die sollen ja auch gar nicht „drogenfrei“ gehalten werden. Oder „handyfrei“. Oder sonst was. Viele Wärter machen doch Geschäfte damit beziehungsweise beim Geschäft mit!
Exakt.
Ja, absolut.
Womit Süchte übrigens ihrer Schwester, den Zwängen, ähneln. Wer vielleicht Freunde oder Verwandte hat, die unter Zwangserkrankungen leiden, sind die Ähnlichkeiten bekannt.
Der Unterschied ist doch eigentlich nur, dass Süchte häufig mit einer konkreten, positiven Belohnung verbunden sind, während es sich bei Zwängen eher um eine negative Belohnung, das Vermeidung von Unbehagen oder Angst, handelt. Aber gemein ist Ihnen doch das Element des Kontrollverlusts und des zwanghaften „Suchens“ nach Erleichterung bzw. die Zurückgewinnung jener verloren gegangenen Kontrolle. (Herr Schleim oder andere, die tiefer in dem Thema drin sind, mögen mich korrigieren.)
Es muss ALLES verboten werden, demnachst auch das Atmen und vor allem das Ausatmen, selbstverständlich wegen des CO2-Auysstosses und dem Klima.
Prima Klima in Deutschland wird es möglich machen
Danke. Ich kann hier nur kurz auf einen Aspekt Ihres Koreferats eingehen: Es mag in islamischen Ländern immer wieder „Inseln“ des Alkoholkonsums gegeben haben – und sowieso auch tolerante Phasen, in denen man Menschen ihre Religion (ggf. im Tausch für höhere Steuern) und Gewohnheiten ließ.
Dass die Sufis Wein tranken, ist mir bekannt; doch die wurden als Mystiker, wie auch in anderen Religionen, mitunter von der Mainstream-Religion verfolgt, weil sie eben mit „entdecke Gott“ oder „finde das Göttliche in dir“ quasi-ketzerische Ansichten vertraten. Auch der Sufi-Poet und Weinfreund Rumi war und ist mit seinen Liebesgedichten an Jungen und Männer ein komplexes Thema.
Für meinen Standpunkt im Text geht es nicht so sehr um die Geschichte, sondern den heutigen Zustand. In vielen islamischen Ländern haben heute eher radikale Interpretationen des Koran bzw. Islam die Oberhand – nicht selten übrigens in Reaktion auf westliche Kolonialspielchen. Und die verbieten Drogenkonsum und insbesondere Alkohol doch recht deutlich. Schauen Sie sich zur Not die Ländervergleiche zum Pro-Kopf-Konsum an.
@ Stephan Schleim
Danke für Ihre Rückmeldung!
Mein Kommentar war bloß als Ergänzung zu Nebenaspekten gedacht und eben als Beisteuerung von (mehr oder weniger) unnützem Wissen für interessierte Kreise. Für irgendwas müssen doch fünf Semester Osmanistik / Iranistik gut sein. Große oder irgendwelche Kritik war damit nicht angedacht.
In Anführungszeichen würde ich das wiederum in der Tat setzen, denn es sind doch eher größere Eilande, mitunter halbe Kontinente, gewesen. Sure 5, 90-91 verbietet zwar neben Glücksspiel und anderem auch den „Konsum berauschenden Tranks“, aber ich zitierte diese Passage gestern schon nicht ohne Hintergedanken:
Sure hin, Hadithe her – schon in der Frühzeit, etwa unter der Umayyaden-Dynastie (661–750), war / blieb Alkohol weit verbreitet, nicht nur unter den großen (Minderheiten)gruppen, sondern vor allem in städtischen Zentren (Stichwort: ḥānāt) und in verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen. Beileibe nicht nur bei Sufis, die damals ohnehin (und bestenfalls) eine Randgruppe waren. In der Abbasidenzeit wiederum finden wir einen Typen wie Abu Nuwas, seines Zeichens Poet und Begleiter des fünften Abbasidenkalifen Hārūn ar-Raschīd (dem aus Tausendundeiner Nacht):
Quelle: hier
Im Iran wiederum haben wir dann Jahrhunderte später die Safawiden-Dynastie mit Herrschern wie Schah Abbas I. und seinem blühenden Hofleben sowie vor Alkohol nur so strotzenden Festen. Da gibt’s auch schöne Reisebericht zu, die Islamwissenschaftsstudenten im Seminar sich zu Gemüte führendürfen. Westipedia mit Hinweisen:
Auch unter den Kadscharen (1789–1925) blieb Alkoholkonsum im Iran verbreitet, obwohl sogenannte religiöse „Reformbewegungen“ zunehmend Druck auszuüben begannen. Unter den Pahlavis gab es dann bekanntlich eine blühende Brauerei- und Weinindustrie. Die beobachtbaren Folgen habe ich oben genannt. Und wie gesagt wurde das, gerade diese Industrie, zum Ziel der Revolutionäre von 1978 f.
Da verweise ich abschließend einfach nochmals auf den Sammelband Wine Culture in Iran and Beyond von Fragner et al. (2014) hier.
Summa summarum: Konsumvorschriften zu bestimmten Gütern (Alkohol, Fleisch…) – im Islam, im Iran wie sonstwo – sind oft mit sozialer Klasse, Urbanität oder dem Faktor Minderheiten verbunden. Heutige Verbote spiegeln dagegen eher aktuelle politische Entwicklungen, Wünsche und Reaktionen als eine durchgehende historische oder gar religiöse Praxis beziehungsweise Konstante wider.
Interessant wäre es noch weiter den Wurzeln der Speise-, Trank- und sonstigen Vorschriften nachzugehen – da geht es oft nämlich um ökologische / landwirtschaftliche Effizienzsteigerung (Schweinezucht in (semi)ariden Regionen wenig praktikabel, da die Tiere viel Wasser und Schatten benötigen), soziale Kontrolle und Hierarchisierung der Gesellschaft (Verbote sichern Herrschenden Zugang zu begehrten Ressourcen), Stärkung der Gemeinschaftsidentität und kulturelle Abgrenzung von Nachbarn…
Natürlich, das war mir auch bewusst. Deswegen wollte ich die zusätzliche Perspektive ja bloß reinbringen. Es ist ja recht wenig über die vielen islamischen Epochen und Islame bekannt. Ich weiß auch nicht ob Sie oder Mitforisten ad hoc z.B. die ältesten Moscheen Deutschlands oder der Niederlande benennen könnten oder hiervon schon einmal gehört haben.
(Anti-)Kolonialismus ist freilich auch nur ein Aspekt, das Ganze ist – wie so vieles – eine multikausale Geschichte. Auch innerstaatliche Machtpolitik (Haus Saud), ausländische Macht- und Geopolitik (Förderung durch das Ausland von bestimmten regressiven Strömungen, bspw. westliche Bevorzugung von Haus Saud etc. und hierdurch entstehende Räume für Salafismus und Co.), religiöse Überzeugungen und Trends etc. spielen ihre Rollen.
Den Punkt habe ich gar nicht in Abrede stellen wollen.
Die Frage ist nur wie viel man mit solchen i.d.R. staatlich gespeisten / -erhobenen Pro-Kopf-Statistiken anfangen kann. Hierzu verweise ich bloß nochmals auf das zitierte Schmuggelbeispiel zum ʿaraq sagī. Der Artikel heißt nicht umsonst: Why drinking wine in Iran is completely normal.
Meine Replik wurde nun wieder etwas länger. Sehen Sie und unsere Mitleser es mir bitte nach.
Ich bin soweit gespannt auf den nächsten Teil und wünsche Ihnen und den anderen einen guten Start in den Tag!
Aus einem entsprechenden ‚Ratgeber‘ ein paar weitere hilfreiche Tipps…
„Wenn Sie Wert darauf legen sollten, sich einmal zu fühlen wie der Hauptdarsteller in einem Hieronymus-Bosch-Gemälde, dann brauen Sie sich einfach einen Stechapfeltee. Diese nicht zu unterschätzende Naturdroge wächst in jedem besseren deutschen Gehölz und fällt nicht unter das BtmG ! Vorsicht allerdings bei der Dosierung ! Es gilt die Faustregel : Wenn ungefähr eine Stunde nach Einnahme der Droge die gesamte Belegschaft der ‚Versuchung des heiligen Antonius‘ auf einen Sprung vorbeikommt, war die Dosierung richtig; wenn Sie mit Schaum vor dem Mund an eine Tragbahre geschnallt zum Notarztwagen getragen werden, zu hoch. In beiden Fällen werden Sie eine interessante Zeit haben – wenn Sie es interessant finden zu wissen, wie sich ein klinischer Paranoiker auf der Höhe eines schizoiden Schubes fühlt.
Die schlimmsten Halluzinationen klingen schon nach einigen Tagen ab.
Wie man die Wirkung von Stechapfel simuliert : Mit einer verdorbenen Fischkonserve lassen sich sehr ähnliche Resultate erzielen.
Aktivitäten : Besenritte, schwarze Messen.
Musik : Carl Orff, Black Sabbath.
—
Pilze
Die mildesten Ergebnisse erzielen Sie mit Champignons, die wildesten mit Fliegenpilzen. Etwa in der Mitte liegen die Psilozybin-Pilze; kleine unscheinbare Gesellen mit manchmal magischer Wirkung. Doch keine Angst – wenn LSD der Porsche unter den bewußtseinserweiternden Drogen ist, dann ist Psilozybin das Fahrrad.
Das bedeutet, die Grenzen der Wahrnehmung werden nie so drastisch erweitert, daß man glaubt, man habe fünf Lippen – drei Lippen sind das Höchste. Falls Sie die Pilze richtig dosiert haben, werden Sie bald eine nie gekannte Liebe für alle Lebensformen spüren : für Menschen, für Tiere, für Pflanzen und besonders für Pilze.
Wie man die Wirkung von Pilzen simuliert : Wie LSD *, aber mit Leichtzigaretten.
Aktivitäten : Pilze sammeln.
Musik : Beatles.
* 15 Minuten hyperventilieren und zwei Gauloises gleichzeitig auf Lunge rauchen. Hinlegen.
😂 MMM (made my morning)
Danke!
Das Tippgeben erinnert mich freilich ansonsten irgendwie an meinen Osterwitz vom letzten Jahr hier.
An dieser Stelle nochmals im Fließtext, falls der Link hängt:
Es war einmal der Osterhase, der wollte sich nach einem richtig stressigen Osterwochenende mit viel Eierverteilen und endlosem Herumgehoppel ein wenig entspannen. Glücklicherweise war schönes Wetter und so begab es sich, dass er mittags mit Picknickkorb und Liegestuhl an den nahen Baggersee fuhr, um eine Runde zu chillen. Er holte seine Sandwichs aus dem Korb, eine Flasche Tawny Port und zum Schluss drehte er sich dem entkriminalisierten Cannabis‘ sei Dank eine schöne Tüte und rauchte genüsslich vor sich hin. Wie so vor sich hin kichernd in seinem Stuhl liegt, kommt ein Biber des Weges. Er sieht den Osterhasen und spricht ihn an:
„Mensch Hase, was geht’n bei dir Dir ab? Haste etwa was geraucht? Das muss ja richtig krasses Zeug sein, lass mich auch was abhaben.“
Der Osterhase dreht ganz langsam den Kopf, blickt den Biber an und meint dann gediegen: „Ne, Alder. Das ist alles meins. Denn das hab‘ ich mir nach dem Wochenende mal so richtig verdient.“
Aber der Biber lässt so schnell nicht locker und bettelt: „Oh bitte, Hase! Ich hab noch nie in meinem Leben gekifft und dein Zeug muss ja wirklich der Hit sein! Lass mich das bitte bitte bitte mal probieren!“
Der Osterhase seufzt. Er will ja kein Spielverderber sein. Und so meint er: „Okay, Biber. Aber wirklich nur ein Zug. Und hör zu: Damit es sich für dich auch wirklich lohnt und richtig reinzieht, hältste nach dem Einatmen die Luft an, tauchst dann unter und durchquerst den See bis du auf der anderen Seite wieder rauskommst.“
Der Biber nickt ganz freudig und tut wie ihm geheißen. Er zieht am Joint des Osterhasen, spurtet ins Wasser, taucht unter und durch den ganzen See bis er auf der anderen See wieder herauskommt. Dort atmet er dann aus und der Stoff des Osterhasen knallt wirklich heftig rein. Und so liegt der Biber schließlich dort im Gras, philosophiert mit sich über Gott und die Welt und chillt ebenfalls vor sich hin.
Da kommt ein Nilpferd des Weges. Es sieht den Biber und fragt sogleich: „Biber, was geht denn bei dir ab? Du hast bestimmt dank des neuen Gesetzes zu kiffen begonnen, nicht wahr? Gib mir auch was von deinem Zeug, das muss ja derbe gut sein!“ Da antwortet der Biber in aller Gelassenheit und Ruhe: „Sorry, Digga. Den Stoff hab‘ ich selber nur geschnorrt. Der ist vom Osterhasen, den musste fragen.“ „Vom Osterhasen?!“, fragt das Nilpferd perplex. „Genau dem. Der liegt auf der anderen Seeseite. Musste einfach quer durchtauchen und dann siehste ihn schon.“
,Stabil!‘, denkt sich das Nilpferd. Es wuselt zum See und taucht durch den See zum Osterhasen. Der liegt einstweilen immer noch in seinem Liegestuhl, lässt sich von der Frühlingssonne den Pelz wärmen und genießt die frische Luft und die Atmosphäre am Ufer. Plötzlich hört er ein lautes Platschen und wie er seine Lider hebt, sieht er das Nilpferd aus dem Wasser auftauchen. Er starrt es mit großen Augen und schreit dann lauthals: „Ausatmen, Biber, AUSATMEN!!!“
PS: Nicht nachmachen Kinder! Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragt ihr am besten nicht straightedge Altlandrebell, sondern euren Arzt, Apotheker oder Herrn Schleim.
@ALR
😄. Ich kannte den allerdings schon, den hat uns mal ein Dozent in meiner Zusatzausbildung (dürfte dementsprechend schon ungefähr 15 Jahre her sein) erzählt.
Für Sie, mich und noch ein paar andere hätte ich übrigens noch die ultimative Drogen-Empfehlung :
GRUNZ – Die neue Intellektuellendroge
Macht für die Dauer von 3 Stunden dumm wie Brot. Der IQ sinkt auf 12, aber man pfeift auf das Elend der Welt und kann vögeln wie ein sizilianischer Zementmischer. (Es ist dann übrigens von Vorteil, wenn man vorher ein wenig Pimperanto gelernt hat / Anm. B.)
Nufta !
🤣
Warum es „GRUNZ“ nennt, erschließt sich mir freilich nicht. Schweine sind sehr kluge und soziale Wesen, zumindest eher als gewisse Mitmenschen. Wenn dann müsste die Droge einen ja nicht dumm, sondern schweinchenschlau machen? 🤔🐖📚
danke, herzlich habe ich lachen können über Das Leben des Brian mit Drogen, echt witzig ihr Erfahrungsbericht(?)!!:))
Das stammt aus dem Buch „Schöner leben mit dem kleinen Arschloch: Drogen“ von Walter Moers.
Na, wenigstens einer hat die Grundlagen-Literatur bei sich im Regal… 😉
Zwischen Fantasy-Literatur und dem ganzen hochtrabenden Scheiß von Marx, Bourdieu und Co. braucht man eben auch noch ein paar NÜTZLICHE Bücher. 😉
@Konrad
Schön (??!!) wär’s.
Nein, die Herkunft wurde schon von DasNarf beantwortet.
In diesem ultimativen Lebenshilfe-Ratgeber (und einer, der den Namen wirklich verdient 😄) werden noch viele weitere wissenswerte Dinge vermittelt, so z.B. über das männliche Glied.
„Das männliche Glied gilt als der Mercedes unter den Geschlechtsorganen. In erregtem Zustand erreicht ein normalgewachsenes männliches Glied eine Länge von 60 cm und wiegt ungefähr 3 Kilo. Aber selbst ein Glied von nur 40 cm kann bei feuchter Witterung noch zeugungsfähig sein. Das männliche Glied kann exakt 950 Mal ejakulieren, das entspricht ziemlich genau einem halben Eimer.“
Wer hat da gerade ‚Steinlaus‘ gerufen ?
In der NS-Diktatur wurde unter der Handelsbezeichnung Pervitin (informell auch als „Panzerschokolade“, „Fliegermarzipan“, „Hermann-Göring-Pillen“ und „Stuka-Tabletten“ bezeichnet) anfangs großzügig preiswertes Methamphetamin an die Wehrmacht ausgegeben, weil das die Risikobereitschaft, Rücksichtslosigkeit sowie den Wagemut und das Durchhaltevermögen der Mannschaften kostengünstig zu steigern vermochte – allein zwischen April bis Juni 1940 (im sogennanten Blitzkrieg) 35 Millionen Pervitin-Tabletten, aber es war auch festzustellen, dass die Einnahme längerfristig zu erheblichen, wehrkraftzersetzenden Beinträchtigungen führte.
interessant, aber in einer traurigen Art, das Zeug war also mit Pervitin richtig benannt…es hat offensichtlich wohl die NS Wehrmächtigen so sehr pervertiert daß Sie besonders beim Ostzug so richtig pervers zur Sache gegangen sind ohne Hemmungen oder moralische Bedenken…?! Wie ich informiert bin waren ja wohl die gesamten NS, besonders die großkotzigen Führer und fetten Schweine wie Göring nicht nur Verbrecher aber auch alle voll auf Drogen ihrer Wahl…von Alkohol bis Heroin alles war drin und wurde wohl problemlos geliefert für hemmungsloses Morden und Plündern der Schätze anderer Leute…wollte nur andeuten was nur ein Name uns alles sagen kann und könnte oder so?
>>…aber auch alle voll auf Drogen ihrer Wahl…<<
Vermutlich – im Einzelnen aber auch schwer zu belegen. Hitler war war höchstwahrscheinlich ebenfalls meist auf Speed, was sich natürlich negativ auf seine psychische Verfassung ausgewirkt haben könnte. Methamphetamin war in D. damals (neben Hexensalben) der einzig verfügbare, chemische Kampfkraftbooster. Der weit verbreitete Alkoholgenuss war der militärischen Überlegenheit hingegen abträglich, weil die pyhsische und psychische Kondition der Wehrwilligen (oder -pflichtigen, wenn Sie wollen) in einem nicht tragfähigen Ausmaß darunter litt. Noch im preußischen Heere diente ausschließlich Alkohol in Verbindung mit schlechtem Tobak und gelegentichem Spießrutenlaufen dazu, die Truppe bei Laune zu halten.
Bezüglich dessen, was ihm sein Leibarzt da nebst Vitaminpräparaten im Detail injizierte, wusste das niemand genauer als ebenjeniger, aber der ist nicht mehr vernehmungsfähig – ob zum Beispiel auch die Edeldroge Kokain auf dem Behandlungsplan stand, ist nicht überliefert und die Admiral Graf Spee wurde vor Montevideo versenkt, nachdem sie dort Fracht aufgenommen haben könnte. Die Rattenlinie der KZ-Ärzte bildete sich erst später ab, gleichzeitig aber begann der Siegeszug der späteren Manager-Droge Kokain.
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Hitlers-geheime-Drogensucht-311969.html
Bezogen auf ihre letzte Frage: Das wäre zutreffend, wenn die Nazis dieses Teufelszeug unter dem Namen Perversin, statt Pervitin vermarktet hätten, aber vielleicht kommt das ja noch. Wir können schließlich auch Drohnenkrieg und KI.
Bei meinen BTMS steht neuerdings drauf: Versehentliche Anwendung kann zum Tode führen. Sicher, denn Idioten schnibbeln die Dinger klein und (Anwender-)Idioten legen sich die Teile auf die Zunge.
Aber das nimmt Anwender ja billigend in Kauf, wenn er sich beim Erstbesten etwas Spaß andrehen läßt.